
(Rom) Der zu Ende gehende Sommer war von teils hartnäckigen Gerüchten über einen möglichen Rücktritt von Papst Franziskus geprägt. Grund dafür war auch ein Aufsatz von Geraldina Boni, Professorin für Kirchenrecht an der Universität Bologna und Consultorin des Päpstlichen Rates für Gesetzestexte, in der juristischen Online-Fachzeitschrift Stato, Chiese e pluralismo confessionale (Staat, Kirchen und konfessioneller Pluralismus), die vom Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Juristischen Fakultät der Universität Mailand herausgegeben wird.
In diesem Aufsatz, der im Juli erschienen ist, widmet sich Boni einem Gesetzesvorschlag, der zwei „Lücken“ in der derzeitigen kirchlichen Rechtsordnung schließen soll, die den Heiligen Stuhl für den Fall einer „völligen Behinderung“ und des „Amtsverzichts“ eines Papstes betreffen.
Die Stellung der Autorin als Beraterin im Vatikan reichte aus, um Rücktrittsgerüchte glaubwürdig erscheinen zu lassen, da der Vatikan Normen für eine nicht ferne Situation vorbereite. Doch Papst Franziskus dementierte persönlich. Der Gedanke eines Amtsverzichts habe ihn noch nicht einmal gestreift. In der Tat rührt sich in diese Richtung nichts, schon gar nicht durch Franziskus selbst, wie jüngst auch der Vatikanist Sandro Magister bestätigte.
Die Überlegungen sind eine Initiative der Juristin im fernen Bologna und nicht des Vatikans. Immerhin hat Boni mit ihrem Kollegen Andrea Zanotti den heute doppelt besetzten Lehrstuhl des Kamaldulensermönchs Gratian an der Universität Bologna inne, der mit dem Decretum Gratiani vor bald 900 Jahren zum Vater des Kirchenrechts wurde.
Hinter ihrem Vorstoß steht eine frei zugängliche Online-Plattform mit der etwas sperrigen Bezeichnung: „Forschungsgruppe – Völlige Behinderung des Römischen Stuhls und Rechtsstatus des Bischofs von Rom, der auf sein Amt verzichtet hat“. Dabei handelt es sich um „eine Gruppe von Kanonisten verschiedener Länder“, die zwei Gesetzesentwürfe ausgearbeitet hat, um nach eigenem Dafürhalten „Lücken im geltenden Kirchenrecht“ zu schließen. Angeführt wird die Gruppe von Boni und Zanotti.
Geraldina Boni hatte Anfang 2015 die Gültigkeit der Wahl von Papst Franziskus gegen die Ungültigkeitsthese von Antonio Socci verteidigt. Damals schrieb sie:
„Selbst wenn alles so vorgefallen wäre, wie es geschildert wird, ist der Wahlvorgang vollkommen ad normam iuris. Die Wahl von Papst Franziskus hat beim fünften Wahlgang die vorgeschriebene Mehrheit erreicht (der erste Wahlgang erfolgte am 12. März, vier am 13. März). Die Frage der Gültigkeit stellt sich nicht.
Angesichts der völligen Haltlosigkeit der Mutmaßungen löst sich auch die von manchen geäußerte Sorge im Nichts auf, daß ein zweifelhafter Papst auf dem Stuhl Petri sitzen könnte. Das Kirchenrecht hat beständig und einhellig erklärt, daß die pacifica universalis ecclesiae adhaesio untrügliches Zeichen einer gültigen Wahl und eines rechtmäßigen Papstes ist. Die Anhänglichkeit des Volks Gottes an Papst Franziskus kann in keiner Weise bezweifelt werden.“
Wie es auf der Plattform heißt, erarbeitet die Gruppe Gesetzesprojekte, die, sobald sie angemessen erscheinen, „dem obersten Gesetzgeber“, das ist Papst Franziskus, übermittelt werden, damit dieser entscheiden könne, was mit diesem Anstoß geschehen soll.
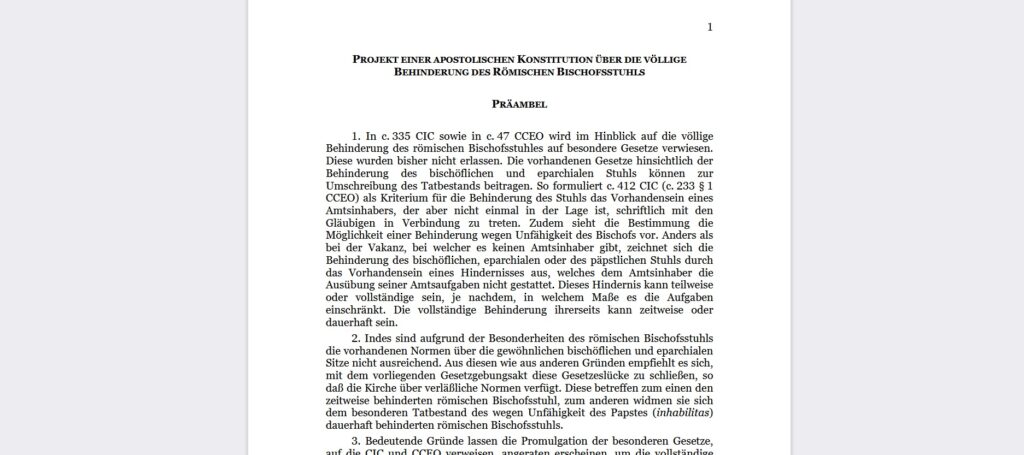
Amtsunfähiger Papst
Mit ihrem Aufsatz in der Fachzeitschrift präsentierte Boni den Stand der Ausarbeitung. Mit einem neuen Beitrag für den Blog Settimo Cielo des Vatikanisten Sandro Magister stellte sie nun die Gruppe und deren Tätigkeit erstmals der breiteren Öffentlichkeit vor. Ausgangspunkt für deren Entstehung, so die Kirchenrechtlerin, war der Rücktritt von Papst Benedikt XVI., der „zu einer noch nie dagewesenen Koexistenz des amtierenden mit dem ‚emeritierten‘ Papst“ führte.
„Außerdem wird immer deutlicher, daß Umstände eintreten können, in denen ein Papst aufgrund seines fortgeschrittenen Alters oder schwerer gesundheitlicher Probleme mit Hilfe von Medizin und Technik am Leben bleibt, aber nicht in der Lage ist, das ‚munus petrinum‘ auszuüben.“
Die „völlige Behinderung“ des Römischen Stuhls werde im Codex des kanonischen Rechts nur erwähnt, aber nicht geregelt, obwohl canon 335 für diesen Fall auf ein Sondergesetz verweist, „das nie erlassen wurde“. Es gebe „keine juristische Lösung, um der Weltkirche ihr Oberhaupt sicherzustellen, wenn der Papst sie aufgrund einer totalen, dauerhaften und irreversiblen Behinderung nicht mehr leiten kann“. Dieser Fall bedeute nämlich einen schweren Schaden für den Kirchenkörper.
„Dies sind zwei wichtige Rechtslücken, die geschlossen werden sollten.“
Die Gruppe von Kanonisten hat ihre Vorarbeiten zur Schließung dieser Lücken in mehreren Sprachen zur Verfügung gestellt, darunter auch auf deutsch, um die Diskussion darüber anzuregen. Referenztexte sind dabei die italienische und die spanische Fassung.
„Die wichtigste Neuerung in dem Projekt über den behinderten Römischen Stuhl betrifft die Einführung (auch durch eine Änderung des Codex Iuris Canonici) der totalen Behinderung aufgrund der irreparablen ‚inhabilitas‘ des Papstes als dritten Grund für die Beendigung des Petrusamtes, der zu Tod und Verzicht hinzukommen würde.“
Boni schreibt dazu:
„Für den Fall, daß der Römische Stuhl aufgrund einer irreparablen ‚inhabilitas‘ des Papstes – so daß er auch freiwillig nicht auf sein Amt verzichten kann – vollständig behindert ist, wird der Zustand, der durch sorgfältig geregelte Verfahren (unter Einschaltung eines medizinischen Rates und der Ratifizierung durch das Kardinalskollegium mit qualifizierter Mehrheit) festgestellt und erklärt wird, rechtlich mit der Sedisvakanz gleichgesetzt: mit der anschließenden Einberufung des Konklaves zur Wahl des neuen Nachfolgers Petri.“
Damit würde die Stufe des Amtsverzichts übergangen, um direkt zur Sedisvakanz zu gelangen, da eine Rücktrittserklärung dem Papst wegen völliger Amtsunfähigkeit unmöglich wäre.

Emeritierter Papst
Zum Projekt über den „emeritierten Papst“, schreibt Boni, daß „angesichts der heiklen Lage“ beschlossen wurde, „die Disziplin erheblich einzuschränken und nur einige unbedingt notwendige Normen aufzunehmen, um schädliche Mißverständnisse zu vermeiden und praktische Probleme zu lösen“.
Die darin genannten Maßnahmen seien nicht als Vorschriften, sondern als Ermahnung formuliert, um „die Ausübung bestimmter Rechte des Verzichtenden zu mäßigen“, aber „die Würde der Person, die den Thron Petri besetzt, in keiner Weise zu verletzen“. Konkret werden „einige wichtige Normen über den Akt des Verzichts, Bestimmungen über den Titel, den Wohnsitz, den Unterhalt, die Beziehungen zum Papst, die Lebensführung, kirchliche und öffentliche Pflichten und das Begräbnis des verzichtenden Bischofs von Rom“ angeführt.
Die vor kurzem freigeschaltete Internet-Plattform, so Boni, wurde als virtueller „Ort“ des wissenschaftlichen Austausches geschaffen. Am Ende des Ausarbeitungsprozesses sollen die Gesetzesentwürfe mit Hilfe von Latinisten in ein angemessenes Rechtslatein samt Kommentaren übertragen werden.
Es sei die Absicht, so Boni, daß das Kirchenrecht damit „seine Kenntnisse und Fähigkeiten in den Dienst des Stellvertreters Christi und mit ihm der Kirche und des Gottesvolkes“ stellt.
Boni thematisiert nicht, daß mit der Schließung der genannten Lücken neue Rechtsinstitute geschaffen werden, welche die Kirche in ihrer bald zweitausendjährigen Geschichte nicht kennt und offensichtlich auch nicht brauchte.
Die krankheitsbedingte Amtsunfähigkeit ist kein neues Phänomen und die beispiellose Koexistenz zweier Päpste einzig dem singulären Schritt Benedikts XVI. geschuldet, die mit seinem Tod entfällt. Erst die von Boni und Zanotti vorgeschlagene Normierung des Amtsverzichts würde die Institutionalisierung des „emeritierten Papstes“ bedeuten, was zunächst die Klärung der Vorfrage verlangen würde, ob die Kirche eine institutionalisierte Kohabitation überhaupt wünscht und sie ihr guttut. Die göttliche Stiftung des Petrusdienstes und die kirchliche Tradition scheinen dies vielmehr auszuschließen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL/progettocanonicosederomana.com/Youtube (Screenshot)




