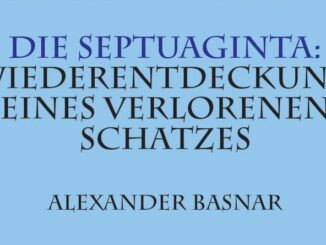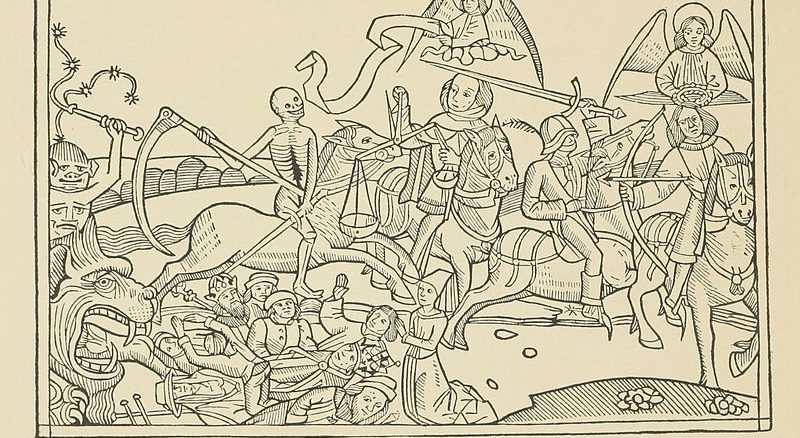
Von Wolfram Schrems*
In Zeiten, da sich wirkliche oder angebliche Privatoffenbarungen schnell verbreiten und viele Gläubige beunruhigen, ist es keine schlechte Idee, sich auf die kirchlichen Kriterien für Privatoffenbarungen zu besinnen. Der Alverna-Verlag brachte schon 2015 eine dünne, aber inhaltsreiche Broschüre heraus, die dazu gute Informationen liefert. Der Autor wertet dabei Klassiker der Spirituellen Theologie und offizielle Kirchendokumente aus.
Worum geht es?
Der unter Pseudonym schreibende Autor ist ein theologisch gebildeter Laie und Erwachsenenbildner, der seine Publikationen von glaubenstreuen Theologen überprüfen läßt. In dem Buch legt er die Kriterien dar, nach denen die Kirche an einzelne Gläubige gerichtete spezielle Offenbarungen überprüft und beurteilt.
Der Autor zitiert die kirchlichen Dokumente (Kongregation für die Glaubenslehre, Normen für das Verfahren zur Beurteilung mutmaßlicher Erscheinungen und Offenbarungen, 25.02.78) und die theologischen Fachleute auf diesem Gebiet. Neben den Mystikern selbst, also Theresa von Avila, Johannes vom Kreuz, Ignatius von Loyola und Franz von Sales, sind das besonders Papst Benedikt XIV. (Prospero Lambertini), Kardinal Giovanni Bona SOCist, Réginald Garrigou-Lagrange OP, Alois Mager OSB, Augustin Poulain SJ (man findet auch „Auguste“), Giovanni Battista Scaramelli SJ, Marianne Schlosser und Josef Zahn. Ein reichhaltiges Literaturverzeichnis regt zu weiteren Forschungen an.
Im Vorwort konstatiert der Autor den „Beginn einer Zeit“ im Jahr 1830 mit den Erscheinungen der Muttergottes in der Rue du Bac. Maria zeigt sich „immer wieder den Menschen“ und ruft sie „zur Umkehr und Buße“ auf: in La Salette 1846, in Lourdes 1858, in Fatima 1917, in Beauraing 1932 und in Banneux 1933. Alle diese Erscheinungen brachten reiche Früchte (5). (Wir müssen allerdings aus heutiger Sicht ergänzen: nicht genügend.)
Allerdings warnte Kardinal Ottaviani 1951 „vor der Sucht nach dem Wunderbaren, die zu einer ernsten Gefahr für das christliche Leben wird“ (6).
Das ist der Ausgangspunkt für die Darlegung der Kriterien von echt und unecht.
Anerkannte Privatoffenbarungen – wichtig für die Kirche
Zunächst definiert der Autor den Bereich der übernatürlichen und der natürlichen Offenbarung.

Innerhalb ersterer gibt es die öffentliche Offenbarung und die Privatoffenbarungen, „übernatürliche göttliche Kundgebungen, welche nach Abschluss der für die ganze Menschheit bestimmten, göttlichen Offenbarung einzelnen Personen zu Teil werden“ (11).
Letztere enthalten nichts, was nicht zumindest implizit im Glaubensgut enthalten wäre. Sie können sich direkt an eine einzelne Person zu deren eigenem Nutzen richten oder an eine Person mit dem Auftrag, die Inhalte dieser Offenbarung der Kirche bekannt zu machen. Sie sind zwar, sobald von der Kirche anerkannt (Hildegard von Bingen, Franziskus von Assisi, Johanna von Orleans, Margaretha Maria Alacoque u. a.) nicht im Glauben verpflichtend anzunehmen, dürfen aber auch nicht grundlos abgelehnt werden (12f).
Kirchliches Prüfverfahren zwischen göttlicher, menschlicher und teuflischer Aktivität
Die kirchliche Autorität prüft neben dem Inhalt der Offenbarung die Umstände ihrer Übermittlung und die Auswirkungen: Besteht die Botschaft den Test der Zeit? Widerlegt sie die Kritik? Regt sie zu wichtigen Unternehmungen an? Haben sich Verheißungen erfüllt? Wie sind die Früchte?
Die kirchliche Autorität prüft auch die psychische Gesundheit und die Bildung des Übermittlers und vor allem den Lebenswandel vor und nach dem Geschehen der Offenbarung. Für die Glaubwürdigkeit der Offenbarung spricht naturgemäß, wenn sich der Lebenswandel verbessert.
Klar ist aber auch, daß Empfänger von Offenbarungen nicht „automatisch und sofort den Folgen der Erbsünde enthoben“ werden (18):
„Der Empfänger der Privatoffenbarungen unterliegt geschöpflichen Einschränkungen, die bei der Beurteilung derselben berücksichtigt werden müssen. Gott wiederum passt sich dem Empfangenden in verschiedenen Hinsichten an. Dann ist bei der Beurteilung der Kundgebungen die Absicht, der Zweck massgebend“ (21).
Der Autor führt aus, daß die Überprüfung der Glaubwürdigkeit der Botschaften sehr schwierig sein kann, weil auch gilt:
„Krankhafte Elemente und charismatische, bzw. mystische Gnaden müssen sich nicht ausschliessen“ (29).

Darüber hinaus muß man mit der Möglichkeit dämonischer Aktivitäten rechnen. Die echten Mystiker waren aus diesem Grund sehr mißtrauisch gegen außerordentliche Phänomene. Ein tragisches Kapitel, das der Autor einfügt, sind diejenigen Mönche und Wüstenväter, die sich vom Widersacher täuschen ließen.
Bedeutende Mystiker wie die hl. Theresa, der hl. Johannes vom Kreuz und der hl. Ignatius berichten aus eigenem Erleben von teuflischen Finten. Sie warnen davor, spezielle Offenbarungen erhalten zu wollen. Interessant ist die Begründung des hl. Johannes vom Kreuz, eines der eminenten Lehrer des mystischen Lebens, bezüglich seiner Zurückhaltung gegenüber Privatoffenbarungen: Es bestehe die Möglichkeit der Täuschung, aber vor allem können sie das „Leben des reinen Glaubens“ behindern (84).
Demut, Gehorsam, Nüchternheit und gesunder Menschenverstand als Kriterien der Echtheit
Daß große, von der Kirche anerkannte Mystiker zu Nüchternheit mahnen und die Konsultation der offiziellen Offenbarungsquellen, der allgemeinen kirchlichen Lehre und des gesunden Menschenverstandes anstatt der Suche nach außerordentlichen Ereignissen empfehlen, ist eine wichtige Lektion, die der Leser aus diesem Buch ziehen kann. Echte Mystiker sind nie überspannt und – was angesichts der Exzesse von falschen Enthusiasten wichtig festzuhalten ist – verstoßen auch nicht gegen die guten Sitten.
Der Autor berichtet plastisch über die drastischen Methoden, die etwa der hl. Philipp Neri anwandte, als er im Auftrag des Papstes eine Nonne, die sich des Rufes der Heiligkeit erfreute, und die Gründerin der Gesellschaft der Theatinerinnen Ursula Benincasa, Empfängerin einer göttlichen Botschaft an den Papst, dieser solle in der Reform mehr Eifer an den Tag legen, überprüfen sollte. Bei ersterer war er schnell fertig, nachdem er den Mangel an Demut konstatiert hatte (66). Die zweite behandelte er über einen längeren Zeitraum sehr hart, weil er sich selbst nicht sicher war. Schließlich anerkannte er die Authentizität der Botschaft (67).
Ein wichtiges und unverzichtbares Zeichen der Echtheit mystischer Gottverbundenheit ist also die Demut auf Seiten des Offenbarungsempfängers.
Ein anderes Zeichen sind die massiven Schwierigkeiten, die der solcherart Ausgezeichnete durchstehen muß:

„Der Dominikaner Heinrich Seuse wurde als Kirchenräuber, Scheinheiliger, Betrüger und Giftmischer verschrien. Die hl. Theresia von Avila wurde als Verrückte und vom Teufel Besessene erklärt. […] Der hl. Alfons v. Liguori wurde von den eigenen geistlichen Söhnen aus dem von ihm selbst gegründeten Orden und dessen Oberer er war, ausgestossen“ (53).
Man beachte: Seuse († 1366) lebte im katholisch geprägten „Mittelalter“. Die hl. Theresa lebte im 16. Jahrhundert, nur eine Generation nach der erfolgreichen Reconquista und im Zeitalter bedeutender Missionare und katholischer Staatsmänner. Echte Gottesumgänger hatten es also auch in denjenigen Zeiten schwer, in denen grundsätzlich das Evangelium regierte (um auf ein Kapitel in Roberto de Mattei, Verteidigung der Tradition, anzuspielen). Es wäre also ein Irrtum zu meinen, daß Widerstände gegen Gottesboten auf Zeiten allgemeiner Lauheit oder verbreiteten Glaubensabfalls beschränkt wären.
Kirchlichkeit als weiteres Kriterium
Echte Privatoffenbarungen haben immer den Sinn, der Kirche zu nützen. Die Empfänger dieser Offenbarungen stellen sich nie gegen die kirchliche Lehre und die legitime kirchliche Autorität als solche. An den Beispielen der hl. Margareta Maria Alacoque und der sel. Anna Maria Taigi „wird deutlich, wie falsch die Vorstellung ist, wenn man meint, man könne Privatoffenbarungen gegen die Kirche ausspielen. Die echten Offenbarungen sprechen sich selbst explizit gegen eine solche Vorstellung aus. Im Gegenteil, sie leiten die Begnadeten zum vollkommenen Gehorsam“ (69).
Das gilt auch dann, wenn die Hierarchie selbst dem Begnadeten das Leben schwer macht: Etliche Heilige und Visionäre, unter ihnen Franz von Assisi und Ignatius von Loyola, „hatten mit grossen Schwierigkeiten, auch von Kirchenvertretern herrührend, zu kämpfen. Doch trotz allem war ihnen die Anbindung an die kirchliche Hierarchie, die Einordnung in das Gesamtgefüge des mystischen Leibes Christi und die Abhängigkeit gegenüber den rechtmässigen Stellvertretern Christi eine Selbstverständlichkeit“ (71).
Konkrete Fragen unserer Zeit: „die Warnung“ und Medjugorje
Der Autor schreibt unter dem Titel „Betrug“:

„Der aktuelle Fall der Maria Divine Mercy (Pseudonym für Mary McGovern-Carberry) deren angebliche Offenbarungen unter dem Titel ‚Die Warnung‘ viele in den Bann zogen, und nun als Betrug entlarvt wurden, ist eine klare Warnung an alle leichtgläubigen Christen!“ (34f.)
Der Autor ist kritisch gegenüber den Vorgängen im herzegowinischen Međugorje. Er thematisiert den problematischen Lebenswandel einiger der dortigen Franziskaner bzw. Ex-Franziskaner und die negative Stellungnahme der Ortsbischöfe und der Bischofskonferenz (61). Er stößt sich an den „wenigen banalen, kurzen Sätzen, die auch im Katechismus nachgelesen werden könnten.“ Sicher könnten Offenbarungen auch einfache Wahrheiten enthalten, aber wenn es nur um „Gewöhnliches“ geht, sei das „sehr verdächtig“, genauso wie auch die extreme Häufigkeit der Botschaften. Der Autor kritisiert auch den stereotypen Satz „Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid!“ mit den Worten: „Als ob uns der Himmel danken müsste!“ (62)
Allerdings zeige uns die Geschichte, daß selbst „aus unechten Wallfahrtsstätten Segen gewirkt wurde“ (71, mit einer Fußnote zu Kardinal Ratzinger, P. Galot und E. Michael Jones, Das Geheimnis von Medjugorje).
Schlußfolgerungen
Man kann aus dem Gesagten also schlußfolgern: Wer erstens behauptet, Offenbarungen von Gott zu empfangen, muß vor den Vorhang. Anonym verbreitete Botschaften sind problematisch. Sie widersprechen der Vorgangsweise Gottes bei den Propheten des Alten und Neuen Testamentes (für letztere führt der Autor etwa Apg 11,27f an). Es kursieren heute viele solcher anonymen oder pseudonymen Botschaften. Die betreffenden Initiatoren müßten sich dem Urteil der Kirche und der Öffentlichkeit der Gläubigen stellen.
Nota bene: Gott bestraft diejenigen, die in seinem Namen Prophetien machen, ohne daß er sie dazu gesandt hätte (Jer 14,14f).
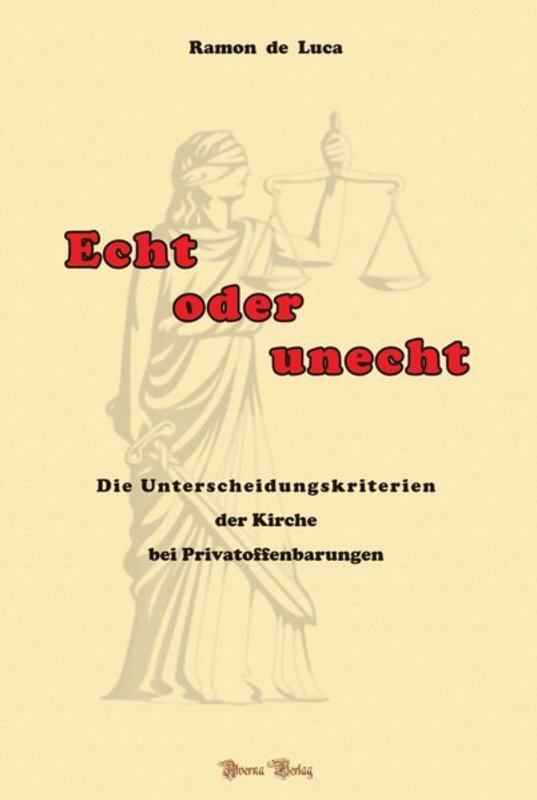
Zweitens fällt die Kirche keine im strengen Sinne unfehlbaren Entscheidungen bezüglich der Privatoffenbarungen. Folgendes mag vielleicht für manche überraschend klingen:
„Die Kirche gibt also über die Tatsache, ob eine private Offenbarung stattgefunden hat oder nicht, keine unfehlbare Entscheidung. Daher ist von Seiten der Gläubigen den approbierten Offenbarungen gegenüber ein Akt göttlichen Glaubens ‚weder notwendig noch möglich … sondern nur ein Akt menschlichen Glaubens nach den Regeln der Klugheit, die sie uns als wahrscheinlich und fromm glaubwürdig […] hinstellen‘“ (80).
Drittens empfiehlt es sich, dem Autor darin zu folgen, daß beide Extreme vermieden werden sollen: Leichtgläubigkeit und Wundersucht, aber auch komplette Verwerfung aller Privatoffenbarungen in Bausch und Bogen. Vermieden werden sollte aber auch Kleingläubigkeit, Spott und Kritiksucht bei anerkannten und durch unbezweifelbare Wunder bestätigten Offenbarungen:
„Wer Gott, dem Schöpfer und Erlöser, grundsätzlich das Eingreifen durch Privatoffenbarungen ‚zugesteht‘, was ein Katholik keinesfalls nicht tun kann, würde [bei eigener Beurteilung nach Lust und Laune] die geschuldete Ehrfurcht Gott gegenüber verletzen und würde sich vieler Gnaden unwürdig machen. Dies gilt speziell dann, wenn Wunder die Erscheinungen begleiten oder ihr folgen (wie in Lourdes und Fatima) und so dem Ganzen noch ein besonderes Glaubwürdigkeitszeichen verleihen“ (88).
Der Autor rät, sich hauptsächlich an die Heilige Schrift und die Dokumente der Kirche, besonders den Katechismus, und an die Liturgie zu halten (der Rezensent gestattet sich die Ergänzung: alles das von vor dem II. Vaticanum) und den persönlichen Kontakt mit Gott durch Sakramente und Gebet zu pflegen. Gewisse Schriften der Heiligen, die aufgrund von Offenbarungen entstanden sind, sind, wenn sie die Kirche approbiert hat, Geist vom Geist der Kirche und wir können ihnen vertrauen (89). Wenn es sich um Privatoffenbarungen zum Leben Jesu und Mariens handelt, sollen wir aber „kein Dogma“ daraus machen (88). Denn bei letzteren Offenbarungen finden sich auch Widersprüche in Details.
Das ist eine sehr gute Anweisung. –
Der Rezensent findet das Buch inhaltlich gut gemacht, aussagekräftig und zur persönlichen Konsultation hilfreich. Ein gewisses Manko sind allerdings die zahlreichen Verschreibungen.
Eine Anregung und drei kleine inhaltliche Kritikpunkte seien um der Wahrheit willen genannt:
Zunächst wären sowohl zum Thema Medjugorje als auch zu Inhalt und Überbringer der „Warnung“ mehr Informationen von Interesse. Gerade Medjugorje ist nach Ansicht des Rezensenten ein schwer zu deutendes Phänomen. Es ist klar, daß das Buch von der Zielsetzung her nur eine Einführung darstellt. Aber wenn der Autor schon die beiden genannten heiklen Gegenwartsfragen anschneidet, wäre eine gewisse Ausweitung des Umfangs durchaus zu rechtfertigen.
Der Autor erwähnt zweitens in Fußnote 2, S. 11, die Erklärung der Glaubenskongregation vom 26. Juni 2000 über Fatima. Diese habe auch den üblichen Ausdruck „Privatoffenbarung“ verwendet („als allgemein in der Tradition verwendeter Terminus“). Hier wäre in Anbetracht der dramatischen Vorgänge um die Anerkennung der Erscheinungen von Fatima durch den zuständigen Ortsbischof (1930) und die beiden Weihen Portugals an das Unbefleckte Herz Mariens durch den portugiesischen Episkopat (1931 und 1938) über das Herumlavieren bezüglich der Botschaft unter Pius XII. bis zu ihrer Sabotage durch Johannes XXIII. und aller Ungereimtheiten bis heute ein kritisches Wort zu dieser hochproblematischen Erklärung notwendig. Dies auch deshalb, weil der damalige Kardinal Joseph Ratzinger selbst den Inhalt der Fatima-Botschaft nicht korrekt darstellte und an ihr Zweifel säte (modernistische Interpretation des Vorgangs der Vision und Audition selbst, positive Nennung des Fatima-Feindes Eduard Dhanis SJ).
Zu beanstanden ist drittens die Formulierung:
„Es ist selbstverständlich, dass der Inhalt der Offenbarungen der Würde dessen entsprechen muss, der sie gegeben hat. Wenn also Dinge vorkommen, die der göttlichen Heiligkeit und seiner Weisheit oder der Moral entgegen sind, kann es kaum von seiner göttlichen Majestät herrühren“ (59).
Nach all dem, was der Autor selbst kenntnisreich und scharfsinnig geschrieben hat, überrascht hier das zögerliche „kaum“. Es muß „nicht“ heißen.
Übersehen hat viertens der Autor das außerordentlich liebenswürdige Detail, daß Unsere Liebe Frau von Lourdes die Seherin Bernadette Soubirous nicht mit „du“ ansprach, sondern siezte (!).1 Daher sollte die Übersetzung korrigiert werden (59). –
Dem Buch sind weitere Auflagen – mit allen nötigen Aktualisierungen und Erweiterungen – und große Verbreitung zu wünschen.
Ramon de Luca, Echt oder unecht – Die Unterscheidungskriterien der Kirche bei Privatoffenbarungen, Alverna Verlag, Wil (CH), 2., wesentlich überarbeitete und vermehrte Auflage, 2015, 97 Seiten.
Dieses und alle anderen lieferbaren Bücher können bequem über unsere Partnerbuchhandlung bezogen werden.
*Wolfram Schrems, Mag. theol., Mag. phil., Katechist, Pro Lifer, beschäftigt sich mit marianischen Botschaften, pilgerte nach Lourdes und Fatima. Und auch nach Medjugorje.
Bild: Wikicommons/Madre mia/Youtube (Screenshots)
1 Auf der offiziellen Netzseite des Heiligtums von Lourdes heißt es:
A la deuxième parole de la Vierge : « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours? », Bernadette est bouleversée. C’est la première fois qu’on lui dit « vous ». Bernadette, se sentant ainsi respectée et aimée, fait l’expérience d’être elle- même une personne. Nous sommes tous dignes aux yeux de Dieu. Parce que chacun est aimé par Dieu.“
Gemäß der deutschen Version auf derselben Seite lauten die beiden Sätze Unserer Lieben Frau so:
„Bernadette betet den Rosenkranz mit der Dame und fragt sie nach ihrem Namen. Die Worte Mariens: ‚Würden Sie die Güte haben, zwei Wochen lang hierher zu kommen?‘ ‚Ich verspreche Ihnen nicht, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, wohl aber in der anderen.‘“ (Hervorhebung WS)
Die offizielle Lourdes-Seite schreibt auch, daß Unsere Liebe Frau sich bei ihrer Selbstvorstellung der lokalen Sprache („Patois“) bediente, was ebenfalls ein reizendes Detail darstellt:
Le 25 mars 1858, jour de la seizième apparition, Bernadette demande à «la Dame» de dire son nom. «La Dame» lui répond en patois : «Que soy era Immaculada Counceptiou», ce qui veut dire en français «Je suis l’Immaculée Conception»
Auch Franz Werfel legt im Lied der Bernadette Wert auf diese Details, gemäß seinen Recherchen sprach die Dame überhaupt nur im Patois, und zwar in einer schönen und würdevollen Aussprache:
‚»Wollen Sie mir die Güte erweisen«, sagt die Dame, »fünfzehn Tage nacheinander hierher zu kommen.«
Sie spricht diese Worte nicht gut französisch, sondern im Patois des Landes Béarn und Bigorre, den Bernadette und die Ihren sprechen. Genau übersetzt, sagt sie auch nicht Güte (boutentat), sondern Gnade (grazia). Wollen Sie mir die Gnade erweisen, sagt sie also, und schließt nach einem sehr langen Schweigen mit viel leiserer Stimme noch ein Sätzchen an:
»Ich kann nicht versprechen, Sie in dieser Welt glücklich zu machen, aber in jener.«‘