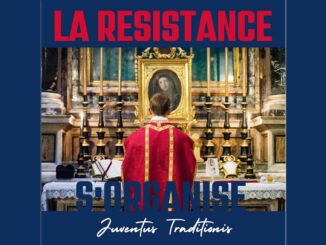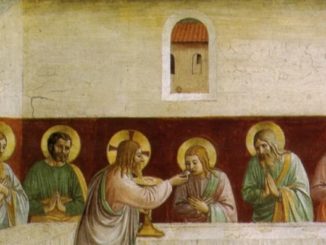von einer Katholikin 
„Ich bin überzeugt, daß die außerordentliche Form (des römischen Ritus) aus ihrer Natur heraus missionarisch ist: durch den Reichtum ihrer Symbolik, die Dichte ihrer Gebete, ihren Sinn für das Sakrale und ihren sehr ausgeprägten Theozentrismus. So, wie sie viele junge Katholiken anzieht, zieht sie auch junge Berufungen an, die es nach dem Absoluten dürstet.“
Pater Andrzej Komorowski, seit zwei Jahren Generaloberer der Priesterbruderschaft St. Petrus, spricht hier von der „missionarischen Dimension der überlieferten Liturgie“. In einem aktuellen Interview mit der französischen katholischen Monatszeitung La Nef (Juli-August 2020) beschreibt er das Apostolat der Bruderschaft und legt dar, warum die Priester der FSSP ausschließlich die Messe nach der außerordentlichen Form des römischen Ritus feiern und nicht auch gleichzeitig nach dem Missale Pauls VI. zelebrieren, wozu sie das kanonische Recht keineswegs verpflichte. Ihre Entscheidung entspringe der „Treue zu den lateinischen liturgischen und spirituellen Traditionen“, verweise aber auch auf „die Unzulänglichkeiten der ordentlichen Form“.
Für das kontinuierliche Wachsen der papst- und lehramtstreuen Priesterbruderschaft sei das Motu Proprio Summorum Pontificum von Papst Benedikt XVI. entscheidend gewesen.
„Das heilige Meßopfer steht im Zentrum der Spiritualität und des Apostolats der Bruderschaft.“
Es gehe um die „Heiligung der Priester durch die Hineingestaltung ihres ganzen Lebens in das am Altar gefeierte Mysterium, das Erlösungsopfer“, und ihr Hineinwirken in die Welt, in eine immer mehr entchristlichte Welt, die der Evangelisierung bedürfe.
Im Jahre 2020 wurden am 27. Juni in Frankreich drei von insgesamt 14 Neupriestern für die Petrusbruderschaft durch den Diözesanbischof (sic!) Msgr. Renauld de Dinechin in der Kathedrale von Laon geweiht. Es ist das erste Mal seit der Liturgiereform, daß in der Kathedrale wieder Priesterweihen in der außerordentlichen Form gespendet wurden.
Das Motu Proprio Summorum Pontificum
Das vor nunmehr dreizehn Jahren am 7. Juli 2007 veröffentlichte Motu Proprio trat am 14. September 2007 in Kraft und regelt die Rahmenbedingungen und den „Gebrauch der römischen Liturgie in der Gestalt vor der Reform von 1970“:
Art. 1. Das von Paul VI. promulgierte Römische Meßbuch ist die ordentliche Ausdrucksform der „Lex orandi“ der katholischen Kirche des lateinischen Ritus. Das vom hl. Pius V. promulgierte und vom sel. Johannes XXIII. neu herausgegebene Römische Meßbuch hat hingegen als außerordentliche Ausdrucksform derselben „Lex orandi“ der Kirche zu gelten, und aufgrund seines verehrungswürdigen und alten Gebrauchs soll es sich der gebotenen Ehre erfreuen. Diese zwei Ausdrucksformen der „Lex orandi“ der Kirche werden aber keineswegs zu einer Spaltung der „Lex credendi“ der Kirche führen; denn sie sind zwei Anwendungsformen des einen Römischen Ritus.
Die überlieferte Messe sollte so den Gläubigen wieder zugänglich gemacht werden, und tatsächlich ist die Nachfrage der Gläubigen stetig gewachsen, wobei auch junge Menschen auf der Suche dort eine geistliche Heimat fanden. Diese Entwicklung, die sich besonders schon nach dem Motu Proprio 1988 von Johannes XXIII. immer deutlicher abzuzeichnen begann, beschreibt auch Papst Benedikt XVI. in seinem Brief an die Bischöfe, der die Publikation von Summorum Pontificum begleitete:
„Hatte man unmittelbar nach dem Ende des II. Vaticanums annehmen können, das Verlangen nach dem Usus von 1962 beschränke sich auf die ältere Generation, die damit aufgewachsen war, so hat sich inzwischen gezeigt, daß junge Menschen diese liturgische Form entdecken, sich von ihr angezogen fühlen und hier eine ihnen besonders gemäße Form der Begegnung mit dem Mysterium der heiligen Eucharistie finden. So ist ein Bedarf nach klarer rechtlicher Regelung entstanden, der beim Motu Proprio von 1988 noch nicht sichtbar war; diese Normen beabsichtigen, gerade auch die Bischöfe davon zu entlasten, immer wieder neu abwägen zu müssen, wie auf die verschiedenen Situationen zu antworten sei.“
Angesichts der heutigen geistlichen und moralischen Erosion in Gesellschaft und Kirche und der Demontage des sakralen Priestertums ist es nicht nur für die der Tradition und dem Lehramt verbundenen Katholiken, sondern auch für Suchende wichtig, mit der unverfälschten Lehre in Berührung zu kommen. Das gilt gerade auch für Deutschland.
Auch hierzulande gibt es in den Diözesen Niederlassungen der romtreuen Tradition und eine ganze Reihe Meßorte, wo die „alte Messe“ gefeiert wird und es eine respektvolle Zusammenarbeit mit den Bischöfen und Ortsgemeinden gibt.
2017, zehn Jahre nach dem Motu Proprio, war man allerdings bemüht, die „Relevanz“ der alten Messe herunterzuspielen, sie als im statistischen Vergleich mit der neuen Messe als Randphänomen zu betrachten und auf Papst Franziskus‘ Desinteresse an der traditionellen Liturgie zu verweisen.
Schon 2011 hatte beispielsweise Bischof Fürst auf den Willen zu Veränderungen und Reformen in den katholischen Gemeinden gesetzt, den er schlicht und ergreifend daran ablas, daß es in seiner Diözese nur wenige Gläubige gebe, „die eine Messe im außerordentlichen Ritus wünschten“, womit er letztlich nur die spalterische Gleichung ‚traditionelle Messe = reformunwillige Gläubige‘ bestätigte. Er „fördere diese Bewegung nicht“, sagte er seinerzeit zur Ludwigsburger Kreiszeitung (20.5.2011). (Nota bene, es geht hier um Gläubige, „die klar die Verbindlichkeit des II. Vaticanums“ annehmen „und treu zum Papst und zu den Bischöfen“ stehen, wie Papst Benedikt XVI. in seinem Begleitbrief an die Bischöfe unterstreicht.)
Die Aussagekraft einer „Statistik“, die die Relevanz der alten Messe an Daten zum vermeintlichen „Bedarf“ koppelt, erscheint mehr als fragwürdig. Viele Katholiken haben nach wie vor nicht die Möglichkeit, eine Meßfeier in der außerordentlichen Form des römischen Ritus zu besuchen oder können lange Anfahrtswege nicht auf sich nehmen, Andere fragen gar nicht danach, weil sie die überlieferte Liturgie nicht kennen oder kennenlernen durften. Wieder andere resignieren, weil ihnen die Erfolgschancen für Genehmigungen von Meßfeiern zu gering sind.
Statistische Vergleiche zum Besuch der Sonntagsmesse oder der Beichtpraxis interessieren dagegen – aus gutem Grunde – nicht.
Anfang März dieses Jahres sandte die römische Glaubenskongregation an alle Diözesanbischöfe weltweit einen Fragebogen zur „vorkonziliaren“ Messe mit der Bitte um Rücksendung nach Rom bis Ende Juli 2020. Papst Franziskus möchte sich ein Bild machen von den positiven und negativen Aspekten, die die Umsetzung des Motu propio mit sich brachte.
Es ist nun freilich nicht hilfreich, hinter der Befragung der Bischöfe sofort das Gespenst einer schrittweisen Behinderung der alten Messe auftauchen zu sehen. Traditionsverbundene Katholiken gerade in Deutschland könnten dazu verständlicherweise neigen, weil sie sehen, wie wenig die Reformforderungen des sogenannten synodalen Wegs zu tun haben mit dem katholischen Glaubens-und Kirchenverständnis, das sich in der überlieferten Liturgie treu und unversehrt verwirklicht. Weil sie sich dem Traditionalismusvorwurf ausgesetzt sehen und der Generalverdacht des Spaltungswillens auf ihnen lastet, während „Maria 2.0“-Aktivistinnen von nicht wenigen Bischöfen und Gemeindepfarrern demonstrativ hofiert werden. Weil sie sehen, daß nichts geschieht, wenn selbst protestantische Pfarrer in der Messe die Eucharistie gespendet bekommen, und daß die Gläubigen in der neuen Messe vor liturgischen Mißbräuchen nicht sicher sind.
Was nach der Liturgiereform begann, hat seither kein Ende genommen. Auch heute werden „Menschen, die ganz im Glauben der Kirche verwurzelt (sind), durch die eigenmächtigen Entstellungen der Liturgie verletzt“:
„Wir wissen alle, daß in der von Erzbischof Lefebvre angeführten Bewegung das Stehen zum alten Missale zum äußeren Kennzeichen wurde; die Gründe für die sich hier anbahnende Spaltung reichten freilich viel tiefer. Viele Menschen, die klar die Verbindlichkeit des II. Vaticanums annahmen und treu zum Papst und zu den Bischöfen standen, sehnten sich doch auch nach der ihnen vertrauten Gestalt der heiligen Liturgie, zumal das neue Missale vielerorts nicht seiner Ordnung getreu gefeiert, sondern geradezu als eine Ermächtigung oder gar als Verpflichtung zur ‚Kreativität‘ aufgefaßt wurde, die oft zu kaum erträglichen Entstellungen der Liturgie führte. Ich spreche aus Erfahrung, da ich diese Phase in all ihren Erwartungen und Verwirrungen miterlebt habe. Und ich habe gesehen, wie tief Menschen, die ganz im Glauben der Kirche verwurzelt waren, durch die eigenmächtigen Entstellungen der Liturgie verletzt wurden.“ (Begleitbrief an die Bischöfe)
Und weiter:
„Die sicherste Gewähr dafür, daß das Missale Pauls VI. die Gemeinden eint und von ihnen geliebt wird, besteht im ehrfürchtigen Vollzug seiner Vorgaben, der seinen spirituellen Reichtum und seine theologische Tiefe sichtbar werden läßt.“
Dem Papst ging es eben auch:
„(…) um eine innere Versöhnung in der Kirche. In der Rückschau auf die Spaltungen, die den Leib Christi im Lauf der Jahrhunderte verwundet haben, entsteht immer wieder der Eindruck, daß in den kritischen Momenten, in denen sich die Spaltung anbahnte, von seiten der Verantwortlichen in der Kirche nicht genug getan worden ist, um Versöhnung und Einheit zu erhalten oder neu zu gewinnen; daß Versäumnisse in der Kirche mit schuld daran sind, daß Spaltungen sich verfestigen konnten. Diese Rückschau legt uns heute eine Verpflichtung auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um all denen das Verbleiben in der Einheit oder das neue Finden zu ihr zu ermöglichen, die wirklich Sehnsucht nach Einheit tragen.“
Wüßte man nicht um den Kontext dieser Worte, könnten sie genau so den heutigen deutschen „Verantwortlichen in der Kirche“ ins Stammbuch geschrieben worden sein, die auf dem sogenannten synodalen Weg eine Spaltung billigend in Kauf zu nehmen scheinen.
Es fällt leider schwer zu glauben, unsere Bischöfe könnten die Aufforderung von Papst Franziskus, im Rahmen der aktuellen Befragung konkrete Vorschläge zum Umgang mit der alten Messe zu machen, zum Anlaß nehmen, deren missionarische Dimension in Zukunft zu würdigen und gar zu nutzen.
Bild: FSSP