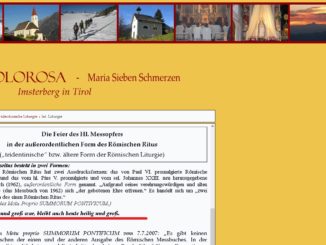(Wien) Kirchenumbauten unterlagen stets zeitbedingten Moden. Dennoch kritisieren Fachleute, darunter der Kunst- und Kulturkritiker Francesco Colafemmina, einerseits die „Entleerung“ im modernen Kirchenbau und andererseits die Anthropozentrik, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Die Antoniuskirche von Heinfels wurde zum Beispiel der Avantgarde.
Die Betonung des Menschen, man könnte auch Selbstbeweihräucherung sagen, führt – wie die vergangenen Jahrzehnte auf beeindruckende Weise gezeigt haben –, zu einer mehr oder weniger subtilen Verdrängung Gottes. Physisch erfolgte die Verdrängung durch die Verlagerung des Tabernakels vom Hochaltar in eine Seitenkapelle, ein Seitenschiff oder ganz aus der Kirche hinaus. Der Hochaltar wurde durch die Liturgiereform von 1969 nicht nur seiner Aufgabe entblößt, sondern dadurch auch entleert.
Mit dem Protestantismus hielt erstmals in Straßburg in den 30er Jahren des 16. Jahrhunderts die Umdrehung der Zelebrationsrichtung Einzug. Ein tiefgreifender und radikaler Paradigmenwechsel. Mit der Liturgiereform der 60er Jahre wurde nach 450 Jahren die den Gläubigen zugewandte, protestantische Zelebrationsrichtung von der katholischen Kirche übernommen.
Die Entwicklung geht jedoch weiter. Selbst diese Form gilt in zweierlei Hinsicht als ungenügend. Sie sei zu wenig „demokratisch“, weil noch immer einer, der Priester, vorne stehe. Damit werde die hierarchische Struktur betont, die dem „allgemeinen Priestertum“ widerspreche. Zudem solle die „Handlung“ der Messe, das Mahl als Ausdruck der Gemeinschaft und des Teilens, noch mehr in den Mittelpunkt gerückt werden.
Nachdem die Hochaltäre ihre Funktion verloren haben, aber als „Relikte“ durch eine unverständliche Altardoppelung (Hochaltar, Volksaltar) noch an andere liturgische Zeiten erinnern, werden sie ganz entfernt oder unbrauchbar gemacht. Der Volksaltar wird ganz aus dem Presbyterium, dem Heiligsten der Kirche, hinausverlegt in das dem Volk zugängliche und eigentlich vorbehaltene Kirchenschiff.

Diese „perfekte“ Auflösung wurde soeben in einem Tiroler Bergdorf verwirklicht. Die Neugestaltung der St. Antonius-Kirche in Heinfels (Oberpustertal) aus dem 17. Jahrhundert trägt die Handschrift der zuständigen Gremien des Bistums Innsbruck, zu dem Ort und Kirche seit 1964 gehören.
Ästhetisch wirkt der Eindruck gelungen. Entscheidender ist jedoch die Frage nach der Theologie, die durch die Umgestaltung zum Ausdruck kommen soll.
Die Kirche wurde „revitalisiert“, was konkret bedeutet, daß der alte Hochaltar nur mehr als Tabenakel dient, und die Kirchenbänke kreisförmig um einen Altartisch in der Mitte angeordnet wurden. Gleichviel Gläubige sehen den Priester nun von seitlich vorne, von ganz seitlich oder von seitlich hinten. Niemand steht ihm mehr genau gegenüber, wie es seit der Liturgiereform der Fall war. Die Frage der Ostung, bzw. der Gott zugewandten Zelebration- und Gebetsrichtung, stellt sich in der neuen Anordnung erst gar nicht mehr. Die „Demokratisierung“ erlebte einen deutlichen Schub. Die Gläubigen, welche theologische Bewandtnis es immer damit haben mag, sind nun „ganz nahe“ am Geschehen. Das Presbyterium existiert nicht mehr. Es gibt keinen „heiligen Boden“ mehr, von dem Gott im brennenden Dornbusch zu Moses sprach, und der sich vom Tempel in Jerusalem auf die Kirchen übertragen hatte. Es gibt auch keine Stufen mehr, die zum Altar hinaufführen. Das Introibo ad altare Dei, wie es im Stufengebet des überlieferten Ritus heißt, wird in der neuen Anordnung unmöglich gemacht. Unmöglich machen ist dabei ein wichtiges Stichwort.
Insgesamt drängt sich der Verdacht einer Strömung in diözesanen Bauämtern auf, durch Umgestaltungen die Zelebration im überlieferten Ritus zu behindern, wenn nicht unmöglich zu machen.

Der Altar „steht jetzt in der Mitte des Kirchls“, wie die Kleine Zeitung berichtete. Worin sich welche Form von zentrischer Sichtweise materialisiert hat?
Der zuständige Dekan Anno Schulte-Herbrüggen spricht von einer „stein gewordenen Theologie. Wir haben nun einen Raum, der sammelt“. Die Kleine Zeitung übersetzt seine Worte mit: Der Raum „führe die Menschen zusammen“.
Da wäre sie wieder, die Anthropozentrik: Der Mensch, der sich selbst sein Mittelpunkt ist, nicht der einzelne, aber in der Gemeinschaft. Soll damit gesagt sein, daß eine Messe nur mehr anthropozentrisch, aber nicht mehr theozentrisch denkbar ist? Der in jüngster Zeit so betonte Begriff „Gottesdienst“ wäre dann allerdings wohl auch zu überdenken.
Positiv zu vermerken ist, daß der Hochaltar a.D. samt Tabernakel erhalten geblieben ist, und auch die neuen Kirchenbänke Kniebänke haben. Längst keine Selbstverständlichkeit mehr, wie selbst Kirchenneubauten an internationalen Wallfahrtsorten wie San Giovanni Rotondo, Fatima und Lourdes zeigen.
Das Bauamt des Bistums Innsbruck, das für die Neugestaltung verantwortlich zeichnet, betont, daß das „revitalisierte“ Antoniuskirchl in Osttirol, „die einzige Kirche mit dieser Anordnung“ sei.
Die Kosten für die Umgestaltung belaufen sich auf 330.000 Euro.
Am 3. Juni kam Innsbrucks neuer Bischof Hermann Glettler zur Weihe nach Heinfels.
Zu Bischof Glettler siehe:
- Plastik-Kasel
- Schönborn widerspricht der Glaubenskongregation?
- Homosexuellenpropaganda im Stephansdom
- Neuer Bischof sendet modernistische Signale
- Diözese Graz-Seckau vergibt Predigtpreis – Sieger wurde eine „spirituelle Körperübung zur Dreifaltigkeit“
Text: Martha Burger
Bild: Kleine Zeitung (Screenshot)/Wikicommons