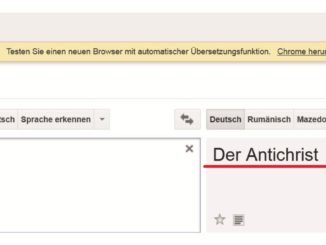(Rom) Die Historikerin Anna Foa, ehemalige Assistenz-Professorin für Geschichte der Neuzeit an der römischen Universität La Sapienza, meldete sich jüngst in den Medien zum Thema Inquisition zu Wort, unter anderem mit dem Aufsatz „Inquisition ohne Monster“ in der Wirtschaftstageszeitung Il Sole 24 Ore. Anlaß war eine Historikertagung zur Öffnung des Vatikanischen Geheimarchivs vor 20 Jahren.
Foa erinnerte daran, daß der neueste Forschungsstand alle „schwarzen Legenden“ zur Heiligen Inquisition widerlegt. Die zahlreichen Anschuldigungen gegen die Inquisition seien zwar in das kollektive Gedächtnis eingegangen, allerdings erst in jüngerer Zeit. Mit der historischen Wirklichkeit hätten sie wenig zu tun.
Bei den Anklagen, die im Zusammenhang mit der Inquisition gegen die Kirche vorgebracht werden, handle es sich um echte „Fake News“. Das kollektive Gedächtnis, das offensichtlich eine sehr klare Vorstellung dessen habe, was die Inquisition war, gehe nicht auf ein direktes Wissen zurück, sondern sei ein antikatholisches Konstrukt, dessen Ursprünge im 18. Jahrhundert zu suchen sind. Viele Seiten haben an dem Zerrbild mitgearbeitet.
Das Problem, so Foa, sei wie bei zahlreichen Fake News, daß falsche Behauptungen „lauter“ sein können als die Wahrheit. Das habe vor allem damit zu tun, wer die Meinungsbildung kontrolliert, aber auch damit, daß manche Fake News geglaubt werden wollen.
„Leidenschaften und Vorurteile“ seien, so Foa bedauernd, „eine Mythen-Fabrik“, die sich selbst zu nähren scheint.
So sei es auch im Zusammenhang mit der Inquisition und der Kirche. Die historischen Fakten seien inzwischen bekannt und erforscht, doch die falschen Stereotype in den Köpfen der Leute seien stärker. Die historische Wirklichkeit sei davon so verschieden, daß sie nicht nur jede Form von Sensationsgier ersticken würde, sondern aus Liebe zur Wahrheit und aus intellektueller Redlichkeit nach einer grundlegenden Revision des bisherigen Geschichtsbildes verlangt.
Es sei angebracht und dringend geboten, so Foa, das Ausmaß der Anklagen gegen die Kirche und ihre Verurteilung zu revidieren. Vor allem aber sei bei der tatsächlichen Rolle der Inquisition zwischen wirklicher und vermeintlicher Verfolgung zu unterscheiden.
Zwischen wissenschaftlicher Gewißheit und „Volksmeinung“ liege beim Thema Inquisition ein gigantischer Abgrund. Internet habe bisher keine Verbesserung der Situation gebracht. Vielmehr werde im weltweiten Netz das verbreitete Zerrbild vielfach weiterverbreitet. Es sei entmutigend, zu sehen, so Foa, wie wahrheitsresistent viele Menschen gegen die in ihren Köpfen eingepflanzte Fake News Inquisition seien. Es erweise sich als sehr schwierig, absolut haltlose, aber verfestigte Vorurteile aufzubrechen. Leider tue sich die Wahrheit schwer, sich einen Weg zu bahnen, während Fake News immer neue und rasche Verbreitung finden.
Anna Foa, promovierte 1968 mit Auszeichnung an der Universität La Sapienza, an der sie später selbst lehrte. Sie ist eine Urenkelin des antizionistischen Oberrabbiners von Turin, Giuseppe Foa (1840–1917) und Tochter eines Gründervaters des demokratischen Nachkriegsitaliens, des linksradikalen, atheistischen Parteivorsitzenden und Parlamentsabgeordneten Vittorio Foa (1910–2008).[1]Der Jurist war während des Faschismus überzeugter Liberaler und wurde deshalb 1936 in Italien zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Sturz Mussolinis 1943 aus der Haft entlassen, schloß er … Continue reading
Seine Tochter Anna Foa fand zu ihrem jüdischen Glauben zurück. Zuletzt war sie Gastprofessorin an der Hebrew University in Jerusalem.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Youtube (Screenshot)
-
| ↑1 | Der Jurist war während des Faschismus überzeugter Liberaler und wurde deshalb 1936 in Italien zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach dem Sturz Mussolinis 1943 aus der Haft entlassen, schloß er sich der Partisanenbewegung an. 1946 wurde er für die Aktionspartei Abgeordneter der verfassungsgebenden Versammlung, dann viele Jahre Fraktionsvorsitzender der Sozialistischen Partei Italiens (PSI) in der Abgeordnetenkammer und Generalsekretär der kommunistisch-sozialistischen Gewerkschaft CGIL. 1964 verließ er den PSI und wurde Gründer und Vorsitzender der linken Abspaltung Sozialistische Partei Italiens der Proletarischen Einheit (PSIUP). 1968 verlor er sein Parlamentsmandat. Er saß im Vorstand der kommunistischen Tageszeitung Il Manifesto und gehörte in den folgenden Jahren einer Reihe sektiererischer, linksextremer und revolutionärer Parteien links von der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) an. 1980 zog er sich kurzzeitig aus der Politik zurück und wurde Professor für Zeitgeschichte an der Universität Modena und der Universität Turin. 1987 wurde er als Unabhängiger auf der Liste des Kommunistischen Partei Italiens (KPI) in den Senat gewählt. 2007 nahm er an der Gründung der linken Demokratischen Partei (PD) teil, die bis vor wenigen Tagen in Italien regierte. |
|---|