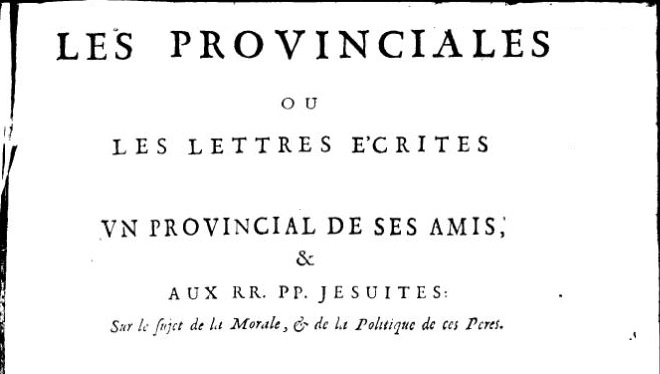
(Rom) Blaise Pascal war ein frommer Katholik, aber auch ein begnadeter Polemiker. Seine Beherrschung der Sprache erlaubte es ihm durch Ironie und Spott, vor allem aber dialektische Wendungen, sein Publikum zu begeistern und seine Gegner alt aussehen zu lassen. Seine Gegner waren die Jesuiten seiner Zeit, denen er Kasuistik vorwarf, durch den sie moralischen Laxismus fördern würden. Seine Freunde waren die strengen Jansenisten.
In der Sache stand Pascal auf der falschen Seite, dennoch findet er bis zum heutigen Tag, nicht ganz unbegründet, auch unter Katholiken begeisterte Leser. Was begeistert, ist nach wie vor und vor allem seine Wortgewalt. Es ist sein uneingeschränkter, verbaler Triumph über seine Gegenspieler, die in den Bann zieht.
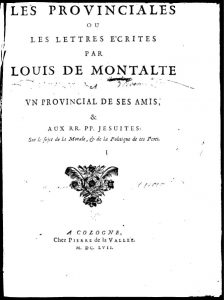
Daß er bis heute in Ehren gehalten und viel zitiert wird, hat aber auch mit seinen Gegnern zu tun. Die Jesuiten hatten seit ihrer Gründung viele Feinde, da sie aufgrund ihrer Disziplin und intellektuellen Prägung von Freund und Feind gefürchtet sind. Nach dem Motto: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, verschaffte das automatisch auch Pascal durch die Jahrhunderte Ansehen, denn Feinde hatten die Jesuiten immer viele: Protestanten, Aufklärer, Freimaurer, Liberale, Sozialisten, Nationalsozialisten.
Wer Pascals Verteidigungsbriefe der Jansenisten gegen die Jesuiten liest (Provinciales, ou Lettres de Louis de Montalte à un provincial de ses amis et aux R. R. PP. Jésuites sur la morale et la politique de ces pères, 1656/1657) kann sich seiner spitzen und bissigen Wortakrobatik kaum entziehen. Die Jesuiten seiner Tage, das war nur hundert Jahre nach der Ordensgründung durch den heiligen Ignatius von Loyola, wirkten finster, geistig windig und wahrheitsfeindlich. Die Wirklichkeit sah etwas anders aus. Pascals Provinzler-Briefe, anonym veröffentlicht, geben nicht wieder, was Pascal vorgibt, darzustellen. Sie sind eine von ihm gewollte, gnadenlose Überzeichnung. Eine Karikatur der Realität. Die Wirklichkeit spiegeln sie nicht wieder, enthalten aber einen wahren Kern.
Die Lektüre seiner Briefe sei ausdrücklich empfohlen. Sie bieten nicht nur billige und köstliche Unterhaltung. Man kann auch viel lernen: Das Spektrum reicht von der Kulturgeschichte bis zur Dialektik.
Papst Franziskus und Pascal
Papst Franziskus ist Jesuit. Er gehört zu jener Gruppe, die unerbittlich den Spott Pascals auf sich zog. Um so interessanter ist eine Bemerkung des Papstes im Vorwort zu einem Buch, das in diesen Tagen in den Buchhandel kam. Derzeit herrscht eine fast frenetische Buchproduktion über, mit und rund um Franziskus. Das im Verlag Rizzoli herausgegebene Buch „Adesso fate le vostre domande“ (Stellt jetzt eure Fragen) enthält acht Interviews des Papstes. Herausgeber ist einer der engsten Papst-Vertrauten: Antonio Spadaro, ebenfalls Jesuit.
Im Vorwort schreibt Franziskus:
„Manchmal habe ich bei meinen Interviewern– auch bei jenen, die sagen, dem Glauben fern zu stehen – eine große Intelligenz und Gelehrsamkeit festgestellt. Und in manchen Fällen sogar die Fähigkeit, sich von jenem Zug des Pascal berühren zu lassen. Das bewegt mich, und ich schätze das sehr.“
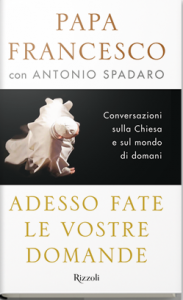
Der Vatikanist Magister schreibt dazu, daß der erste Satz mehr eine Tatsachenfeststellung ist, denn die „zuneigende Wertschätzung“ für Eugenio Scalfari ist offensichtlich. Um diesen Interviewer geht es nämlich.
Scalfari ist älter als Franziskus. Er ist der Gründer der Tageszeitung La Repubblica, der einzigen Zeitung die Franziskus laut eigener Angabe regelmäßig liest. Er ist der Doyen des italienischen Linksjournalismus, bekennender Atheist und entstammt einer freimaurerischen Familie. Nicht ohne stolz zeigt er in seinem Haus die Ahnengalerie derer, vom Vater über den Großvater und weiter zurück, die Logenmitglieder waren. Ob auch er einer Loge angehört, wurde von ihm bisher nicht gesagt, muß aber angenommen werden.
Franziskus und Scalfari treffen sich mindestens ein- bis zweimal im Jahr in Santa Marta. Fast jedesmal wird daraus ein Interview. Zwischendurch telefonieren sie auch gelegentlich miteinander. Daraus macht Scalfari Kolumnen in seiner La Repubblica. Und immer verkündet er der Welt neue Lehren von Papst Franziskus. So atemraubend, unorthodox, ja häretisch diese „Lehren“ auch sein mögen: Ein wirkliches Dementi durch den Vatikan ist bisher nicht erfolgt. Im Gegenteil. Die Interviews wurden zum Teil vom Vatikanverlag in Buchform herausgegeben, vom Osservatore Romano nachgedruckt oder auf der offiziellen Internetseite des Vatikans veröffentlicht. Die Herausgabe durch Spadaro, den Schriftleiter der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica paßt in dieses Bild.
Das revolutionäre Lehramt des Papstsprechers Scalfari
Das päpstliche Lehramt nach Scalfari ist immer revolutionär. Dabei gab er selber bereits in einem Vortrag im November 2013 am Sitz der römischen Auslandspresse zu, daß er bei den Gesprächen ohne Tonband und ohne Notizen arbeitet. Er rekonstruiere nachträglich alles aus seinem Gedächtnis, auch die Worte, die er dem Papst als direkte Rede in den Mund legt. Franziskus scheint es nicht zu stören.
Die jüngste „Verkündigung“ des atheistischen „Papstsprechers“ war, daß Franziskus Hölle und Fegefeuer abgeschafft habe. Die Seele der bösen Menschen, die das Böse nicht bereuen, was sie getan haben, werde sich nach dem Tod in Nichts auflösen. Die ganze kirchliche Lehre vom Gericht wäre damit hinfällig, wie Scalfari zurecht anmerkte.

Interessanter ist, wie Magister bemerkt, der zweite Satz, den Franziskus im Vorwort schreibt, nämlich seine Wertschätzung für einen besonderen „Zug“ von Blaise Pascal, den er in Scalfari zu erkennen glaubt. Die Wertschätzung, die er für Scalfari äußert, gilt noch mehr Pascal. Das erstaunt.
Der Hinweis kommt allerdings nicht genuin vom Papst. Franziskus greift hier ein Stichwort auf, das ihm Scalfari selbst hingeworfen hatte. Im jüngsten Gespräch der beiden, im vergangenen Sommer, war es der Repubblica-Gründer, der Franziskus aufgefordert hatte, den französischen Mathematiker und Philosophen Pascal seligzusprechen. Der Vorschlag aus dem Mund Scalfaris läßt einen klaren Hintergedanken vermuten. Scalfari forderte nämlich gleich im Nachsatz, Franziskus solle die „Exkommunikation“ gegen den jüdischen Philosophen Baruch Spinoza aufheben.
Franziskus legte die Causa Spinoza gleich zur Seite, während er in der Causa Pascal sein Einverständnis erklärte. So zumindest überliefert es Scalfari, und da der Vatikan ihn nicht dementierte, müssen seine Worte ernstgenommen werden.
Wörtlich gibt Scalfari die Reaktion des Papstes so wieder:
„Lieber Freund, in diesem Fall haben sie vollkommen recht: Auch ich denke, daß er die Seligsprechung verdient. Ich behalte mir vor, das nötige Verfahren einzuleiten und zusammen mit meiner persönlichen und positiven Überzeugung die Meinung der für solche Fragen zuständigen vatikanischen Organe einzuholen.“
Pascals Anklage: Kasuisitik und moralischer Laxismus
Es ist an dieser Stelle nicht die giftige Polemik des Pascal, die interessieren sollte, sondern der Kern seines Vorwurfes, der in jedem Fall eine bedenkenswerte Mahnung ist: der Vorwurf der Kasuistik.
Papst Franziskus erwähnte Pascal, nachdem ihm Scalfari den Namen hinwarf. Über die Kasuistik sprach er aber schon mehrfach und immer negativ. Dieser Vorwurf Pascals scheint den Jesuiten noch in den Knochen zu sitzen. Kritiker werfen Franziskus im Zusammenhang mit der Diskussion über die wiederverheirateten Geschiedenen und anderen irregulären Verbindungen aber genau eine Wiederbelebung der Kasuistik vor, wenn auch in einer besonderen Form.
Mit Amoris laetitia untergrabe er ein allgemeingültiges, ausnahmsloses Gebot Jesu Christi, die bedingungslose Unauflöslichkeit einer sakramental gültig geschlossenen Ehe. Eine einzige Ausnahme berge bereits den Keim für weitere Ausnahmen. In jedem Fall hebt bereits eine Ausnahme das uneingeschränkte Gebot auf. Die zweitausendjährige Praxis der Kirche, die nur die lateinische Kirche durchhalten konnte, wird mit Amoris laetitia – laut einer von Papst Franziskus geförderten Interpretation ganzer Bischofskonferenzen und laut seinem eigenen Bistum Rom, also von ihm gewollt – durch eine „Von Fall zu Fall“-Prüfung ersetzt. Damit wird kein präziser Casus geschaffen, wie es Pascal findigen Jesuiten des 17. Jahrhunderts vorwarf, sondern ein Generalkasus. Dem allgemeinen Gebot Christi wird eine ebenso allgemeine Ausnahme gegenübergestellt, ohne ins Detail zu gehen. Spitz formuliert, könnte von einer „Metakasuistik“ die Rede sein.
Die Anklage der strengen, calvinistisch geprägten Jansenisten gegen die Jesuiten lautete, daß sie durch eine Kasuistik moralischen Laxismus fördern würden. Die Förderung des moralischen Laxismus durch Amoris laetitia wird heute dem Papst vorgeworfen – und der ist Jesuit. Und er scheint sogar Blaise Pascal „umarmen“ zu wollen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Rizzoli (Screenshot)




