
(Rom) Der am Mittwoch der Vorwoche verstorbene Kardinal Carlo Caffarra fühlte sich überwacht und war überzeugt, daß seine Korrespondenz abgefangen und mitgelesen wurde. Dies berichtet der spanische Journalist Gabriel Ariza von InfoVaticana.
Am 27. Oktober 2015 wurde der Kardinal, der 20 Jahre das Erzbistum Bologna geleitet hatte, von Papst Franziskus aus Altersgründen emeritiert. Dem argentinischen Papst wurde nachgesagt, eine gewisse Sympathie für den geradlinigen Kardinal aus dem italienischen Norden empfunden zu haben, der im selben, kleinen Dorf bei Parma das Licht der Welt erblickt hatte wie Giuseppe Verdi. Das mag vielleicht Grund dafür gewesen sein, weshalb der streitbare Kardinal nicht bereits mit 75, sondern erst mit 77 Jahren sein Amt niederlegen mußte. Denn was unter Benedikt XVI., zumindest für Metropoliten, als selbstverständlich galt , ist unter Franziskus zum Privileg geworden.

Mit der Emeritierung hatte der Kardinal die erzbischöfliche Residenz geräumt, um seinem Nachfolger, Msgr. Matteo Maria Zuppi, Platz zu machen. Zuppi wurde inzwischen von Franziskus zum Kardinal kreiert, was eine noch größere Sympathiebekundung ist, da sich der amtierende Papst nicht an die Regel hält, laut der bestimmte Bischofssitze mit der Kardinalswürde verbunden sind. Die Gegensätze zwischen Kardinal Caffarra und Kardinal Zuppi, einem Mitglied der Gemeinschaft von Sant’Egidio, waren zahlreich und spiegeln die Unterschiede des derzeitigen Pontifikats gegenüber den Vorgängerpontifikaten von Benedikt XVI. und Johannes Paul II. wider.
Kardinal Caffarra zog in eine kleine Wohnung ins erzbischöfliche Priesterseminar. Von dort aus versuchte er nach Kräften, einer Entwicklung in der Kirche entgegenzuwirken, die er für falsch und gefährlich erkannte. Er bekräftigte mit intelligenten und mit hintersinniger Ironie gespickten Worten die Unvereinbarkeit bestimmter moderner Haltungen und Positionen mit der Katholizität, die von einem Teil der sogenannten „Bergoglianer“ gerade mehr oder wenig verhüllt für kompatibel erklärt wird.
Im Widerstand gegen eine neue Praxis in der Frage der Zulassung wiederverheirateter Geschiedener zu den Sakramenten, die zwangsläufig – darin war sich Kardinal Caffarra sicher – eine neue Lehre bedeutet, gewann er an internationaler Statur und Bedeutung für die Weltkirche. Und tatsächlich ist ein Erzbischof für sein Bistum zuständig, ein Kardinal aber als Berater des Papstes für die ganze Kirche. Eine Aufgabe, die Caffarra ernstnahm und prompt bei Papst Franziskus auf taube Ohren stieß. Dieser gab keine Antwort auf die vom Kardinal im September 2016 mitunterzeichneten Dubia zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia, keine Antwort auf die im April 2017 vorgebrachte Bitte, in Audienz empfangen zu werden, um die damit verbundenen Sorgen vorbringen zu können, und würdigte den Kardinal keines Wortes, als dieser Anfang April beim Papstbesuch in Carpi seines Ranges wegen beim Mittagessen neben Franziskus saß. Eine Kälte, die es nicht nur an Bereitschaft und Fähigkeit zum Zuhören und zum vielgepriesenen Dialog vermissen ließ, sondern mehr noch an Brüderlichkeit.
Kardinal Caffarra litt darunter, als „Feind des Papstes“ bezichtigt zu werden
Kardinal Caffarra hat unter dieser persönlichen Behandlung, mehr noch aber unter der Entwicklung in der Kirche in seinen letzten Lebensmonaten sehr gelitten, wie Ariza bestätigt. Besonders geschmerzt haben ihn die Beleidigungen durch andere Kirchenvertreter, Kleriker wie Laien, die seine Fragen und Argumente ignorierten, ihn aber polemisch bezichtigten, ein „Feind des Papstes“ zu sein.
Vor wenigen Monaten hatte Ariza die Gelegenheit, Kardinal Caffarra in Bologna zu besuchen. Die Dubia (Zweifel) waren bereits veröffentlicht, und zahlreiche Heckenschützen griffen ihn als „Gegner“ des Papstes an. Ariza zitierte den Kardinal mit den Worten:
„Ich hätte es vorgezogen, daß sie mich beschuldigen, einen homosexuellen Liebhaber zu haben, als mich als Feind des Papstes zu brandmarken.“
Besorgt über das Verständnis des Papsttums
Ariza über seinen Besuch in Bologna:
„Ich muß gestehen, daß mich die Einfachheit tief bewegt hat, in der der Kardinal lebte. Caffarra belegte eine kleine Wohnung in einem der Gebäude des Seminars von Bologna. Eine Wohnung, die eine ordentliche Renovierung gebraucht hätte. Die Tapeten an den Wänden hatten Löcher, die Stromkabel hingen frei im Raum und die Heizung war mangelhaft. In Bologna, einer Stadt, in der es kalt sein kann, verbrachte Caffarra seine Stunden inmitten von Büchern, Briefen und Dokumenten, und er reagierte auf jeden Brief und jede E‑Mail, die er aus der ganzen Welt erhielt.“
Eine Sache, die den Kardinal besonders besorgte, war das Verständnis, das manche vom Papsttum haben, so Ariza. Um seine Sorge zu verdeutlichen, gab Caffarra einige Hinweise. Als Pius XII. die Disziplin der eucharistischen Nüchternheit ändern wollte, bat er eine Theologenkommission nicht, diese Frage zu studieren, sondern zu prüfen, ob er überhaupt berechtigt war, eine solche Änderung durchzuführen. Bis zu Paul VI. schwörten die Kardinäle, immer die Wahrheit zu sagen „und nicht, was der Papst hören will“. Seit der Montini-Reform schwören die Kardinäle, den Papst bis zum Blutvergießen zu verteidigen. Zu diesem Punkt empfahl der Kardinal, „einen großen Intellektuellen zu lesen: Josef Seifert“.
„In jedem Fall hat die Eile überrascht, mit der Kardinal Caffarra begraben wurde“
Der Kardinal vertraute seinem Gesprächspartner aber auch an, sich überwacht zu fühlen und überzeugt zu sein, daß seine Kommunikation abgefangen werde. Kardinal Caffarra war kein ängstlicher Mann. Er besaß aber offenbar konkrete Hinweise und Informationen. „Er sagte mir, zu wissen, daß die vier Kardinäle, die die Dubia verfaßt haben, beobachtet werden, daß auf ihre Kommunikation zugegriffen wird, und sie kaum mehr tun können, als sicherere Kommunikationsformen zu suchen.“
Das „ist weder um etwas Neues noch eine seltsame Verschwörungstheorie“, so Ariza. „Wie einer der renommiertesten Vatikanisten, Edward Pentin, in einem Artikel für den National Catholic Register am Beginn des Vatileaks-Skandals schrieb, sind Abhöraktionen an der vatikanischen Kurie sehr verbreitet.“
„Ich selbst habe miterlebt, wie ein Motorradfahrer die Haustür eines bedeutenden Kardinals beobachtete und notierte, wann er Besuch erhielt und wie lange der Besuch geblieben ist. In jedem Fall hat die Eile überrascht, mit der nach seinem Tod das Begräbnis von Kardinal Caffarra durchgeführt wurde“, so Ariza.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: InfoVaticana




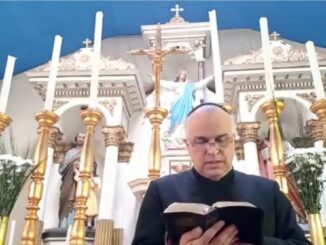
Mich erinnert der plötzliche Tod katholischer und ob ihres klaren Bekenntnisses ungeliebter Kirchenfürsten an den Tod des lächelnden Papstes Johannes Paul I. Er starb vollkommen unwerwartet. Es wird geschrieben er habe „die Nachfolge Christi“ von Thomas a Kemptis noch in der Hand gehabt. Der große und kämpferische Erzbischof Dyba starb mir 60 Jahren ganz plötzlich bei bis dahinn bester Gesundheit, Am Tage vorher grüßte er noch die Besucher auf dem Fuldaer Domplatz. Kardinal Meisner etwas altersschwach geworden starb trotzdem plötzlich und unerwartet mit dem Brevier auf dem Schoss. Kardinal Caffara starb plötzlich und unerwartet. Alle haten Vieles gemeinsam: Sie waren Kämpfer für Gott, tief überzeugt. Bei keinem der Toten wurde die Ursache des Todes mit wissenschaftlichen Mitteln untersucht bzw. wie bei Papst Johannes Paul wurde eine notwendige Untersuchung erkennbar verhindert. Alle waren, ob ihres klaren Bekenntnisses ungeliebt. Das von Caffara beschriebene Gefühl, unter Beobachtung zu stehen, passt ins Bild.
Seitdem ich von der Überwachung der Kurienkardinäle im Vatikan gelesen habe, halte ich auch die „Beseitigung“ der Gegner von Papst Franziskus für möglich. Es ist doch auffallend, dass erst Kardinal Pell entfernt wurde wegen vermeintlichen Missbrauchs (oder so ähnlich), dann wurde Kardinal Müller entfernt, dann starb überraschend Kardinal Meisner und nun auch Kardinal Caffarra. Wenn bei Kardinal Caffarra 3 Tage nach dem Tod bereits das Begräbnis ist, dann stimmt da etwas nicht.
Das ist doch das jahrhundertelang erprobte und praktizierte Prozedere, dass die Gegner der Jesuiten jeweils vergiftet werden.
Ich erinnere nur an Kardinal Gustav Adolf von Hohenlohe Schillingsfürst, der stets befürchtete von den Jesuiten vergiftet zu werden und selbst die eucharistischen Gaben vorkosten liess.
Der erste Papst, den die Jesuiten vergiftet haben, war Sixtus V, weil er ihnen den Namen entziehen wollte.
Er meinte, wir seien alle Jünger Jesu und da könne es nicht sein, dass ein Orden exclusiv den Namen Jesu für sich beanspruche. Das war sein Todesurteil.
Genauso äusserte Papst Klemens XIV bei der Unterzeichnung des Aufhebungsdekrets den Jesuitenorden betreffend (in dem die zahllosen Verbrechen der Jesuiten benannt werden): „Hiermit besiegele ich mein baldiges Ableben“
Ein Jahr später war er tot, vergiftet mit einem Gift, dass die Jesuiten von den Indios in Südamerika erhalten hatten.
Die Jesuiten sind Königs- Fürsten und Papstmörder.
Es scheint, dass die Katholiken nur durch völlige Vernichtung der Kirche vom Jesuitismus befreit werden können, genauso wie die Deutschen nur durch die völlige Vernichtung Deutschlands vom Nazismus befreit werden konnten.
@Horst
Das ist alles ein geradezu pathologischer Unsinn. Der letzte Satz dieser unglaublichen Einlassung enthüllt vollends deren irren Charakter.
„Pathologisch“ ist es, wenn man sein Handeln nicht von der Vernunft, sondern von Emotionen, Neigungen, Trieben, Instinkten und Affekten leiten lässt.
Es wäre nicht der erste Mord am Stuhle Petri und um den Stuhl Petri herum in der Kirchengeschichte. Es tobt ein nahezu endzeitlicher Kampf zwischen 2000-jähriger Verkündigungslehre des Christentums und der „New World Order“, der alle und alles unterworfen werden soll. S.E. Kardinal Burke gut daran, soviel Zeit wie nur möglich in seiner Heimat unter dem Schutz eines US-Präsidenten, der sich klar für christliche Werte und gegen die NWO stellt, zu verbringen. Im Vatikan ist der hochwürdigste Kardinal Burke nur bedingt sicher. Wenn man die Methoden von Geheimdiensten beachtet, ist nichts einfacher, als unliebsame Personen zu „liquidieren“, ganz unauffällig. Wir müssen genauso mutig im Großen und im Kleinen versuchen, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen und wir müssen den Hl. Geist bitten, alle mit Wahrheit zu erleuchten. Qui ut Deus?- Hl. Erzengel Michael streite für uns für die Kirche unseres Herrn und alle Kräfte guten Willens (seien sie nun Katholiken, Christen oder Menschen, deren guter Wille vom Hl. Geist gesegnet ist).
Woran ist er dann gestorben? Weshalb sagt man das nicht? Deshalb kommen dann natuerlich Verschwoerungstheorien!
Der Artikel ist doch auch ziemlich fehlerhaft. Zum einen hat Kardinal Caffarra das Erzbistum Bologna „erst“ 2004 übernommen (Ende 2003 ernannt), zum anderen ist sein Nachfolger Monsignore Zuppi nach wie vor kein Kardinal!
Wenn ein in der öffentlichen Welt bekannter Mensch, der bis jetzt vollkommen gesund war, plötzlich stirbt, gibt man im allgemeinen die Todesursache an.
Allerdings, was wäre gewonnen, würde offiziell verlautet werden, dass Kardinal Caffarra ‑z.B.- an Herzversagen gestorben sei?
Dies müsste ja nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen, denn man kann Gründe ja auch vorschieben.
Allein schon die Tatsache, dass von Kommentatoren etwas „Nachhilfe“ nicht vollkommen ausgeschlossen wird ‑auch wenn dies unter Verschwörungstheorie läuft- zeigt doch, wie sehr inzwischen das Ansehen der Kirche in Rom gelitten hat.
Aber möglicherweise ist Kardinal Caffarra wie auch Kardinal Meisner in Wahrheit an „gebrochenem Herzen“ gestorben.
Wer von uns weiß schon, wie niedergeschlagen sie gewesen sein mögen.
so kann es sein! Aber auch bei einem „nachgeholfenem“ Tod ist letztlich Herzversagen eine (korrekte) Todesursache…
Wir sollten froh sein, nicht alles zu wissen, was da so passiert – die Wahrheit ist nicht vollständig zu vertuschen. Ein jeder wird sich – so oder so – verantworten müssen! Und ich denke, dass der manchmal als plötzlich empfundene Tod der „Getreuen“ diese durchaus davor bewahrt, zu irdischer Lebenszeit eine Wahrheit über die Kirche zu erfahren (oder weiter ertragen zu müssen), die so unglaublich erscheint, dass man sie nicht für wahr halten möchte.
Bevor auch hier die Spekulationen über den für uns Außenstehende überraschenden Tod des Kardinals allzu wüst ins Kraut schießen, möchte ich auf den in der katholischen TAGESPOST v. 09.09.2017 als Nachruf erschienenen Artikel des Rom-Korrespondenten Guido Horst mit dem Titel „Der Ehebandsverteidiger“ hinweisen.
Darin zitiert G. Horst Walter Kardinal Brandmüller, der bzgl. des Verstorbenen u.a. von einer vorhergehenden schweren Erkrankung spricht…
Diese Situation ist doch verheerend: „Ich werde überwacht. Meine Korrespondenz wird abgefangen“