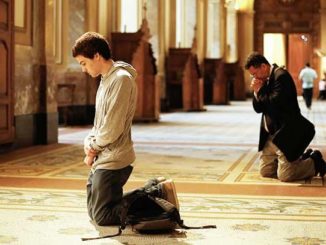(Rom/Stuttgart) Das nachsynodale Schreiben Amoris laetitia von Papst Franziskus bewegt die Gemüter. Die katholische Kirche wirkt unruhiger denn je. In einem Interview mit CNA, nahm der bekannte deutsche Philosoph Robert Spaemann dazu Stellung und konstatiert einen „Bruch mit der Lehrtradition“. Das „Chaos“ sei „mit einem Federstrich zum Prinzip erhoben“ worden. Das Interview führte Anian Christoph Wimmer.
„Folgerungen, die mit der Lehre der Kirche nicht kompatibel gemacht werden können“
Spaemann stellte im CNA-Interview fest, daß Amoris laetitia „Folgerungen zulässt, die mit der Lehre der Kirche nicht kompatibel gemacht werden können“. Der Artikel 305 mit der Anmerkung 351, wonach Gläubige „mitten in einer objektiven Situation der Sünde“, dennoch „auf Grund mildernder Faktoren“ zu den Sakramenten zugelassen werden können, „widerspricht direkt dem Artikel 84 des Schreibens Familiaris Consortio von Johannes Paul II.“, so Spaemann.
Der deutsche Philosoph widerspricht der Behauptung von Kardinal Walter Kasper, eine Änderung der Praxis der Sakramentenspendung sei lediglich eine „Weiterentwicklung von Familiaris Consortio“. „Die Kirche hat“, so Spaemann, „keine Vollmacht, ohne vorherige Umkehr, ungeordnete sexuelle Beziehungen durch die Spendung von Sakramenten positiv zu sanktionieren und damit der Barmherzigkeit Gottes vorzugreifen. Ganz gleich wie diese Situationen menschlich und moralisch zu beurteilen sind. Die Tür ist hier „” wie beim Frauenpriestertum „” verschlossen.“
Gott kenne den Menschen besser „als dieser sich selbst kennt“. Das christliche Leben sei „aber nicht eine pädagogische Veranstaltung bei der man sich auf die Ehe als einem Ideal zubewegt, wie das Amoris Laetitia an vielen Stellen nahezulegen scheint.“ Der ganze Bereich der Beziehungen, „insbesondere der Sexualität betrifft die Würde des Menschen, seine Personalität und Freiheit. Er hat etwas mit dem Leib als einem „Tempel Gottes“ zu tun (1 Kor 6,19). Jede Verletzung dieses Bereichs, mag sie noch so oft vorkommen, ist daher auch eine Verletzung der Beziehung zu Gott, zu der die Christen sich berufen wissen, eine Sünde gegen seine Heiligkeit, und bedarf immer wieder der Reinigung und Umkehr.“
„Kirche hat nicht die Vollmacht bestehende Grenzen zu überschreiten und der Barmherzigkeit Gottes Gewalt anzutun“
Gottes Barmherzigkeit bestehe gerade darin, „diese Umkehr immer neu zu ermöglichen. Natürlich ist sie nicht an bestimmte Grenzen gebunden, aber die Kirche ihrerseits ist der Verkündigung der Umkehr verpflichtet und hat nicht die Vollmacht durch die Spendung von Sakramenten bestehende Grenzen zu überschreiten und der Barmherzigkeit Gottes Gewalt anzutun. Das wäre vermessen. Klerikern, die sich an die bestehende Ordnung halten, verurteilen deshalb niemanden, sondern berücksichtigen und verkünden diese Grenze zur Heiligkeit Gottes.“
Spaemann wollte in Amoris laetitia angedeutet Unterstellungen gegen Priester, sie würden „sich hinter der Lehre der Kirche verstecken“ und „sich auf den Stuhl des Moses setzen“, um „Felsblöcke … auf das Leben von Menschen“ zu werfen (Artikel 305), „nicht kommentieren“. Er fügte jedoch hinzu, daß dabei „missverständlich auf die entsprechenden Stelle des Evangeliums angespielt wird.“
„Es gibt hier nur eine klare Ja-Nein-Entscheidung, Kommunion geben oder nicht geben“
Entgegen dem Wunsch von Papst Franziskus, sei die Konzentration auf umstrittene Textstellen „völlig berechtigt“. „Man kann bei einem päpstlichen Lehrschreiben nicht erwarten, dass sich die Menschen an einem schönen Text erfreuen und über entscheidende Sätze, die die Lehre der Kirche verändern, hinwegsehen. Es gibt hier tatsächlich nur eine klare Ja-Nein-Entscheidung. Kommunion geben oder nicht geben, dazwischen gibt es kein Mittleres“, so Spaemann.
Ihm falle es „schwer zu verstehen“, was Papst Franziskus mit der mehrfach in Amoris laetitia genannten Aussage meine, daß „niemand auf ewig verurteilt werden“ dürfe. „Dass die Kirche niemanden persönlich verurteilen darf, schon gar nicht ewig, was sie ja Gott sei Dank auch gar nicht kann, ist ja klar. Wenn es aber um sexuelle Verhältnisse geht, die objektiv der christlichen Lebensordnung widersprechen, so würde ich gerne vom Papst wissen, nach welcher Zeit und unter welchen Umständen sich eine objektiv sündhafte, in eine gottgefällige Verhaltensweise verwandelt. Dass es sich um einen Bruch handelt ergibt sich zweifellos für jeden denkenden Menschen, der die entsprechenden Texte kennt.“
Spaemann unterzieht auch die Hintergründe, die zu Amoris laetitia geführt haben, einer kritische Analyse:
„Dass Franziskus seinem Vorgänger Johannes Paul II. mit kritischer Distanz gegenübersteht, zeichnete sich schon ab, als er ihn zusammen mit Johannes XXIII. heiliggesprochen hat, für den er eigens das, für Heiligsprechungen erforderliche, zweite Wunder fallenließ. Dies wurde von vielen zurecht als manipulativ empfunden. Es hatte den Anschein, als wollte der Papst die Bedeutung von Johannes Paul II. relativieren.“
„Reine Situationsethik – bei Jesuiten schon im 17. Jahrhundert zu finden“
Das „eigentliche Problem aber“ sei eine „seit vielen Jahren, schon bei den Jesuiten im 17. Jahrhundert zu findende, einflussreiche Strömung in der Moraltheologie, die eine reine Situationsethik vertritt“, so Spaemann.
Papst Franziskus habe hingegen auch mit der Enzyklika Veritatis Splendor von Johannes Paul II. gebrochen: „Die vom Papst in Amoris Laetitia angeführten Zitate von Thomas von Aquin scheinen diese Richtung zu stützen. Hier wird aber übersehen, dass Thomas objektiv sündhafte Handlungen kennt, für die es keine situativen Ausnahmen gibt. Zu ihnen gehören auch alle sexuell ungeordneten Verhaltensweisen. Wie zuvor schon Karl Rahner in den 1950-iger Jahren in einem Aufsatz, der alle wesentlichen, noch heute gültigen Argumente enthält, hat Johannes Paul II. die Situationsethik abgelehnt und in seiner Enzyklika Veritatis Splendor verurteilt. Auch mit diesem Lehrschreiben bricht Amoris Laetitia. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass es Johannes Paul II. war, der sein Pontifikat unter das Thema der göttlichen Barmherzigkeit gestellt hat, ihr seine zweite Enzyklika widmete, in Krakau das Tagebuch der Schwester Faustyna entdeckte und sie später heiligsprach. Er ist ihr authentischer Interpret.“
Die „Folgen“ von Amoris laetitia seien „jetzt schon abzusehen: „Verunsicherung und Verwirrung von den Bischofskonferenzen bis zum kleinen Pfarrer im Urwald. Vor wenigen Tagen drückte mir gegenüber ein Priester aus dem Kongo seine Ratlosigkeit angesichts dieses Lehrschreibens und des Fehlens klarer Vorgaben aus. Nach den entsprechenden Textstellen von Amoris Laetitia können bei nicht weiter definierten „mildernden Umständen“ nicht nur die Wiederverheiratet Geschiedenen, sondern alle, die in irgendeiner „irregulären Situation“ leben, ohne das Bemühen ihre sexuellen Verhaltensweisen hinter sich zu lassen, das heißt ohne Beichte und Umkehr, zur Beichte andrer Sünden und zur Kommunion zugelassen werden.“
„Das Chaos wurde mit einem Federstrich zum Prinzip erhoben.“
Jeder Priester, der sich die bisher geltende Sakramentenordnung halte, „kann von Gläubigen gemobbt und von seinem Bischof unter Druck gesetzt werden. Rom kann nun die Vorgabe machen, dass nur noch ‚barmherzige‘ Bischöfe ernannt werden, die bereit sind, die bestehende Ordnung aufzuweichen. Das Chaos wurde mit einem Federstrich zum Prinzip erhoben.“
Der Papst hätte „wissen sollen, dass er mit einem solchen Schritt die Kirche spaltet und in Richtung eines Schismas führt. Ein Schisma, das nicht an der Peripherie sondern im Herzen der Kirche angesiedelt wäre. Gott möge das verhüten“, so Spaemann.
„Anliegen, daß Kirche Selbstbezogenheit überwinden soll, ist durch Amoris Laetitia auf unabsehbare Zeit zunichte gemacht worden“
„Eines scheint mir jedoch sicher: Das Anliegen dieses Pontifikats, dass die Kirche ihre Selbstbezogenheit überwinden soll, um freien Herzens auf die Menschen zugehen zu können, ist durch dieses Lehrschreiben auf unabsehbare Zeit zunichte gemacht worden.“ Es werde, so Spaemnann, zu einem weiteren Säkularisierungsschub und Rückgang der Priesterzahlen kommen. „Es ist ja schon seit längerem zu beobachten, dass Bischöfe und Diözesen mit eindeutiger Haltung in Sachen Glaube und Moral den größten Priesternachwuchs haben.“ Man werde an die Worte des heiligen Paulus im Korintherbrief erinnert „wenn die Trompete keinen deutlichen Klang gibt, wer wird dann zu den Waffen (des Heiligen Geistes) greifen?“ (1 Kor. 14,8).
„Jeder einzelne Kardinal, Bischof und Priester ist aufgefordert, die Sakramentenordnung aufrecht zu erhalten“
Auf die Frage, wie es denn nun weitergehen solle, sagte Spaemann: „Jeder einzelne Kardinal, aber auch jeder Bischof und Priester ist aufgefordert, in seinem Zuständigkeitsbereich die katholische Sakramentenordnung aufrecht zu erhalten und sich öffentlich zu ihr zu bekennen. Falls der Papst nicht dazu breit ist, Korrekturen vorzunehmen, bleibt es einem späteren Pontifikat vorbehalten, die Dinge offiziell wieder ins Lot zu bringen.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: CNA (Screenshot)