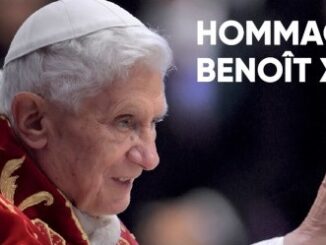(Vatikan/Assisi) Benedikt XVI. ermahnte die italienischen Bischöfe, die heilige Liturgie zu respektieren und sich dabei ein Beispiel am heiligen Franz von Assisi zu nehmen. Dieser habe nämlich wirklich verstanden, was eine wahre Liturgiereform ist, schrieb Papst Benedikt XVI. in einer Botschaft an die in der Herbstvollversammlung tagenden Italienischen Bischofskonferenz. Eine Botschaft, die „einer strengen Zurechtweisung des italienischen Episkopats gleichkommt, in dem die Gegner Benedikts XVI. in liturgischen Fragen nach wie vor in der Mehrheit sind“, wie der Vatikanist Sandro Magister kommentierte.
Sowohl Johannes Paul II. als auch Benedikt XVI. haben bei verschiedenen Gelegenheiten die Kirche in Italien anderen Ländern als „Vorbild“ genannt. „Es gibt allerdings einen Bereich, in dem die italienische Kirche nicht glänzt“, so Magister. Jenem der Liturgie.
Italien in Sachen Liturgie kein Vorbild
Wer es noch nicht gewußt haben sollte, wurde durch die strenge Lectio, die der Papst den vom 8.–11. November in Assisi versammelten Bischöfen hielt, eines besseren belehrt. Im Mittelpunkt der Herbstversammlung stand die neue italienische Übersetzung des Missale Romanum. Anlaß für das Kirchenoberhaupt, klare Worte zu finden. Es ist nach dem Schreiben an die Bischöfe des deutschen Sprachraums zum pro multis – für alle/für viele bereits das zweite Schreiben des Papstes an einen bestimmten Sprachraum, das sich gleichzeitig jedoch an den Weltepiskopat richtet.
In seiner Botschaft an die Bischöfe beschränkte sich der Papst nicht nur auf Grüße und Glückwünsche, sondern kam gleich zur Sache. „Er verdeutlichte den Bischöfen die Kriterien für eine wirkliche Liturgiereform“, so Magister.
Wirkliche Reformatoren sind Bewahrer der Liturgie
„Jeder wirkliche Erneuerer ist dem Glauben gehorsam: er handelt weder willkürlich noch maßt er sich im Ritus irgendeinen Ermessenspielraum an; er ist nicht Herr, sondern Bewahrer des vom Herrn eingesetzten und uns anvertrauten Schatzes. Die gesamte Kirche ist in jeder Liturgie gegenwärtig: an ihrer Form teilzunehmen ist Voraussetzung für die Authentizität dessen, was man zelebriert.“
Um keinen Spielraum für Mißverständnisse zu lassen, nannte der Papst die Liturgiereform des IV. Laterankonzils von 1215 als Beispiel. Dieses Konzil gab den Priestern das Brevier mit dem Stundengebet in die Hand und stärkte den Glauben in die Realpräsenz Christi in den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein.
Es war die Zeit des heiligen Franziskus und der heiligen Klara. Benedikt XVI. verwendete einen Großteil seiner Botschaft an die Bischöfe, um ihnen den Geist des großen Heiligen von Assisi darzulegen, mit dem dieser der liturgischen Vertiefung des damaligen Konzils folgte und auch seine Brüder zum Gehorsam anhielt.
Franz von Assisi Vorbild liturgischer Treue statt kreativer Gestaltungsfreiheit
Franz von Assisi ist einer der volkstümlichsten und weltweit am meisten verehrten und bewunderten Gestalten der Kirche. Er ist ein Vorbild für jene Katholiken, die eine mehr spirituelle und „prophetische“ Kirche wollen, statt einer institutionellen und rituellen. Im Bereich der Liturgie reklamieren nicht wenige von jenen, die sich auf den Heiligen aus Umbrien berufen, mehr Kreativität und Gestaltungsfreiheit in der Liturgie.
Ein grober Irrtum, teils eine sträfliche Entstellung, wie Papst Benedikt XVI. aufzeigte. Der wirkliche Franz von Assisi hatte eine ganz andere Ausrichtung. Er war vor allem treu und gehorsam. Er, der nie Priester wurde, hatte größte Hochachtung vor jedem Priester, selbst den unwürdigsten. Er war zutiefst davon überzeugt, so Benedikt XVI., daß der christliche Kult mit der vom Herrn empfangenen Glaubensregel übereinstimmen muß und dadurch der Kirche Gestalt gibt. Die Priester, an erster Stelle sie, müssen die Heiligkeit ihres Lebens auf die Heiligkeit der Liturgie gründen.
Der Widerstand im eigenen Haus
Das Vorbild des heiligen Franziskus konnte nicht treffender mit dem Tagungsort der Bischofskonferenz zusammenfallen. Bischof von Assisi ist seit 2005 Msgr. Domenico Sorrentino, ein Liturgiker, allerdings nicht auf der Linie des Papstes. 2003 war Msgr. Sorrentino in der letzten Phase des Pontifikats von Johannes Paul II. zur Nummer zwei der Gottesdienstkongregation ernannt worden. Als Benedikt XVI. den Stuhl Petri bestieg, ersetzte er ihn sofort durch den heutigen Erzbischof von Colombo, Malcolm Kardinal Ranjith, ein liturgisch gesehen ganz anderes Kaliber. Die Entfernung Sorrentinos erfolgte nach kircheninterner Praxis mittels Wegbeförderung, im konkreten Fall eben nach Assisi.
Vor Msgr. Sorrentino war Msgr. Francesco Pio Tamburrino Sekretär der Gottesdienstkongregation gewesen, ein Benediktinermönch, der sich ebenfalls in Opposition zur Linie des damaligen Präfekten der Kongregation befand, Jorge Arturo Kardinal Medina Estevez, der wiederum Kardinal Ratzinger nahestand. Auch Tamburrino wurde aus seinem Amt entfernt und als Bischof nach Foggia befördert.
Sorrentino und Tamburrino heute, Lercaro und Bugnini damals
Sorrentino und Tamburrino lenken seither die Liturgiekommission der italienischen Bischofskonferenz. In der Kommission saß bis zu seiner vor kurzem erfolgten Emeritierung auch Msgr. Luca Brandolini, der ehemalige Bischof von Sora. Jener Brandolini, der 2007 eine Art von „Protesttrauer“ ausgerufen hatte, als Papst Benedikt XVI. das Motu proprio Summorum Pontificum erließ. Der Widerstand gegen die vom Papst angestrebte liturgische Erneuerung ist stark und bestimmt je nach Aufwallung unter der Oberfläche deren Rhythmus und Tempo mit. Da für Benedikt XVI. die Liturgie das Herz der Kirche ist, besonders schutzbedürftig und exponiert zugleich, das Scharnier zwischen der diesseitigen und jenseitigen Welt, die Pforte die beide Welten real verbindet, muß ganz sorgsam und vorsichtig damit umgegangen werden. Respekt und Ehrfurcht, die ihr zu schulden sind, betreffen jedwede sie betreffende Entscheidung.
Bei der Bestellung der Liturgiekommission gaben die italienischen Bischöfe seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil jenen Mitbrüdern den Vorzug, die den Baumeistern der nachkonziliaren Liturgiereform anhingen, vor allem Giacomo Kardinal Lercaro, dem damaligen progressiven Erzbischof von Bologna, und natürlich Msgr. Annibale Bugnini, Architekt und Umsetzer der Liturgiereform.
Paul VI. erkannte, wenn auch spät den Mißbrauch, dem er die Tore geöffnet hatte
Gegen die negativen Folgen jener nachkonziliaren Reform greift Benedikt XVI. ein. Bereits Papst Paul VI., ohne dessen Zustimmung die Liturgie nicht umgebaut werden hätte können, erkannte in den späteren Jahren seines Pontifikats den Mißbrauch, der dadurch Einzug in die Kirche hielt. Er war darüber so betroffen, daß er Msgr. Bugnini 1975 aus seinem Amt entfernte und als Apostolischen Nuntius nach Persien schickte.
Nach wie vor ist die Mehrheit des italienischen Episkopats und des Klerus von der Bugnini-Richtung beeinflußt. In Italien sind zwar schwerwiegende liturgische Mißbrauchsfälle selten, wie sie in anderen europäischen Ländern bekannt werden und im deutschen Sprachraum in manchen Pfarreien zum Standardrepertoire gehören. „Der in den Zelebrationen vorherrschende Stil ist jedoch mehr der einer Versammlung als die „Hinwendung zum Herrn“, wie Papst Benedikt XVI. es einfordert. „Diese Verzerrung spiegelt sich auch in der Architektur der Kirchenneubauten wider“, so Magister.
Liturgische Verzerrungen an Kirchenneubauten ablesbar
Die italienische Bischofskonferenz stellt einen Sonderfall unter allen Bischofskonferenzen dar. Sie hat einen direkten Draht zum Heiligen Stuhl, da der Papst als Bischof von Rom offiziell sogar Vorsitzender der Konferenz ist. Konkret bedeutet das, daß der tatsächliche Vorsitzende der italienischen Bischofskonferenz nicht gewählt, sondern vom Papst als sein Stellvertreter ernannt wird.
Der derzeitige Vorsitzende der Konferenz, der Erzbischof von Genua, Angelo Kardinal Bagnasco griff in seiner ersten Ansprache auf der Herbstvollversammlung die Intention des Papstes auf, indem er über den Primat Gottes sprach, der im Vorrang der Liturgie zum Ausdruck komme.
Französische Bischöfe zelebrieren in päpstlicher Basilika ad altarem Dei
In diesem Zusammenhang sei noch erwähnt, daß Frankreichs Bischöfe, die sich in Gruppen bis zum 22. November zum Ad-Limina-Besuch in Rom aufhielten, am 19. November in der päpstlichen Basilika Santa Maria Maggiore die Heilige Messe ad orientem zelebrierten. Unter ihnen waren die Bischöfe von Paris, Straßburg, Metz, Reims, Lille und Besancon.
Text: Settimo Cielo/Giuseppe Nardi
Bild: Riposte Catholique