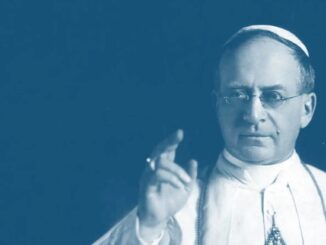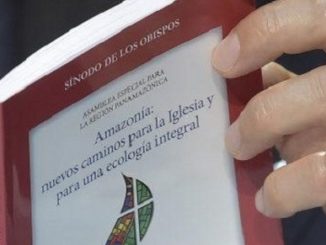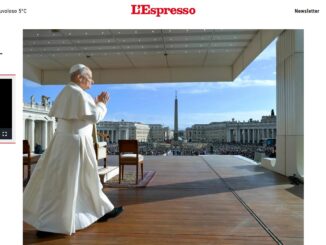Von Roberto de Mattei*
Ein weitverbreitetes Klischee besagt, daß eine globale Erderwärmung die Menschheit bedrohe und der Mensch selbst der Hauptverursacher dieser Entwicklung sei. Der durch menschliches Handeln verursachte Klimawandel – insbesondere durch die Nutzung fossiler Brennstoffe, Abholzung und intensive Landwirtschaft – habe einen kritischen Punkt erreicht, der eine akute Bedrohung für Umwelt, Gesundheit, wirtschaftliche Stabilität und den Weltfrieden darstelle. Um dieser Notlage zu begegnen, seien weitreichende Maßnahmen in verschiedenen Bereichen wie Energie, Verkehr, Industrie und Landwirtschaft notwendig. Die Europäische Union faßt diese Maßnahmen unter dem Begriff der „grünen Transformation“ oder „Green Deal“ zusammen.
Zunächst sei gesagt: Die These von der Klimaerwärmung ist stark übertrieben. In einem Artikel in der Zeitung Libero vom 6. Juli führt Antonio Socci eine Reihe wissenschaftlicher Daten an, die zeigen, daß heutzutage mehr Menschen an Kälte sterben als an Hitze. Statistiken zufolge übersteigen Todesfälle durch Kälte die durch Hitze sogar im Verhältnis 9 zu 1, und die steigenden Temperaturen führen aktuell sogar zu einem Rückgang der Gesamtsterblichkeit. Der Agrarmeteorologe Luigi Mariani belegt anhand einer Reihe aktueller Studien, daß weltweit zwischen 2000 und 2019 rund 91 Prozent der durch extreme Temperaturen verursachten Todesfälle auf Kälte zurückzuführen waren, nur 9 Prozent auf Hitze. Diese Schlußfolgerung ist nicht neu: Bereits vor zehn Jahren veröffentlichte die angesehene Fachzeitschrift The Lancet eine internationale Studie, die auf der Analyse von 74 Millionen Todesfällen in zwölf verschiedenen Ländern beruhte und zu denselben Ergebnissen kam. Wenn die Medien ausschließlich und mit großer Dramatik von Hitzetoten berichten, verzerren sie die Wirklichkeit.
Aber selbst wenn man das Vorhandensein eines Klimawandels voraussetzt: Ist dieser natürlichen Ursprungs oder vom Menschen verursacht? Und wenn letzteres zutrifft, in welchem Sinne?
Klimawandel hat es schon immer gegeben. So war das Klima im Hochmittelalter mild – wie auch die Sitten jener Zeit. Im Spätmittelalter, ab dem 14. Jahrhundert, mit dem Übergang zur Neuzeit, kam es jedoch zu einer deutlichen Abkühlung. Die Gletscher in den Alpen und in den Polarregionen breiteten sich aus, was unter anderem dazu führte, daß der Weinanbau in England und anderen Gegenden verschwand. Die Gletscher rückten nach Süden vor, die Niederschlagsmenge nahm zu – mit der Folge von Erdrutschen, Überschwemmungen und Fluten. Dies verringerte die landwirtschaftlich nutzbare Fläche und führte zu einer Reihe von Hungersnöten. Die dadurch verursachte Unterernährung schwächte die europäische Bevölkerung und machte sie anfälliger für Krankheiten wie die Pest, die Mitte des 14. Jahrhunderts etwa ein Drittel der Bevölkerung hinwegraffte. Die Historiker Ruggero Romano und Alberto Tenenti haben den zyklischen Zusammenhang zwischen Hungersnöten und Epidemien dokumentiert, der das 14. Jahrhundert prägte (s. Alle origini del mondo moderno 1350–1550, Feltrinelli, Mailand 1967).
Diese Katastrophen waren nicht menschengemacht, sondern natürlichen Ursprungs. Doch daß Gott, der Herr über die Natur, sie zugelassen hatte, wurde als Strafe für die Sünden der Menschen interpretiert – in diesem Sinne galten sie als mitverantwortlich für die Naturkatastrophen. Es handelte sich nicht um das Ende der Welt, sondern um das Ende einer Epoche. Und stets in der Geschichte sind mit dem Abfall der Völker von Gott Naturkatastrophen einhergegangen – wie am Ende des christlichen Mittelalters. Und es scheint, als wiederhole sich dies heute.
Der moderne Mensch hat im Geist des Prometheus versucht, die Gesetze der Natur zu verändern. Doch in seinem Aufbegehren gegen die göttliche und natürliche Ordnung des Universums kann er nur scheitern. Die Moderne wollte die Anbetung Gottes durch die Anbetung des Menschen ersetzen. Angesichts des Scheiterns dieses Projekts tritt in der postmodernen Ideologie an die Stelle der Menschenverehrung die Naturverehrung – das ist die sogenannte „grüne Ideologie“ in ihrer radikalsten Form. Der „Planet Erde“ ist mehr als eine Heimat – er wird zur irdischen Religion.
Diese Ideologie ist unter dem Pontifikat von Papst Franziskus auch in die Kirche eingedrungen und fand ihren symbolischen Ausdruck in der Aufstellung der Pachamama – angeblich die Mutter Erde der indigenen Völker Amerikas – in den Vatikanischen Gärten am 4. Oktober 2019, am Vorabend der Amazonassynode.
Ist der neue Papst Leo XIV ein Anhänger dieser Ideologie? Wir wollen das nicht glauben. Am 9. Juli 2025 wurde in den Gärten des „Borgo Laudato sì“ in Castel Gandolfo eine Messe zur „Bewahrung der Schöpfung“ gefeiert. Der Papst beendete seine Predigt mit einem Zitat aus den Confessiones des heiligen Augustinus, in dem die Schöpfung und der Mensch gemeinsam den Schöpfer loben: „Deine Werke loben dich, damit wir dich lieben, und wir lieben dich, damit deine Werke dich loben“ (Confessiones, XIII, 33, 48). Leo XIV fügte hinzu: „Dies sei die Harmonie, die wir in die Welt hinaustragen.“
Die Harmonie, von der Papst und Kirchenvater sprechen, steht im Widerspruch zur Ideologie des radikalen Ökologismus. Die rechte Vernunft und die göttliche Offenbarung lehren uns, daß der Mensch – nach dem Bilde Gottes erschaffen – an der Spitze der hierarchischen Ordnung der Schöpfung steht. Die Natur ist ein Mittel, das Gott dem Menschen gegeben hat, um sein übernatürliches Ziel zu erreichen. Ein scharfsinniger Theologe des 20. Jahrhunderts, Monsignore Pier Carlo Landucci, erinnert daran:
„Die Welt ist das Haus des Menschen, geschenkt vom Schöpfer des Menschen. Also nicht der Mensch für das Haus, sondern das Haus für den Menschen – der aber aus Achtung gegenüber dem göttlichen Geber und in seinem eigenen Interesse verpflichtet ist, dessen Werte zu bewahren und zu verteidigen: Das ist die ‚Ökologie‘ in ihrem rationalen und moralischen Fundament.“ (Istinto e intelligenza negli animali? in: Palestra del Clero, Nr. 14, 15. Juli 1985, S. 14).
Der Mensch muß die Natur und ihre Gesetze respektieren – nicht nur die physikalisch-chemischen, sondern auch die religiösen und moralischen. Nicht nur der einzelne Mensch, auch ganze Völker sind zur Beachtung dieser Gesetze verpflichtet. Wenn der Mensch sich von Gott abwendet oder gegen ihn rebelliert, wendet sich auch die Natur vom Menschen ab oder rebelliert gegen ihn. Das war in allen Zeiten spiritueller und moralischer Krisen der Fall – und es scheint auch heute so zu sein, angesichts des Klimachaos, das uns heimsucht und sich womöglich in plötzlichen Naturstrafgerichten äußern wird.
„Doch“, so sagte der Papst in Castel Gandolfo, „im Herzen des Heiligen Jahres bekennen wir – und wir können es immer wieder sagen: Es gibt Hoffnung! Wir haben sie in Jesus gefunden. Er stillt auch heute noch den Sturm. Seine Macht verwirrt nicht, sondern erschafft; sie zerstört nicht, sondern bringt ins Dasein, schenkt neues Leben. Und auch wir fragen: ‚Wer ist dieser, daß ihm sogar Wind und Meer gehorchen?‘“ (Mt 8,27).
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana