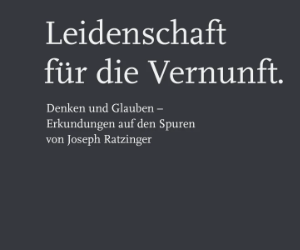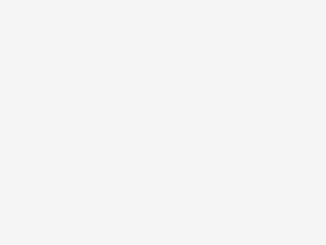Daß der Bekanntheitsgrad finnischer Werke und Literaten in Deutschland außerhalb von Fachkreisen und Kennern als begrenzt gelten darf, ist wohl wenig umstritten. Ein Roman aus Finnland ist für den deutschen Leser grundsätzlich eine exotische Rarität. Ein Werk aus dem Zweiten Weltkrieg umso mehr, auch wenn Viljo Sarajas „Waffenbrüder“ seinerzeit als beste Wirklichkeitsdarstellung aus dem finnisch-russischen Winterkrieg von 1939/1940 ausgezeichnet wurde. Große Bekanntheit erlangte es außerhalb Skandinaviens nie. Umso erfreulicher ist es, daß der Jungeuropa Verlag dieses Buch verlegt hat und damit dem deutschsprachigen Raum eine einzigartige Kriegsschilderung bietet.
Das Werk des sonst wenig bekannten oder anderweitig erfolgreichen Autors ist dementsprechend als Zeugnis seiner Zeit zu betrachten, aus einem fremden Teil Europas, einer fremden, vergangenen Zeit. Wie die meisten finnischen Werke zum Winterkrieg schildert es die Kriegserfahrung finnischer Soldaten, die sich der geballten sowjetischen Kampfstärke gegenübersahen und einer quasi hoffnungslosen Aufgabe stellten. Einem Feind, der materiell in jeglicher Hinsicht weitaus überlegen vor den Toren stand und alles zu nehmen drohte. Der sowjetische Angriff erfolgte nicht gänzlich aus heiterem Himmel, ihm gingen mehrere Provokationen und Eskalationen voraus, nicht zuletzt die Annexion des naheliegenden Baltikums und war letztendlich ein zu erwartender Schlag im imperialen Bestreben der Sowjetunion. Finnland selbst war bis zum Ende des Ersten Weltkrieges Teil des russischen Zarenreiches und als Nation in seiner Staatlichkeit noch sehr jung, militärisch zu diesem Zeitpunkt völlig unterentwickelt. Die sowjetische Offensive war demnach der Versuch, das dem Zarenreich nach der Niederlage im Ersten Weltkrieg gegen das Deutsche Kaiserreich abtrünnig gewordene Finnland dem russisch dominierten Staat wieder einzuverleiben. Für die Finnen handelte es sich um eine existenzielle Frage, Freiheit oder Knechtschaft. In diesem Winter 1939 findet die Erzählung statt.
Diese unverhoffte David-gegen-Goliath-Ausgangslage ist dem Erzähler in jeder Passage vor Augen. Der Krieg ist neu, unbekannt, ereignisreich, kein vertrautes Unterfangen. Es gibt kein großes Ziel, außer das Standhalten. Was den militärisch unerfahrenen Finnen stärkt, ist die moralische Gewissheit, als Verteidiger der Heimat im Recht zu sein. Patriotische Lobgesänge auf das finnische Volk und das finnische Land durchziehen das Werk. Stets wird sichtbar gehalten, wofür die Männer sich in den scheinbar sicheren Tod werfen. Der pathetische Einschlag ist an mehreren Stellen zu erwarten, vermeidet jedoch das Abrutschen ins Kitschige. Der Stil ist der Handlung angemessen und für jeden Leser leicht zugänglich. Der Leser wird unmittelbar in die Situation eines jungen finnischen Mannes versetzt, der seine Heimat und Familie liebt und diese nun mit der Waffe zu verteidigen gezwungen ist. Man findet dabei jedoch kein ausuferndes Lamentieren und keine pazifistischen Untertöne, kein peinliches Appellieren an die universale Menschlichkeit, wie man es aus kontemporärer Kriegsliteratur mittlerweile gewohnt ist. Vielmehr wird der Krieg, gerade dieser Krieg, als eine Notwendigkeit empfunden, um die Gemeinschaft, die Heimat und ihre Freiheit, das Eigene zu erhalten. Es ist die Notwendigkeit, keine Lust am Krieg als Abenteuer oder Schauspiel, aber auch keine Tragödie, vor der nur die Flucht retten kann. Es ist ernst. Es geht den Soldaten um ihr Vaterland. Denn des „Vaterlandes Not ist unser aller Not, und sein Schicksal ist auch unseres“.
Die Erzählung folgt einem klassischen Muster, bei der der Erzähler in seinen Kriegserfahrungen von getreuen Kameraden durch verschiedene Tragödien und kleine Momente begleitet wird, die jeweils ihre charakteristischen Merkmale besitzen und der Handlung mehr Facetten schenken. Diese Gemeinschaft Finnlands Söhne ist zugleich mit christlich-religiösen Motiven durchtränkt und stellt über gemeinsam abgehaltene Gottesdienste ein wesentliches Bindeglied dar, als Verkörperung auch der kirchlichen Gemeinschaft der Gläubigen, wenn es da heißt: „niemand unter uns ist ja einsam, ganz allein gewesen. Ein jeder hat den Höchsten in sich getragen“.
Krieg als gerechter Krieg, vor allem zur Verteidigung, ist der Kirche und den Vätern wie Thomas von Aquin, ein legitimes Mittel. Die Idee der Gemeinschaft der Gläubigen und Heiligen als Soldaten und Krieger ist dem Christentum ebenfalls nicht fremd, findet sich sowohl in theologischen Schriften als auch der Heiligen Schrift selbst wieder. Und natürlich sind zahlreiche Heilige, die als Märtyrer im Kampf um ihre Heimat gegen heidnische Invasoren starben, selbst Soldaten gewesen. Da wäre zum Beispiel Andreas Stratelates, syrischer Feldherr des Römischen Reiches, der sein Heimatland gegen die Heere persischer Heiden verteidigte. Sicherlich ein weniger bekannter Name mit einer umfangreichen Geschichte, vermutlich vergleichbar mit der Exotik des russisch-finnischen Winterkrieges. Nicht zuletzt wäre da auch eine Jeanne d’Arc, die uns als mittel-westeuropäische Leser selbst heute noch als französische Nationalheldin geläufig ist. Und auch einer der Gründungsmythen der deutschen Nation, die Schlacht auf dem Lechfeld, dessen Sieger, Otto der Große, den heiligen Michael zum Schutzpatron der Deutschen erklärte, erzählt von der Verteidigung christlicher Heere gegen einfallende magyarische Heiden. So stehen in „Waffenbrüder“ christliche Finnen den gottlosen Bolschewiken gegenüber, auch wenn der ideologische bzw. ein religiöser Konflikt als solcher nicht im Vordergrund der Geschichte steht. Doch der Bezug zu Gott und der eigenen, christlich geprägten Kultur zeichnet die Wahrnehmung der finnischen Truppen.
In den pazifizierten Kirchen Westeuropas ist ein militantes, national gefärbtes Christentum dieser Art freilich längst nicht mehr existent. Gemäß hier vorherrschender progressiver Geschichtsdeutung zählen die Kreuzzüge und konfessionelle Auseinandersetzungen zu einer überwundenen, archaischen Epoche der Kirchengeschichte, als die Kirche noch die primitiven Bräuche und Traditionen der europäischen Barbaren kaschierte, ehe es sich im Zuge der Moderne zum zahnlosen Wohlfühlkult emanzipierte, der nach Meinung vor allem protestantischer Theologen der ursprüngliche Kern der Lehre Christi sei. Und in Zeiten, in denen selbst biblische Gebote offenkundig verdreht werden – man denke an die kürzlich erfolgten „Homophobie ist Sünde“-Aktionen evangelischer Kirchen in Deutschland im Zuge des sogenannten pride-Monats – ist von der Wiederkehr einer abendländischen Christenheit keinerlei Vorstellung möglich, nur wenige lebende Restbestände in den kleinen Inseln der traditionsverbundenen katholischen Gotteshäuser und vor allem der orthodoxen Kirche, welche sich offen dem westlichen Regenprogressismus in den Weg stellt, existieren noch.
Und so ist die Erzählung eines sich gegen eine Übermacht behauptenden europäischen, christlichen Volkes, das in der Verteidigung seines Landes ein Recht, eine heilige Aufgabe sieht, dem heutigen durchschnittlichen Leser sicherlich etwas Anachronistisches. Der dementsprechend pathosgeladene Stil des Autors wirkt an einigen Stellen gleichermaßen etwas befremdlich, kann einem konservativ gesinnten Leser allerdings großes Wohlbefinden vermitteln. Nichtdestrotz spiegelt es den historischen Umstand und das Geschilderte sowie die Ernsthaftigkeit in der Erfahrung des Erzählers wider. Gegen die feindliche „Masse“ ist Wehr zu leisten, denn „sie hat das gekränkt, was uns heilig ist, sie ist eingedrungen, zu verheeren, was unser ist“. Das Vaterland ist hier noch heilig, etwas, das nicht zur Debatte steht und mit allen Mitteln, auch dem eigenen Leben, verteidigt wird, für das ein Märtyrer zu werden sich lohnt. Auch dies bedarf keinem ausgewogenen inneren Dialog über Zweifel und Sinnhaftigkeit, es steht wie selbstverständlich; „was bedeuten schon die toten Leiber, die Seelen können sie uns doch nicht nehmen. Und ist wohl mein Leben mehr wert als das andere?“
Die Überschneidung von Gemeinschaftsgefühl und religiösem Ethos ist dem Autor vermutlich nicht gänzlich unbewusst gelungen. Der originale Titel des Buches würde nach korrekter Übersetzung ins Deutsche eigentlich „Das erlöste Land“ heißen. Man entschied sich bei der deutschen Titelwahl jedoch dafür, die Betonung auf die Waffenbrüderlichkeit der Figuren zu legen und weniger auf die religiös aufgeladenen Elemente der Erzählung. Dies erscheint naheliegend, ist es doch in erster Linie eine Kriegserzählung und Finnland als lutherische Nation mit einer allgemein eher kühl anmutenden Mentalität nicht sonderlich mit mythisch-religiöser Thematik in Verbindung zu bringen. Auch ist der finnisch-russische Winterkrieg nicht in erster Linie als religiös-ideologischer Konflikt in den Geschichtsbüchern vermerkt. Doch der Krieg als religiöse Erfahrung bzw. mit Sendungsfunktion, gerade für die Nationenbildung, ist in der Literatur seit der Romantik freilich ein geläufiges Motiv. Und Turnvater Jahn sollte wohl – zumindest in diesem Fall – Recht behalten, wenn er einst formulierte: „Die künftige Zeit wird Kriege um Völkerscheiden erleben, aber es werden heilige Kriege sein.“
Und auch wenn die Kriege des 20. Jahrhunderts, die riesigen Materialschlachten, keine sonderlich heiligen Kriege waren, schafft es Saraja den Verteidigungskampf der Finnen als solchen zu schildern. Die Sakralität dieses Krieges, der Verteidigung, wird in den Feldgottesdiensten besonders greifbar. Wie zu früheren Zeiten europäischer Christenheit gilt die Messe den Soldaten, dabei selbstredend auch den Gefallenen, Gott und der Heimat. Wirkmächtig heißt es, es sei eine „mächtige Messe, die da aufsteigt aus der Männerbrust und diesen ernsten Herzen. Da draußen begleitet der Donner der Kanonen den männlichen Gesang, der gleichsam die Wände des Unterstandes tiefer in die Erde hineindrückt. Der Wein schwappt aus dem Becher. So also zittert Christi Blut durch diesen Lärm“. Die Figuren ziehen Kraft aus dem Gottesdienst, aus den Worten der Schrift, welche der Erzähler reflektiert und sie auf seine erlebte Situation bezieht. Ihrem Leid, ihrem Erfolg ist mit diesen christlichen Elementen eine Note verliehen, die den Mythos des Winterkrieges nicht bloß als nationalen Kraftaufwand der Finnen, sondern eine heilige Mission hervorhebt. Heilige Kriege sind nicht bloß in der Literatur unserer Zeit eine Seltenheit geworden. Dennoch schafft es Saraja, die Gefühlslage und Lebensrealität finnischer Soldaten christlichen Glaubens, und zwar eines gelebten christlichen Glaubens, in einem Weltkrieg, der ideologischer und geopolitischer Logik folgte, lebhaft zu machen. Gerade für Christen ist dieses Buch daher eine wohltuende Rarität und es sei allen, die sich in eine vergangene Zeit noch gelebten Ernstes und Glaubens sehnen, ans Herz gelegt.
- Viljo Sarajas: Waffenbrüder, Roman, Jungeuropa Verlag, Dresden 2021, 164 Seiten, 15,00 €