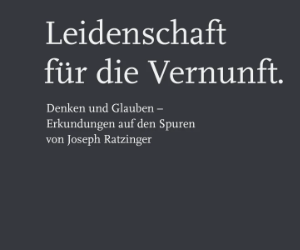(Rom) Je näher die Amazonassynode mit ihrem Angriff auf das Weihesakrament und mit ihrer Ökobefreiungstheologie rückt, desto deutlicher wird, daß das „Epizentrum“ der bevorstehenden Schlacht in Deutschland liegt und, daß dabei „sehr viel“, so der Vatikanist Sandro Magister, auf dem Spiel steht, nämlich das Wesen der Sendung Jesu Christi und damit auch der Kirche.
Magister verortet die Köpfe der gegensätzlichen Verbände jeweils im deutschen Sprachraum. Zu Recht. Auf der Seite der Ökobefreiungstheologen stehen der deutschstämmige Kardinal Claudio Hummes und der österreichische Missionsbischof Erwin Kräutler. Die Kritiker der von Papst Franziskus approbierten Synodenausrichtung werden von Kardinal Gerhard Müller und Kardinal Walter Brandmüller angeführt, die in den vergangenen Wochen massive Kritik am Instrumentum laboris der Synode übten.
Magister verweist noch auf einen weiteren „großen Deutschen“, der in dem Konflikt Partei ergreift, nämlich Joseph Ratzinger.
„Er schweigt, aber es genügt, was er in der Vergangenheit gesagt und getan hat, auch als Papst mit dem Namen Benedikt XVI., um ihn auf der Seite der radikalsten Kritiker zu sehen.“
Der Hauptstreitpunkt, um den es bei der Amazonassynode gehe, sei der Vorrang, der im Instrumentum laboris, das die Grundlage der Synodenarbeit bilden wird, der Verteidigung der Natur und dem materiellen Wohl der Amazonasbewohner mit ihren Traditionen eingeräumt wird gegenüber dem, was die Evangelien „Sündenvergebung“ nennen, die in der Taufe ihr erstes Sakrament hat.
„Es ist kein Zufall“, so Magister, „daß Bischof Kräutler sich nach Jahrzehnten als ‚Missionar‘ im Amazonas damit brüstete: ‚Ich habe nie einen Indio getauft und werde es auch in Zukunft nicht tun.“
Joseph Ratzinger, so Magister weiter, habe mehrfach zu dieser kapitalen Frage Stellung genommen. Es gibt eine außergewöhnlich allgemeinverständliche und klare Stelle im Band über die Kindheitsgeschichten seines dreibändigen Werkes Jesus von Nazareth, der 2012 veröffentlicht wurde.
Zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen nimmt Benedikt XVI. darin die Verkündigung des Engels an Josef über die schwangere Maria:
„Sie wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen“ (Mt 1,21).
Was Benedikt XVI. dazu schreibt, sind „erleuchtete Worte, die mit Blick auf den Streit über das Amazonas-Tiefland noch einmal gelesen werden sollten“.
Erlösung ja, aber wovon?
Von Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.
Auf die Mitteilung von der Empfängnis des Kindes durch die Kraft des Heiligen Geistes folgt nun ein Auftrag an Josef: „Maria wird einen Sohn gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen“ (Mt 1,21). Josef erhält zusammen mit der Aufforderung, Maria als Frau zu sich zu nehmen, den Auftrag, dem Kind einen Namen zu geben und es so rechtlich als sein Kind anzunehmen. Es ist der gleiche Name, den der Engel auch Maria als Namen des Kindes angeben hatte: Jesus. Der Name Jesus (Jeshua) bedeutet: JHWH ist Heil. Der Gottesbote, der im Traum mit Josef spricht, verdeutlicht, worin dieses Heil besteht: „Er rettet sein Volk von seinen Sünden.“
Damit ist einerseits ein hoher theologischer Auftrag erteilt, denn nur Gott selbst kann Sünden vergeben. So wird dieses Kind in unmittelbaren Zusammenhang zu Gott gerückt, direkt mit Gottes heiliger und rettender Macht verbunden. Andererseits könnte aber diese Definition der Sendung des Messias auch als enttäuschend erscheinen. Die geläufige Heilserwartung richtet sich vor allem auf die konkreten Bedrängnisse Israels – auf die Wiederherstellung des davidischen Königtums, auf die Freiheit und Unabhängigkeit Israels und damit natürlich auch auf das materielle Wohlergehen eines weitgehend verarmten Volkes. Die Verheißung der Sündenvergebung erscheint als zu wenig und zu viel zugleich: zu viel, weil in Gottes eigene Vorbehaltssphäre eingegriffen wird; zu wenig, weil an das konkrete Leiden Israels und an seine reale Heilsbedürftigkeit nicht gedacht zu sein scheint.
Im Grunde ist so schon in diesem Wort der ganze Streit um die Messianität Jesu vorweggenommen: Hat er nun Israel erlöst, oder ist nicht alles gleich geblieben? Ist die Sendung, wie er sie gelegt hat, die Antwort auf die Verheißung, oder ist sie es nicht? Sicher entspricht sie nicht der unmittelbaren Erwartung des messianischen Heils der Menschen, die nicht so sehr von ihren Sünden, sondern vielmehr von ihren Leiden, von ihrer Unfreiheit, von der Armseligkeit ihres Daseins sich bedrängt fühlten.
Jesus selbst hat die Frage nach der Priorität in der Erlösungsbedürftigkeit des Menschen drastisch in den Raum gestellt, als die vier Männer den Gelähmten, den sie der Menschenmenge wegen nicht durch die Tür tragen konnten, vom Dach herunterließen und Jesus zu Füßen legten. Die Existenz des Leidenden als solche war eine Bitte, ein Ruf nach Heil, den Jesus völlig gegen die Erwartung der Träger und des Kranken selbst mit dem Wort beantwortete: „Kind, deine Sünden sind dir vergeben“ (Mk 2,5). Genau das hatten die Menschen nicht erwartet. Genau darum war es ihnen nicht gegangen. Der Gelähmte sollte gehen können, nicht von den Sünden befreit werden. Die Schriftgelehrten kritisierten die theologische Anmaßung von Jesu Wort; der Leidende und die Menschen rundherum waren enttäuscht, weil Jesus die eigentliche Not dieses Menschen zu übersehen schien.
Ich halte die ganze Szene für durchaus bezeichnend im Hinblick auf die Frage nach der Sendung Jesu, wie sie zuallererst im Engelswort an Josef umschrieben wird. Hier wird sowohl die Kritik der Schriftgelehrten wie die stille Erwartung der Menschen aufgenommen. Dass Jesus Sünden vergeben kann, zeigt er nun dadurch, dass er dem Kranken befiehlt, seine Bahre aufzuheben, um geheilt wegzugehen. Aber dabei bleibt die Priorität der Sündenvergebung als Grundlage aller wahren Heiligung des Menschen unberührt.
Der Mensch ist ein Wesen in Beziehungen. Und wenn die erste, die grundlegende Beziehung des Menschen gestört ist – die Beziehung zu Gott –, dann kann nichts Weiteres mehr wirklich in Ordnung sein. Um diese Priorität geht es in Jesu Botschaft und Wirken: Er will den Menschen zuallererst auf den Kern seines Unheils hinweisen und ihm zeigen: Wenn du da nicht geheilt wirst, dann wirst du trotz aller guten Dinge, die du findest, nicht wirklich geheilt.
Joseph Ratzinger / Benedikt XVI.: Jesus von Nazareth. Bd. 3: Prolog. Die Kindheitsgeschichten, Freiburg 2012, S. 51ff
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Diakonos (Screenshot)