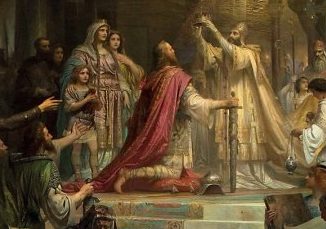Von Roberto de Mattei*
Im Dezember 1918 feierte Europa die erste Friedensweihnacht nach vier Jahren des ununterbrochenen Blutvergießens. Die Welt war aber nicht mehr jene von vorher. Am 3. November hatte Österreich-Ungarn in der Villa Giusti in Padua mit den alliierten Mächten einen Waffenstillstand unterzeichnet.
Am 7. November stellten die deutschen Sozialisten dem Reichskanzler Max von Baden ein Ultimatum. Für Freitag, den 8. November zur Mittagsstunde, verlangten sie die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. Der Großherzog von Baden meldete seinem Souverän, der sich im Hauptquartier der Obersten Heeresleitung im belgischen Spa aufhielt, daß auf die Armee nicht mehr sicherer Verlaß sei und dem Land ein Bürgerkrieg drohe. Bis zum Morgen jenes Tages war der Kaiser entschlossen, die Ordnung im Land wiederherzustellen und an der Spitze seiner Truppen die Revolution zu bändigen.
In der Nacht vom 8. auf den 9. November überstürzten sich aber die Ereignisse. Die in Spa versammelten, militärischen und zivilen Berater des Kaisers drängten diesen zur Abdankung und zum Gang ins Exil in die Niederlande. Am 9. November erklärte Wilhelm, als deutscher Kaiser, aber nicht als König von Preußen abdanken zu wollen. Dem Chef des Generalstabes, Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg, übertrug er das militärische Oberkommando und beauftragte ihn mit den Waffenstillstandsverhandlungen. Die Abdankung wurde jedoch ohne sein Wissen sofort bekanntgegeben, und damit vollendete Tatsachen geschaffen. Noch am selben Tag verließ der Kaiser das Deutsche Reich und sollte nie mehr zurückkehren.
Am 8. November sprach sich die Führung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Österreichs öffentlich für eine „demokratische und sozialistische Republik Deutschösterreich“ aus. Um Mitternacht berief Kaiser Karl I. zwei seiner engsten Vertrauten, Graf Hunyadi und Privatsekretär Werkmann, in sein Arbeitszimmer auf Schloß Schönbrunn und erklärte ihnen völlig ruhig:
„Auch Österreich wird nach dem Beispiel der deutschen Revolution zusammenbrechen. Sie werden die Republik ausrufen, und es wird niemand mehr zur Verteidigung der Monarchie geben… Ich will nicht abdanken und nicht aus dem Land flüchten…“
Es folgten hektische Momente, in denen jeder im kaiserlichen Gefolge unterschiedliche Vorschläge und Empfehlungen vorbrachte, um der dramatischen Situation zu begegnen. Admiral Nikolaus Horthy, der letzte Kommandant der k. u. k. Kriegsmarine, war von der Adria nach Wien gekommen, um die Übergabe der Flotte an die Kroaten zu besprechen. Er ging vor dem Kaiser in Habtachtstellung und leistete einen Schwur, ohne daß jemand einen solchen von ihm verlangt hätte:
„Ich werde nicht ruhen, bis ich Eure Majestät wieder auf den Thron von Wien und Budapest setze“.
Drei Jahre später sollte derselbe Horthy als Reichsverweser des Königreiches Ungarn am Stadtrand von Budapest die Waffen gegen seinen Monarchen richten und ihn sogar verhaften und deportieren lassen, um die Macht in Ungarn zu behalten.
Um 11 Uhr des 11. November meldeten sich in Schloß Schönbrunn der letzte, formal noch amtierende, kaiserliche Ministerpräsident Heinrich Lammasch und Innenminister Edmund von Gayer. Sie brachten den Text für die Abdankung von Kaiser Karl mit, der von den politischen Vertretern des alten und des neuen Regimes vereinbart worden war.
Das Dokument war vom Fürsterzbischof von Wien, Friedrich Gustav Kardinal Piffl, gutgeheißen worden, der genau eine Woche vorher, am 4. November, das Namensfest des Kaisers im Stephansdom mit einer feierlichen Heiligen Messe zelebriert hatte. Einer seiner Priester, Prälat Ignaz Seipel, in der Regierung Lammasch Minister für öffentliche Aufgaben, hatte die Kompromißformel gefunden, mit der der Kaiser auf jeden Anteil an den Regierungsgeschäften verzichtete, ohne das Wort „Abdankung“ zu verwenden.
Sollte der Kaiser nicht unterschreiben, so Gayer, „werden wir noch heute nachmittag die Arbeitermassen vor Schönbrunn sehen… dann werden die wenigen, die sich weigern werden, Eure Majestät im Stich zu lassen, ihr Leben verlieren, und zusammen mit ihnen werden auch Eure Majestät und die kaiserliche Familie getötet werden“.
Die Minister verlangten, daß die Unterschrift sofort geleistet werde, ohne eine Bedenkzeit. Der Kaiser zögerte. Er war ein Mann von großem, edlem Charakter, besaß aber nicht die Energie seiner Frau Zita, die in diesem Moment allein, mit all ihren Kräften protestierte und sich mit diesen Worten an Karl wandte: „Abdanken… niemals! in Herrscher kann seine Herrscherrechte verlieren. Das ist dann Gewalt, die eine Anerkennung ausschließt. Abdanken nie – lieber falle ich hier an Ort und Stelle mit dir – dann wird eben Otto kommen und selbst, wenn wir alle fallen sollten – noch gibt es andere Habsburger.“
Um Mitternacht des 11. November 1918 unterzeichnete der Kaiser die Verzichtserklärung, mit der er im voraus die Entscheidungen anerkannte, die Deutschösterreich bezüglich seiner künftigen Verfassung treffen werde.
Am Nachmittag verabschiedeten sich der Kaiser und seine Familie, nachdem sie in der kaiserlichen Kapelle gebetet hatten, von den letzten Würdenträgern und begaben sich zu den Automobilen, die sie zum Jagdschloß Eckartsau in Niederösterreich brachten. Kaiserin Zita erinnerte sich an die jungen Kadetten der Militärakademie, die zum Abschied Spalier standen. Sie waren 16 und 17 Jahre alt, „mit leuchtenden Augen“ und dem Kaiser treu bis zum Letzten, würdig ihrem Motto, das ihnen Maria Theresia verliehen hatte: „Allzeit getreu“.
Am 12. November wurde in Wien offiziell die Republik ausgerufen. Am Tag zuvor war in einem Eisenbahnwaggon in den Wäldern bei Compiègne der Waffenstillstand zwischen dem Deutschen Reich und den Alliierten unterzeichnet worden. Damit war das militärische Ende des Ersten Weltkrieges besiegelt worden.
Am 4. Dezember 1918 stach im Hafen von New York die „George Washington“ in See mit Fahrtrichtung Frankreich. An Bord befanden sich US-Präsident Woodrow Wilson und die amerikanische Delegation für die Friedenskonferenz. Wilson hatte unter Bruch des Völkerrechts persönlich die provisorischen, sozialistischen Regierungen in Österreich und im Deutschen Reich gedrängt, den Wechsel der Staatsform durchzusetzen.
Am 14. Dezember traf der amerikanische Präsident in Paris den französischen Ministerpräsidenten Georges Clemenceau. Sie beiden Politiker waren die Hauptakteure der Republikanisierung Europas, die auf den Ersten Weltkrieg folgte. Der linksliberale Clemenceau, ein Mystiker des Jakobinertums, sah im Sieg die Vollendung der Ideale der Französischen Revolution. Wilson wollte den Globus in eine Konföderation von ganz gleichen Republiken umwandeln, die nach dem Modell der USA gestaltet sein sollten.
Das Haupthindernis, das es zu zerschlagen galt, war Österreich-Ungarn, der letzte Widerhall der mittelalterlichen Christianitas. Charles Seymour, einer der amerikanischen Unterhändler des Versailler Vertrags, schilderte:
„Die Friedenskonferenz fand sich in die Position, eines regelrechter Liquidators des Habsburgerstaates. (…) Gemäß dem Selbstbestimmungsrecht der Völker stand es den Donaunationen zu, ihr Schicksal selbst zu bestimmen.“
Die Friedenskonferenz wurde in Paris am 18. Januar 1919 eröffnet. In jenen Tagen erreichte die Epidemie der Spanischen Grippe ihren Höhepunkt. Allein in Italien starben 600.000 Menschen daran. Genauso viele, wie der ganze Krieg an italienischen Opfern gefordert hatte. Auch zwei der drei Seherkinder von Fatima, Jacinta und Francisco, erkrankten im Dezember 1918. Francisco starb am 4. April 1919. Jacinta wurde in das Krankenhaus nach Lissabon gebracht, wo auch sie am 20. Februar 1920 starb.
Am 22. Dezember 1918 bekundete Papst Benedikt XV. seine Hoffnung bezüglich „der Beschlüsse, die ohne Verzug vom Friedensareopag getroffen werden, dem nun die Seufzer aller Herzen gilt“. Das Jahre 1919, schrieb L’Illustrazione italiana vom selben Tag, „wird das Jahr sein, das die Welt verändert“. Die Illusionen der „goldenen Zwanziger Jahre“ wurden schnell vom neuen Kriegssturm hinweggefegt, der seine Ursachen in den 1919/1920 in Paris abgeschlossenen Friedensverträgen hatte.
Das Jahrhundert, das auf den Ersten Weltkrieg folgte, gilt als das schrecklichste der ganzen abendländischen Geschichte. Auf dieses Jahrhundert lassen sich die Verse von William B. Yeats aus seinem Gedicht The Second Coming beziehen:
„Things fall apart; the centre cannot hold;
Mere anarchy is loosed upon the world.”„Alles bricht auseinander; die Mitte hält nicht mehr;
nur mehr Anarchie herrscht auf der Welt.“
Das Heilige Römische Reich war 1806 offiziell von Napoleon ruhend gestellt worden, aber Österreich-Ungarn übte noch bis 1918 seine Mission aus, indem es das Scharnier für die Stabilität und das Gleichgewicht in Europa war.
Dann öffnete sich der Abgrund der Instabilität, die vom politischen Bereich heute auch auf den religiösen Bereich übergegangen ist und zur Verwirrung von Millionen von Seelen führt. Die Kirche überlebt aber alle Stürme, die die Reiche fortreißen, und das Jesukind lädt uns in der Heiligen Nacht neu ein, uns voll Vertrauen Ihm ganz anzuvertrauen wie die schlafenden Kinder im Arm der Mutter
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017. Zwischenüberschriften von der Redaktion eingefügt.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons