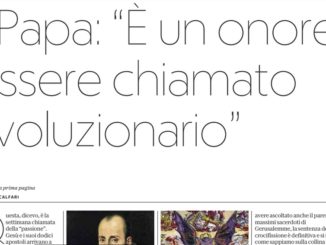(Rom) Papst Franziskus hat den ersten Stein angestoßen, als er am 6. Dezember 2017 in einer Fernsehsendung über das Vaterunser sagte: „Diese Übersetzung ist nicht gut“. Der Dominoeffekt will sich noch nicht so recht einstellen, doch Unruhe ist entstanden.
Die „tentatio“
Es geht um die Schlußbitte des Herrengebets:
„Et ne nos inducas in tentationem“.
„Und führe uns nicht in Versuchung“.
Genau an dieser Übersetzung in die Volkssprachen stößt sich das Kirchenoberhaupt. Im Sender der Italienischen Bischofskonferenz machte der Papst eine Mimik und Gestik zu seinen Worten, als wollte er sagen: Nein, nein, das sei nicht mein Gott, der mit in solchen Worten zum Ausdruck kommt. Die Gestik war, als wolle der Papst ein solches Gottesbild weit von sich wegschieben. Um was für ein Gottesbild geht es aber dabei? Liegt der Übersetzung in so viele Sprachen, wie sie seit so vielen Jahrhunderten gilt, wirklich ein irriges Verständnis zugrunde, oder schaut Papst Franziskus durch die falsche Brille auf das Gebet der Gebete?
Sogar die deutschen Bischöfe antworteten ihm, man solle nicht an Dingen rühren, die so in Ordnung seien.
Schließlich hat die Bitte noch einen zweiten Teil: „sed libera nos a malo“, „sondern erlöse uns von dem Bösen“.
Papst Franziskus kann sich mit der „Versuchung“ aber nicht anfreunden. Der Teufel sei es, der in Versuchung führe, aber doch nicht Gott. In der Tat spricht Franziskus seit seinem Amtsantritt viel über den Teufel. Weit öfter als seine Amtsvorgänger. Im Gegensatz zu diesen sieht er aber gleichzeitig die Hölle so ziemlich leer. Auch das ist einer jener zahlreichen Widersprüche dieses Pontifex, oder zumindest eine Haltung, die rätselhaft erscheint.
Nach Frankreich und Argentinien folgt Italien
Der Pfeil gegen die gebräuchlichen Übersetzungen wurde vom Papst zeitgleich mit einer Änderung abgeschossen. Die französischen Bischöfen führte eine Neuformulierung eben dieser Stelle des Vatersunsers ein. „Et ne nous laisse pas entrer en tentation“, heißt es nun in Gallien und meint soviel wie: „Und laß uns nicht in die Versuchung gehen“. So ähnlich klingt die Volksübersetzung auch in Argentinien: „Y no nos dejes caer en la tentación“.
Die Italienische Bischofskonferenz steht dem Papst besonders nahe. Als Bischof von Rom ist er automatisch ihr Vorsitzender, nimmt aber in der Regel nicht an den Sitzungen teil. Dafür ernennt er Vertraute, die seine Vorgaben in der Bischofskonferenz umsetzen.
Vom 12.–24. November wird sich die Bischofskonferenz zu einer außerordentlichen Vollversammlung zusammenfinden, um über die Einführung einer neuen Version der letzten Vaterunser-Bitte in der heiligen Liturgie zu beraten. Die Frage der Liturgie bezieht sich auf den Novus Ordo. Sie stellt sich erst seit der Liturgiereform der 60er Jahre mit ihrem Verzicht auf die Kirchensprache und der Einführung der Volkssprachen, denn an eine Änderung des lateinischen Originals denkt niemand.
In der neuen italienischen Bibelübersetzung, die von der Italienischen Bischofskonferenz veröffentlicht wurde, ist die Stelle bereits umformuliert. Dort heißt es: „E non abbandonarci nella tentazione“. Das wiederum heißt soviel wie: „Und verlaß uns in der Versuchung nicht“.
Papst Franziskus sagte, Gott führe nicht in Versuchung. Das mache der Teufel. Es gehe um eine Bitte an Gott. „Das Gebet das wir sprechen besagt: Wenn der Teufel uns in Versuchung führt, dann reich Du uns bitte eine Hand.“
Was bedeutet es nun aber, daß die Italienische Bischofskonferenz eine eigene Vollversammlung zum Thema ansetzt. Ist die Entscheidung schon gefallen: Roma locuta causa finita? Das fragt sich der Vatikanist Sandro Magister. Werde man also demnächst auch in Italien in der Heiligen Messe und bei Andachten eine neue Formulierung hören, wie sie bereits in der Volksbibel steht und wie sie dem Papst sicher besser gefällt?
Ein neuer Vorschlag der römischen Jesuitenzeitschrift
„Eben nicht“, so der Vatikanist. Es sei keineswegs gesagt, „daß es so enden muß. Inzwischen hat Rom nämlich ein weiteres Mal gesprochen und eine andere Lösung vorgeschlagen“.
Dieses Mal war es nicht der Papst höchstpersönlich, aber eine Stimme, durch die letztlich er spricht: die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica. Jeder dort veröffentlichte Artikel muß zuvor in den Vatikan, um die Druckerlaubnis zu erhalten. Papst Franziskus macht das bei allen Themen, die ihm wichtig sind, selbst. Was in der Zeitschrift erscheint, erscheint mit Zustimmung von Santa Marta.
Ein bekannter Exeget, der Jesuit Pietro Bovati, widmete dem Thema nun einen Aufsatz:
„‘Stelle uns nicht auf die Probe.‘ Zu einer schwierigen Bitte des Vaterunsers“.[1]La Civilità Cattolica, Nr. 4023, S. 215–227.
Im ersten Teil des Aufsatzes zeigt Pater Bovati auf, daß diese Bitte in der Geschichte der Christenheit wiederholt zu Interpretationsschwierigkeiten führte. Zugleich legt er dar, wie die wichtigsten Kirchenväter, der Heilige Ambrosius, der heilige Augustinus und der heilige Hieronymus, sie ausgelegt haben:
„Laß nicht zu, daß wir in die Versuchung kommen und/oder ihr erliegen“.
Oder auch:
„Laß uns nicht in die Versuchung fallen oder verlaß uns nicht in der Versuchung“.
Die Kirchenväter hätten es also auch schon so verstanden, wie es die neuen Übersetzungen sagen.
„Und prüfe uns nicht“
„Doch an dieser Stelle unternimmt Bovati eine unerwartete Wende“, so Magister. Der Jesuit schlägt eine neue Übersetzung vor, die nicht mit der übereinstimmt, die drauf und dran scheint, in Italien Eingang in die Liturgie zu finden, und auch nicht mit jener neuen in Frankreich oder Argentinien und in anderen Ländern.
Die neue Übersetzung von P. Bovati lautet:
„Und stelle uns nicht auf die Probe“. Im Deutschen könnte man auch sagen: „Und prüfe uns nicht“.
Das, so der Jesuit, sei die eigentliche Aussage der Bitte. So hätten es auch die Kirchenväter verstanden. Vor allem sei diese Formulierung, wenn man eine neue suche, angemessener, als die jüngst diskutierten oder eingeführten.
Der Begriff „Prüfung“, lateinisch probatio, entspreche, so Bovati, mehr dem griechischen πειρασμóς als der Begriff tentatio. Im Neuen Testament habe der Begriff tentatio eine negative Konnotation. Das sei das Gegenteil dessen, was Gott mache, wenn er uns „prüft“. In der ganzen Heiligen Schrift „prüft“ Gott den Menschen und stelle ihn auf die Probe. Jesus selbst habe das im Garten von Gethsemane vor seinem Leiden erlebt:
„Mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst“ (Mt 26,39).
Es gehe also darum, so der Jesuit, zum Vater zu bitten, imstande zu sein, den Versuchungen des Bösen und der Verführung durch den Bösen zu widerstehen. Es gehe aber auch darum, den guten Gott zu bitten, daß er jenen seine Hilfe schenkt, die klein und schwach sind, damit sie sich in der Dunkelheit der Nacht nicht verlieren. Eine Vielzahl von Bitten sei also in dieser einen Bitte zusammengefaßt, und die lasse sich am besten mit den Worten „Und stelle uns nicht auf die Probe“ wiedergeben.
Magister verweist darauf, daß die von Pater Bovati vorgeschlagene Übersetzung sich auch für den Gesang besser eigne, weil sie aus gleich viele Silben besteht, wie die bisherige Übersetzung. Zumindest das gilt auch für die Übertragung ins Deutsche.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: La Civiltà Cattolica (Screenshot)
-
| ↑1 | La Civilità Cattolica, Nr. 4023, S. 215–227. |
|---|