
von Roberto de Mattei*
Leo XIII. (1878–1903) war einer der bedeutendsten Päpste der neueren Zeit, nicht nur wegen der Dauer seines Pontifikats, dem zweitlängsten unter den Nachfolgern des Petrus nach jenem des seligen Pius IX., sondern vor allem wegen des Umfangs und des Reichtums seines Lehramtes. Seine Unterweisung umfaßt grundlegende Enzykliken, wie Aeterni Patris (1879) über die thomistische Wiederherstellung der Philosophie in der Neuscholastik, Arcanum (1880) über die Unauflöslichkeit der Ehe, Humanum genus (1884) gegen die Freimaurerei, Immortale Dei (1885) über die christliche Konstitution der Staaten und Rerum Novarum (1891) über die Arbeiterfrage und die Soziale Frage.
Das Lehramt von Papst Gioacchino Pecci erscheint uns wie ein organischer Corpus in Kontinuität mit den Lehren seines Vorgängers Pius IX. und seines Nachfolgers Pius X. Die wirkliche Wende und Neuheit des leoninischen Pontifikats betrifft hingegen die Kirchenpolitik und die pastorale Haltung gegenüber der Moderne. Die Regierung von Leo XIII. wurde geprägt vom ehrgeizigen Projekt, den Primat des Apostolischen Stuhls wieder zu bekräftigen durch eine Neudefinition der Beziehungen mit den europäischen Staaten und die Versöhnung der Kirche mit der modernen Welt. Die Politik des ralliement, das heißt, der Annäherung an die freimaurerische und laizistische Dritte Republik in Frankreich bildete den Kern dieses Projekts.
Radikale Entchristlichung durch Dritte Republik
Die Dritte Republik führte eine brutale Kampagne der Entchristlichung durch, vor allem im Schulbereich. Für Leo XIII. lag die Verantwortung für diesen Antiklerikalismus bei den Monarchisten, die im Namen ihres katholischen Glaubens die Republik bekämpften. Auf diese Weise provozierten sie den Haß der Republikaner gegen die Katholizität. Um die Republikaner zu entwaffnen, galt es, sie davon zu überzeugen, daß die Kirche nicht gegen die Republik war, sondern nur gegen den Laizismus. Und um sie davon zu überzeugen, gab es keinen anderen Weg, nach seinem Dafürhalten, als die republikanischen Institutionen zu unterstützen.
In Wirklichkeit war die Dritte Republik keine abstrakte Republik, sondern eine zentralistische und jakobinische Republik, eine Tochter der Französischen Revolution. Ihr Programm für ein laizistisches Frankreich war nicht bloß ein Accessoire, sondern der eigentliche Daseinsgrund des republikanischen Regimes. Die Republikaner waren Republikaner, weil sie antikatholisch waren. An der Monarchie haßten sie die Kirche und ihren übernatürlichen, göttlichen Anspruch, so wie die Monarchisten Antirepublikaner waren, weil sie katholisch waren und an der Monarchie die Kirche liebten.
Leo XIII. und der anti-monarchistische „Anschluß“ an die Moderne
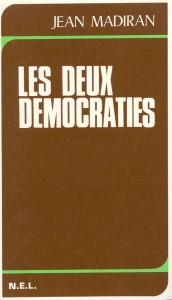
Die Enzyklika Au milieu des sollicitudes von 1892, mit der Leo XIII. den ralliement begann, verlangte von den Katholiken nicht, Republikaner zu werden, doch die Direktiven des Heiligen Stuhls an die Nuntien und die Bischöfe, die direkt vom Papst stammten, interpretierten seine Enzyklika in diesem Sinn. Auf die Gläubigen wurde ein massiver Druck ausgeübt, indem man sie glauben ließ, wer weiterhin öffentlich die Monarchie unterstützte, beging eine schwere Sünde. Die Katholiken spalteten sich deswegen in die beiden Richtungen der ralliés und der réfractaires, wie es bereits 1791 zur Zeit der Zivilverfassung des Klerus der Fall gewesen war.
Die ralliés folgten den pastoralen Anweisungen des Papstes, weil sie seinen Worten in allen Bereichen, einschließlich dem politischen und pastoralen, Unfehlbarkeit zusprachen. Die réfractaires, die theologisch und geistlich besser ausgebildete Katholiken waren, setzten der Politik des ralliement entschiedenen Widerstand entgegen, da sie darin einen pastoralen Akt sahen, der als solcher keine Unfehlbarkeit beanspruchen und daher falsch sein konnte. Jean Madiran, der in einer Studie eine scharfsinnige Kritik gegen den ralliement formulierte (Les deux démocraties, Paris 1977), schrieb, daß Leo XIII. von den Monarchisten forderte, die Monarchie im Namen der Religion aufzugeben, um den Kampf zur Verteidigung des Glaubens effizienter führen zu können. Doch statt diesen Kampf zu führen, praktizierte er mit dem ralliement eine desaströse Entspannungspolitik mit den Feinden der Kirche.
Dialogpolitik gescheitert: Radikale Trennung von Staat und Kirche von 1905
Trotz des Einsatzes von Leo XIII. und seines Kardinalstaatssekretärs Mariano Rampolla del Tindaro scheiterte diese Politik des Dialogs auf ganzer Linie und erreichte keines der gesteckten Ziele. Die antichristliche Haltung der Dritten Republik nahm an Radikalität noch zu bis zum Höhepunkt in der bis heute gültigen Loi concernant la Séparation des Eglises et de l’Etat (Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat) vom 9. Dezember 1905, besser bekannt als „Loi Combes“, die jede öffentliche Anerkennung und Finanzierung der Kirche abschaffte. Sie sieht die Religion nur in ihrer privaten, nicht aber in ihrer sozialen Dimension. Das Gesetz erklärte den gesamten kirchlichen Besitz, einschließlich aller Kirchen und Klöster zum Staatseigentum. Die Kirchen wurden vom Staat kostenlos associations cultuelles zur Verfügung gestellt, die von den Gläubigen ohne Zustimmung der Kirche gewählt wurden. Das Konkordat von 1801, das ein Jahrhundert lang die Beziehungen zwischen Frankreich und dem Heiligen Stuhl geregelt hatte, und das Leo XIII. um jeden Preis beibehalten wollte, wurde völlig zerschlagen.
Entschlossenheit von Pius X. bremst Antiklerikalismus

Die republikanische Schlacht gegen die Kirche sah sich dann auf ihrem Weg aber einem neuen Papst gegenüber, Pius X., der am 4. August 1903 auf den Stuhl Petri gewählt wurde. Mit den Enzykliken Vehementer nos vom 11. Februar 1906, Gravissimo officii vom 10. August desselben Jahres, Une fois encore vom 6. Januar 1907, protestierte Pius X., unterstützt von seinem Kardinalstaatssekretär Rafael Merry del Val feierlich gegen die laizistischen Gesetze und forderte die Katholiken auf, sich mit allen legalen Mitteln dagegen zu wehren, um die Tradition und die Werte des christlichen Frankreichs zu bewahren. Angesichts dieser Entschlossenheit wagte die Dritte Republik es nicht, die Verfolgung bis zum Letzten auszureizen, um die Schaffung von Märtyrern zu vermeiden. Schließlich ließ die Republik davon ab, die Kirchen zu schließen und die Priester zu verhaften. Die konzessionslose Politik Pius X. erwies sich als weitsichtig. Das Gesetz zur Trennung von Staat und Kirche wurde nie buchstabengetreu, wie es eigentlich gedacht war, umgesetzt. Der Aufruf des Papstes führte zu einem großen Wiedererwachen der Katholizität in Frankreich vor dem Ersten Weltkrieg. Die Kirchenpolitik des heiligen Pius X., ganz entgegengesetzt zu jener seines Vorgängers, stellt letztlich eine historische Verurteilung ohne Wenn und Aber des ralliement dar.
Ralliement-Politik Leos XIII. widersprach seinen doktrinellen Vorgaben
Leo XIII. vertrat nie liberale Irrtümer, ganz im Gegenteil. Er verurteilte sie ausdrücklich. Der Historiker kann dennoch nicht umhin, einen Widerspruch zwischen dem Lehramt von Papst Pecci und seiner politischen und pastoralen Haltung zu erkennen. In den Enzykliken Diuturnum illud, Immortale Dei und Libertas bekräftigt und vertieft er die politische Doktrin von Gregor XVI. und Pius IX., doch seine Ralliement-Politik widersprach seinen doktrinellen Vorgaben.
Leo XIII. ermutigte, unabhängig von seinen Absichten, in der Praxis jene Ideen und Richtungen, die er auf doktrineller Ebene verurteilte. Wenn wir dem Wort liberal die Bedeutung einer geistigen Haltung, einer politischen Richtung zu Zugeständnissen und zum Kompromiß zusprechen, dann muß man zum Schluß gelangen, daß Leo XIII. einen liberalen Geist hatte. Dieser liberale Geist zeigte sich vor allem im Versuch, die Probleme der Moderne mit den Waffen diplomatischer Verhandlungen und Kompromisse zu lösen, statt mit einem entschlossenen Festhalten an den Grundsätzen und einem politischen und kulturellen Kampf. Auf diese Haltung berief sich die „Dritte Partei“ der Kirche, die im Lauf des 20. Jahrhunderts versuchte, eine Mittlerposition zwischen Modernisten und Antimodernisten einzunehmen, die sich das Feld streitig machten.
Ralliement-Geist die große Versuchung für die Kirche
Der Geist des ralliement, des Anschlusses an die moderne Welt, blieb für mehr als ein Jahrhundert, und bleibt auch weiterhin, die große Versuchung, der die Kirche ausgesetzt ist. Unter diesem Aspekt beging ein Papst von so großer Doktrin wie Leo XIII. in der pastoralen Strategie einen schweren Fehler. Im Gegensatz dazu steht die prophetische Kraft des heiligen Pius X. in direkter Übereinstimmung mit seinem Pontifikat zwischen der Wahrheit des Evangeliums und dem gelebten Leben der Kirche in der Welt, zwischen der Theorie und der Praxis, zwischen der Doktrin und der Pastoral, ohne jedes Nachgeben gegenüber den weltlichen Schmeicheleien.
Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Schriftleiter der Monatszeitschrift Radici Cristiane und der Online-Nachrichtenagentur Corrispondenza Romana, von 2003 bis 2011 stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Forschungsrats von Italien, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt erschienen: Vicario di Cristo. Il primato di Pietro tra normalità ed eccezione (Stellvertreter Christi. Der Primat des Petrus zwischen Normalität und Ausnahme), Verona 2013; in deutscher Übersetzung zuletzt: Das Zweite Vatikanische Konzil – eine bislang ungeschriebene Geschichte, Ruppichteroth 2011.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Petite francaise/Wikicommons




