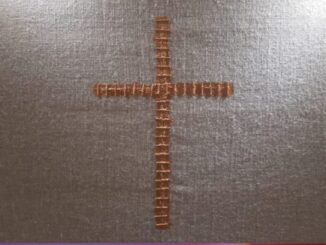Zum heutigen Gedenktag des heiligen Bischofs und Kirchenvaters.
Von Plinio Corrêa de Oliveira*
Die Werke des heiligen Augustinus (354–430) zu lesen gehört zu den größten Genüssen, die einem Menschen vergönnt sind. Das Buch der „Bekenntnisse“ ist wunderbar und in vieler Hinsicht höchst erbaulich. Augustinus schildert darin die moralischen Abgründe von Stolz und Sinnlichkeit, in die er gefallen war, und erzählt, wie er aus seinen zahlreichen Sünden herausfand. Sodann berichtet er von seinen ersten Begegnungen mit dem heiligen Ambrosius (340–397) und davon, wie durch die Gegenwart des heiligen Bischofs von Mailand das Licht der katholischen Religion in seine Seele einzudringen begann.
Er bringt seine Begeisterung für den Bischof von Mailand und für seine Besuche bei ihm zum Ausdruck. Augustinus konnte nicht oft mit Ambrosius sprechen, denn der Bischof hatte für gewöhnlich viel zu tun – neben seinem Hirtendienst las und studierte er –, doch blieb Augustinus gern einfach da, um Ambrosius bei der Arbeit zuzusehen. Und der Bischof wußte, daß sein Beispiel für Augustinus ein besseres Apostolat war als jede Rede.
Man kann sich die Szene vorstellen: Ambrosius, der große Kirchenlehrer, schreibt an einem mächtigen Folianten. Sein Antlitz ist das eines ehrwürdigen, gelassenen Greises, erleuchtet von der Gnade Gottes, weise, nachdenklich, erhaben in seinen Urteilen. Bisweilen hält er inne zu einem raschen inneren Gebet, kehrt dann zu seinen Gedanken zurück, um sie zu einem endgültigen Schluß zu führen. Ihn beobachtet Augustinus, dessen Gesicht noch die Unruhe der Krise widerspiegelt, die er gerade durchlebt. Doch die Gnade Gottes dringt in die Seele von Augustinus ein und verwandelt seine Persönlichkeit – durch seine Bewunderung für Ambrosius.
So erzählt er weiter von seiner inneren Krise, vom Frieden, den er erfuhr, als er eine Kirche betrat und die heilige Musik, die Psalmen, die Schönheit der Liturgie hörte. Dann kommen die machtvollen Regungen der Reue und jene geheimnisvolle Stimme, die er vernimmt und die ihm gebietet: „Tolle et lege“ – „Nimm und lies“. Er nimmt die Heilige Schrift zur Hand, und sie schlägt sich an einer Stelle auf, die auf sein vergangenes Leben genau zutrifft: Römer 13, 13–14: „Nicht in Gelagen und Trinkereien, nicht in Unreinheit und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an und sorgt nicht so für das Fleisch, daß Begierden geweckt werden.“
So empfängt er eine entscheidende Gnade, die seine Bekehrung vollendet.
Er beschreibt ferner das berühmte Gespräch von Ostia mit seiner Mutter, der heiligen Monika (331–387). Sie war eine sehr heilige Frau, er aber war ein sehr schlechter Sohn gewesen. Als sie in Karthago waren und sich auf eine Reise nach Rom vorbereiteten, war die heilige Monika in die Kirche gegangen und hatte die Nacht im Gebet verbracht. Augustinus nutzte dies aus, um sie zu verlassen und sich ohne sie nach Rom einzuschiffen – er ließ sie allein zurück.
Doch sie folgte ihm, immer unter Tränen und im Gebet für seine Bekehrung. Einmal ging sie zum Bischof von Mailand, zum heiligen Ambrosius, um ihn zu fragen, ob der Sohn sich je bekehren werde. Der Bischof antwortete mit den berühmten Worten: „Frau, der Sohn so vieler Tränen kann nicht verlorengehen.“ Er wollte damit sagen, daß sie durch ihre tiefen und intensiven Leiden die Wiedergeburt des Augustinus erleben werde.
Man kann sich ihre Freude vorstellen, als der Sohn sich bekehrte. Augustinus und seine Mutter verbrachten mehrere Monate zusammen, während er sich auf die Taufe vorbereitete. Dann rüsteten sie sich zur Rückkehr nach Afrika. Vor der Einschiffung kehrten sie in einem Gasthaus in Ostia ein, der Hafenstadt am Mittelmeer in der Nähe Roms. Am Fenster stehend und auf das Meer blickend, begannen sie, über die Dinge Gottes zu sprechen.
Wer heute von diesem Gespräch zwischen der heiligen Mutter und dem Sohn liest, ist überzeugt, daß sie in Wirklichkeit ein übernatürliches Phänomen, eine Ekstase, erlebten. Das verlieh Augustinus die Kraft für die Kämpfe, die er bald zu bestehen haben würde. Für Monika war es ein Vorgeschmack des Paradieses, denn sie starb dort in Ostia, bevor das Schiff auslief. Augustinus schildert ihre Beisetzung in rührender Weise. Dann bricht er nach Afrika auf, wo er 395 Bischof von Hippo wird.
In Hippo schreibt er ein weiteres seiner großen Bücher, „Vom Gottesstaat“. Thema dieses außergewöhnlichen Werkes ist der unaufhörliche, unversöhnliche Kampf, der sich in der Geschichte zwischen zwei „Städten“ abspielt – „Stadt“ kommt hier vom lateinischen „civitas“ und bezeichnet mehr als eine einzelne Stadt: vielmehr ein Gemeinwesen, einen Staat, eine Zivilisation. Diese beiden Städte sind die Stadt Gottes und die Stadt des Teufels. Er begreift die ganze Geschichte als einen Kampf zwischen der katholischen Kirche und den Mächten der Finsternis. Der Kampf entspringt zwei verschiedenen Lieben: In der Stadt Gottes herrscht die Liebe zu Gott und die Selbstvergessenheit; in der Stadt des Teufels die Selbstliebe und das Vergessen Gottes.
Für sich selbst zu leben heißt, sich als das winzige Zentrum des Universums zu betrachten und alles auf die eigenen Genüsse und Interessen hin auszurichten. Dieser Egozentrismus ist der Ausgangspunkt für alles Böse. Gott zu lieben hingegen bedeutet, sich ganz auf die transzendenten Wirklichkeiten auszurichten, von denen uns die Offenbarung spricht. Es heißt, einen metaphysischen, religiösen Geist zu haben, der auf das Höchste gerichtet ist. Das ist: für Gott leben. Mit diesen beiden Prinzipien faßt der heilige Augustinus die gesamte Geschichte zusammen.
Jahrhunderte später wird eine ähnliche Geschichtsphilosophie vom heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort (1673–1716) gelehrt. Er wird erklären, daß alles, was von Gott kommt, gut ist. Da die Feindschaft zwischen der Gottesmutter und der Schlange und zwischen dem Geschlecht Mariens und dem der Schlange von Gott gewollt ist, kann diese Feindschaft als solche nur gut sein. Im Grunde ist es dieselbe These des heiligen Augustinus, vorgetragen in einem kämpferischeren Stil, der einer anderen Epoche eigen ist.
Wegen seiner sehr lebendigen Darstellung von Gut und Böse wird Augustinus samt dem „Gottesstaat“ von manchem heutigen Progressiven angegriffen, der behauptet, sie böten eine „manichäische“ Weltsicht. Nach diesem törichten Vorwurf wäre jeder, der behauptet, es gebe Gut und Böse, ein Manichäer. Man müßte folglich das Lehramt der Kirche und alle Heiligen für manichäisch halten – was absurd ist.
Der Manichäismus ist eine dualistische, aus der Gnosis hervorgegangene Lehre, die im dritten Jahrhundert der christlichen Ära aufkam. Sie lehrte, es gebe zwei Götter, ursprünglich und der Macht nach einander gleich, einen guten und einen bösen, die in ständigem Kampf miteinander stünden. Die katholische Lehre ist völlig anders. Sie lehrt, daß es nur einen Gott gibt, ewig und allmächtig, und daß ein bloßes Geschöpf von ihm, der Teufel, sich gegen ihn empört hat und ihn in der Geschichte bekämpft.
Der Manichäismus ist eine Häresie, weil er den Kampf in eine andere Seinsordnung verlegt. Für die Manichäer ist der Kampf ontologisch; für die Katholiken bewegt er sich auf der moralischen Ebene. Zudem wird der Kampf für die Manichäer niemals enden; für die Katholiken endet er mit dem Jüngsten Gericht, wenn Gott über einen Gegner triumphieren wird, der ihm nicht gleich, sondern unendlich unterlegen ist. Selbstverständlich kennen die Progressiven diese Unterschiede; doch es ist ihnen nützlich zu behaupten, jeder, der ihre irenische und „ökumenische“ Sicht der Geschichte nicht teile, sei ein Manichäer. Das ist ein unsinniger Vorwurf und ein Ausdruck von Unredlichkeit.
Ein sehr schöner Punkt drängt sich auf, wenn man über den heiligen Augustinus meditiert. Er schrieb seine großen Bücher, als das Weströmische Reich im Niedergang begriffen war und alles darauf hindeutete, daß die katholische Religion wahrscheinlich durch die fremdvölkischen Invasionen hinweggefegt würde. Tatsächlich wurden Hippo und Karthago so verwüstet, daß von diesen Städten kaum etwas stehen blieb, und die katholische Religion erlangte in diesen Gegenden ihren früheren Glanz nie wieder. Und doch schrieb Augustinus, während die Zukunft ungewiß war, in heiterer Gelassenheit weiter. Er starb, während die Vandalen in seine Stadt eindrangen.
Die Welt, wie der Heilige sie kannte, brach zusammen – und das Mittelalter trat an ihre Stelle. Da waren es die Werke des heiligen Augustinus, die die mittelalterliche Vorstellung vom Staat, vom Imperium, von der Christenheit inspirierten. Karl der Große (742–814) pflegte sich während des Mittagsmahls den „Gottesstaat“ vorlesen zu lassen, und das Reich, das er gründete, ließ sich von den Ideen des Augustinus leiten. In gewissem Sinn ist das Mittelalter eine Lilie, die auf dem Grab des heiligen Augustinus erblühte. Jahrhunderte nach seinem Tod wurde sein Vertrauen belohnt.
Darin liegt eine Lehre für uns. Heute gibt es neue Vandalen, die darauf aus sind, sowohl die kulturellen Werte als auch die materiellen Bauwerke der christlichen Zivilisation zu zerstören. Wie Augustinus müssen wir gelassen, im Glauben und mit Vertrauen weiterwirken, in dem Wissen, daß unsere Arbeit Früchte tragen und dann erblühen wird zu einem Reich Mariens – wenn Gott es will.
*Plinio Corrêa de Oliveira (1908–1995) war ein großer katholischer Denker und Gegenrevolutionär des 20. Jahrhunderts, er lehrte zunächst Kulturgeschichte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Sao Paulo und wurde dann Professor für Neuere Geschichte und Zeitgeschichte an der Philosophischen Fakultät Sao Bento und an der Päpstlichen Katholischen Universität von Sao Paulo. Sein Leben widmete der brasilianische Philosoph, Historiker und Politiker der Verteidigung der katholischen Kirche und der katholischen Soziallehre. Konkret bedeutete das für ihn, den Kampf gegen die antichristlichen Ideologien Marxismus und Nationalsozialismus aufzunehmen. Während letztere mit dem Jahr 1945 verschwand, blieb der Marxismus in seiner Heimat Brasilien und weltweit eine Bedrohung, der er sich entgegenstellte. Sein Hauptwerk ist „Revolution und Gegenrevolution“. Plinio Corrêa de Oliveira gründete die Gesellschaft für Tradition, Familie und Privateigentum (TFP), die heute in verschiedenen Ländern aktiv ist, darunter in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana