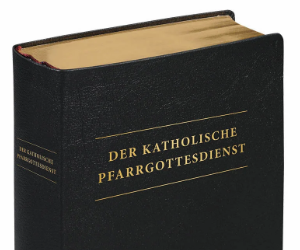(Rom) Die italienische Justiz hat erneut die Festnahme des italienischen Finanziers Gianluigi Torzi angeordnet. Torzi war bereits einmal auf Ersuchen des Vatikans wegen der Ermittlungen zu Unregelmäßigkeiten beim Kauf der Luxusimmobilie in der Londoner Sloane Avenue Nr. 60 verhaftet und auf Kaution wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Auch der neue Haftbefehl geht auf ein Rechtshilfeansuchen des Vatikans zurück.
Die römische Finanzwache gab gestern Details zur Operation Broking Bad bekannt. Die vatikanische Justiz wirft Torzi vor, sich mit dem Immobilienkauf betrügerisch und unrechtmäßig 15 Millionen Euro angeeignet zu haben, während für den Vatikan das Immobiliengeschäft ein kostspieliger Mißerfolg war. Wie die Finanzwache ermittelte, wurden von Torzi zumindest 4,5 Millionen der genannten Summe in börsennotierte Unternehmen in Italien investiert und dadurch „innerhalb weniger Monate ein Gewinn von 750.000 Euro erzielt“.
Torzi konnte nicht festgenommen werden, weil er sich derzeit, wie italienische Medien berichten, in London aufhält.
Zehn Tage nach seiner ersten Festnahme war er am 5. Juni 2020 gegen Hinterlegung einer Kaution wieder freigelassen worden. Der vatikanische Staatsanwalt Gian Piero Milano hatte die Enthaftung angeordnet, nachdem Torzi sich bei einem Verhör kooperationsbereit gezeigt und eine Reihe „für die Ermittlungen nützlicher Unterlagen“ vorgelegt hatte.
Erpressung, Unterschlagung, Geldwäsche und schwerer Betrug
Die vatikanische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Torzi wegen Erpressung, Unterschlagung, Geldwäsche und schweren Betrugs. Ihm drohen bis zu zwölf Jahre Gefängnis.
Am vergangenen 26. März wurde hingegen vom Southwark Crown Court in London festgestellt, daß das vatikanische Staatssekretariat, das den Kauf getätigt hatte, von Torzi nicht getäuscht worden sei. Dabei ging es um Torzis Zugriff auf seine englischen Konten bzw. die seiner Firma Vita Health Ltd (vormals Sunset). Als Grund nannte das Londoner Gericht, daß die vatikanische Staatsanwaltschaft nicht ausreichend Unterlagen übermittelt habe.
Der englischer Richter Tony Baumgartner ging aber noch weiter. Er stellte fest, daß hochrangige vatikanische Beamte des Staatssekretariats und möglicherweise sogar Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin persönlich die Transaktion genehmigt hatten, die dann von der vatikanischen Staatsanwaltschaft als „betrügerisch“ eingestuft und von Parolin selbst als „undurchsichtig“ bezeichnet wurde. Parolin habe persönlich mit Nachdruck bei der Vatikanbank IOR 150 Millionen Euro angefordert, mit denen für den Immobilienkauf übernommene Verpflichtungen gedeckt werden sollten.

Die Schuld der anderen
Vor dem Londoner Gericht schob Torzi alle Schuld auf Fabrizio Tirabassi, einen Laienbeamten des vatikanischen Staatssekretariats. Dieser habe damit geprahlt, hochrangige Prälaten des Vatikans, darunter den heutigen Kardinal Angelo Becciu und den amtierenden Substituten des Staatssekretariats Edgar Peña Parra, erpreßt zu haben. Tirabassi habe auch Torzi und dessen Familie bedroht und ihm eine Prostituierte angeboten, um das Geschäft zu feiern. Der Finanzier legte für seine Behauptungen allerdings keine Beweise vor.
Wenn er dennoch in London Recht bekam, dann wegen der unvollständigen Datenübermittlung durch den Vatikan. Die vatikanische Staatsanwaltschaft hatte zwar die Unterlagen zum Vorwurf der Erpressung und des Betrugs übermittelt, aber nicht dazu, wie die Entscheidungswege des Staatssekretariats zum Immobiliengeschäft waren. Der Richter deutete an, daß daher nicht ausgeschlossen werden könne, daß entsprechende Genehmigungen durch die zuständigen Stellen vorlagen. Er deutete ebenso an, daß die vatikanische Justiz möglicherweise nicht frei und unabhängig handeln könne, sollten hochrangige Entscheidungsträger geschützt werden.
Der Vatikan hatte mit einem Rechtshilfeansuchen an die englische Justiz Torzis dortige Konten sperren lassen wegen des dringenden Verdachts, daß das Geld aus der betrügerischen Transaktion stamme. Der Finanzier hatte dagegen Berufung eingelegt.
Das eigentliche Geschäft im Wert von mehreren hundert Millionen Euro fand zwischen dem vatikanischen Staatssekretariat und dem Geschäftsmann Raffaele Mincione statt. Als der Vatikan 2018 Verluste in Höhe von 20 Prozent feststellen mußte, wurde die Zusammenarbeit mit Mincione beendet und Torzi vom Staatssekretariat beauftragt, als Makler das Geschäft abzuschließen und die Verwaltung der Immobilie zu organisieren. Die Staatsanwaltschaft des Vatikans wirft Torzi schweren Betrug in Komplizenschaft mit vatikanischen Beamten zum Schaden des Staatssekretariats vor. Torzi habe die mißliche Lage des Vatikans in der Geschäftsangelegenheit ausgenützt, während der laufenden Transaktion einige Bedingungen geändert und sich damit unrechtmäßig 15 Millionen angeeignet.
Die Unschuld der Geschäftemacher
Torzi beteuerte vor dem englischen Gericht seine Unschuld. Alles beruhe nur auf einem „Mißverständnis“. Der Richter gab seinem Einspruch auch deshalb recht, weil die vom Vatikan vorgebrachte Gefahr, Torzi könne die Konten leerräumen, zwar gegeben, aber unwahrscheinlich sei, da er dazu mehrere Monate Zeit gehabt hätte, ohne davon Gebrauch zu machen.
Auch Mincione behauptet, während der ganzen Transaktion „in gutem Glauben“ gehandelt zu haben, weshalb er in London in einem gesonderten Verfahren wegen der vatikanischen Ermittlungen Klage gegen Rufschädigung eingebracht hat.
Insgesamt zeigten sich jedoch auch in der Londoner Verhandlung undurchsichtige Geschäftspraktiken und weitere Betrugsvorwürfe gegen Torzi, der eine italienische Versicherungsgesellschaft um 25 Millionen Euro geschädigt haben soll. Die auf diese Weise lukrierten Gelder scheinen umgehend in andere zweifelhafte Geldtransaktionen geflossen zu sein.
Wegen des für den Vatikan verlustreichen Immobiliengeschäfts wurden mehrere Beamte des Staatssekretariats vom Dienst suspendiert, darunter Tommaso Di Ruzza, der Direktor der Finanzaufsichtsbehörde AIF – und Fabrizio Tirabassi.
Weil die in London eingesetzten Finanzmittel vom Substituten des Staatssekretärs verwaltet wurden, geriet auch Kardinal Angelo Becciu, der zur fraglichen Zeit Substitut war, ins Visier der Ermittler. 2018 hatte ihn Papst Franziskus aus dem Staatssekretariat abgezogen und zum Präfekten der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse ernannt. Von diesem und anderen Ämtern mußte der Kardinal wegen der gegen ihn laufenden Ermittlungen im September 2020 zurücktreten. Er gab zudem bekannt, nicht auf die Kardinalswürde, aber auf die Ausübung seiner Rechte als Kardinal zu verzichten.
Die vatikanischen Ermittlungen gegen Kardinal Becciu, Torzi, Mincione, Tirabassi und weitere ehemalige Vatikanbeamte sind noch im Gange.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL