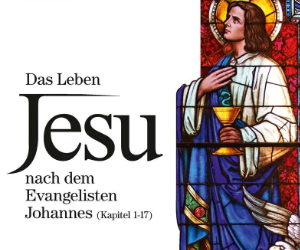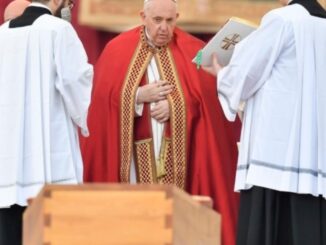(Rom) Am 6. September ist der bekannte italienische Dirigent Claudio Scimone in seiner Heimatstadt Padua verstorben. Mit seinem letzten Willen gab er ein Beispiel und erteilte einer Unsitte eine Absage.
Bereits während seines Studiums bei Dimitri Mitropoulos und Franco Ferrara war er in den 50er Jahren als Musikkritiker tätig. Internationale Bekanntheit erlangte er mit dem 1959 von ihm gegründeten Kammerorchester I Solisti Veneti, das er bis zu seinem Lebensende leitete. Die mit diesem Orchester von Scimone eingespielte Diskographie umfaßt rund 300 Aufnahmen. Allein Scimones Vivaldi-Diskographie umfaßt mehr als 250 Werke. Er dirigierte weltweit eine Vielzahl von Orcherstern vom Royal Philharmonic Orchestra in London über das New Japan Philharmonic in Tokio, das Symphonieorchester des Belgischen Rundfunks und das des Französischen Rundfunks bis zu den Bamberger Symphonikern, um nur einige zu nennen. Insgesamt wird die Zahl der von Scimone auf allen Kontinenten dirigierten Konzerte auf über 6000 geschätzt.
Von 1961–1974 unterrichtete er Kammermusik am Konservatorium in Venedig zuerst, dann an jenem von Verona. Von 1974–1993 war er Direktor des Konservatoriums von Padua. Von 1979–1986 leitete er neben den Solisti Veneti auch das Orchester der Gulbenkian-Stiftung in Lissabon, deren Ehrendirigent er nach dieser Zeit wurde. Seine wissenschaftliche Forschung galt vor allem Werken des 18. und 19. Jahrhunderts. Dazu gehörte unter anderem die Rekonstruktion der Vivaldi-Oper „Orlando furioso“.
Das Requiem für den Maestro fand am vergangenen Samstag auf seinen Wunsch hin in der Chiesa degli Eremitani in seiner Heimatstadt Padua statt. Napoleon Bonaparte hatte 1806 die Kirche schließen und das einstige Augustinerkloster aufheben lassen, in dem Martin Luther 1511 auf seiner Rom-Reise nächtigte, als der damalige Augustinerpater auf Rom noch besser zu sprechen als der „Reformator“ Luther wenige Jahre später.
Das Kloster gibt es nicht mehr, aber die Kirche mit ihren großartigen Fresken aus dem 14. Jahrhundert dient seit 1808 wieder dem katholischen Kultus. Der Maestro wollte nicht nur, daß hier sein Totenamt gehalten wird, sondern erteilte noch im Tod eine Lektion über angemessenes Verhalten und gegen liturgische Unsitten.
In der Kirche wurde sein diesbezüglicher letzter Wille verlesen, mit dem er die Trauergemeinde ersuchte, nicht der in Mode gekommenen, schlechten Gewohnheit zu folgen und in der Kirche oder am Friedhof „zum Abschied“ zu applaudieren, sondern in- und außerhalb der Kirche auf jeden Applaus zu verzichten, um den Ernst und die Bedeutung des Moments zu entsprechen.
Diesem Wunsch folgten die mehr als tausend Anwesenden, darunter die Präsidentin des Italienischen Senats, die Kirchenrechtlerin Elisabetta Alberti-Casellati (Forza Italia), weshalb der Sarg des großen Musikers und gläubigen Christen nach dem Requiem, bei dem seine Solisti Veneti spielten, in völliger Stille aus der Kirche getragen wurde, begleitet nur von den Gebeten des Priesters und dem Läuten der Totenglocke, wie es in Italien als „Ausläuten“ üblich ist.
Text: Norberto Zuccalà/Giuseppe Nardi
Bild: MiL