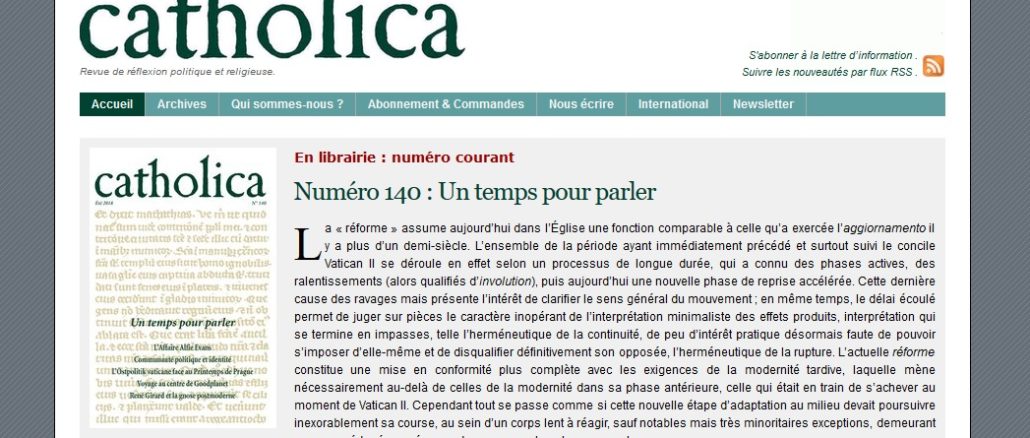
(Paris) Die internationale Zeitschrift für Kultur, Politik und Religion, Catholica, die seit 30 Jahren in Frankreich herausgegeben wird, zählt „namhafte Autoren wie Émile Poulat, Robert Spaemann, Ernst Wolfgang Böckenförde, Vladimir Bukowski, Stanislaw Grygiel, Thierry Wolton, Jacques Ellul und Pietro De Marco“, so der Vatikanist Sandro Magister. Die Chefredaktion hat Bernard Dumont inne.

In der neuesten, druckfrischen Ausgabe beschäftigt sich Dumont, sein Leitartikel ist auch im Internet frei zugänglich, mit dem „unglaublichen“ Schweigen fast aller Kardinäle und Bischöfe – ausgenommen die vier Unterzeichner der Dubia –, zur „Auflösung der traditionellen Form der Katholizität, die durch das Pontifikat von Jorge Mario Bergoglio ins Werk gesetzt wird“. Bernard Dumont thematisiert das offenbar angestrebte Ende des „römischen Katholizismus“, ohne daß sich dagegen ein Aufschrei erhebt, wie bereits der Historiker Roberto Pertici beklagte. Das Ende wird von Rom oder jenen verkündet, die sich auf Rom berufen, und alle schweigen und scheinen sich dem unausweichlichen Schicksal zu fügen. Siehe die Analyse von Prof. Pertici: Die Reform von Papst Franziskus wurde bereits von Martin Luther geschrieben.
Warum ist dem so?
Der zur Ethik reduzierte Glaube
Dumont veröffentlichte in der neuen Ausgabe auch den Text eines Benediktinermönchs und Theologen, der „den vielleicht radikalsten Umsturz im Katholizismus unserer Zeit“ analysiert und kritisiert. Nicht mehr das Sakrament habe den Vorrang in der Kirche, von dem das Zweite Vatikanische Konzil noch sagte, es sei „culmen et fons“ des Lebens der Kirche, sondern die Ethik.
Diese Umsturzbewegung komme ebenso in der Frage der wiederverheirateten Geschiedenen wie der Interkommunion mit den Protestanten zum Ausdruck.
Der Benediktinertheologe ist P. Giulio Meiattini, der in diesem Jahr zum Thema bereits die Monographie „Amoris laetitia? Die Sakramente zur Moral reduziert“ (Verlag La Fontana di Siloe, Turin 2018) publizierte. Er ist Mönch der Benediktinerabtei Madonna della Scala in Noci und Professor für Fundamentaltheologie an der Theologischen Fakultät von Apulien und am Päpstlichen Athenaeum Sant’Anselmo in Rom.
Meiattini wirft Papst Franziskus und seinem Einflüsterer, Kardinal Walter Kasper, vor, nicht die viel genannte „Unterscheidung“, sondern die „Schlauheit“ zu fördern. Listig gehe es nämlich zu in Amoris laetitia und dem dahinterstehenden Geist.
„Der Zustand der Verwirrung ist offensichtlich“.
Mit diesen Worten beginnt der Theologe und Mönch seinen Aufsatz. Es werde behauptet, daß die Verwirrung nur vermeintlich, und nur das Ergebnis eines neuen Regierungsstils sei. Einer solchen Darstellung der derzeitigen Lage kann P. Meiattini nichts abgewinnen.
„Können die Verwirrung und die Meinungsverschiedenheiten zwischen Bischöfen zu heiklen Punkten der Glaubenslehre Früchte des Heiligen Geistes sein? Meines Erachtens nicht.“
Mehrere kleine Schritte bedeuten in Summe einen großen

Dann deutet Meiattini an, daß in Sachen wiederverheiratete Geschiedene von Anfang an ein vorgefertigter Plan verfolgt wurde. Mit der Möglichkeit, im Februar 2014, die einzige Rede vor dem Konsistorium der Kardinäle halten zu können, die ihm von Papst Franziskus verschafft wurde, habe Kardinal Kasper „den Boden bereitet“. Dennoch ist es mit zwei Bischofssynode nicht gelungen, eine gemeinsame Linie zum diskutierten Problem hervorzubringen. Wer die Berichte der „circuli minores“ der Synode von 2015 nachlese, könne unschwer sehen, daß es keine gemeinsame Position gab.
Der Papst hätte damit, das wäre die erste Aufgabe der „Unterscheidung“ gewesen, zu prüfen und zu verstehen gehabt, „welche Prozesse“ anzustoßen und weiterzuverfolgen wären, und welche nicht. Eine solche Unterscheidung habe aber nicht stattgefunden. Der eingeschlagene Weg wurde nicht geändert.
Tatsache sei, daß eine breite Mehrheit der Synodenväter „keine Änderung der traditionellen Ordnung“ wollte. Das Redaktionskomitee der Relatio finalis habe sich deshalb gehütet, irgendwelche Neuerungen in den Text aufzunehmen.
Dafür, so Meiattini, wurde statt eines großen, ein „kleiner Schritt“ gesetzt: Das Redaktionskomitee formulierte einige undefinierte Stellen, die einen „Atmosphärenwechsel“ bedeuteten.
Die Nicht-Ablehnung dieser schwebenden Formulierungen, die nur mit äußerster Mühe die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erhielten, genügte, daß der nächste „kleine Schritt“, einige zweideutige Fußnoten in Amoris laetitia ausreichten, um eine neue Richtung anzuzeigen.
Diese kleinen Schritte, die genau genommen, nur die traditionelle Position nicht bekräftigten, reichten aus, um den Episkopat zu spalten. Der nächste Schritt war dann die päpstliche Bestätigung der Richtlinien der Kirchenprovinz Buenos Aires zum Achten Kapitel von Amoris laetitia.
Diese Richtlinien seien in Wirklichkeit keine bloße Interpretation, denn sie enthalten Aussagen und Anweisungen, die weder in Amoris laetitia zu finden sind noch von den Synoden beschlossen wurden, und dort auch nie eine Mehrheit gefunden hätten.
Durch eine Reihe „kleiner Schritte“ wurde auf diese Weise innerhalb von drei Jahren letztlich ein „großer Schritt“ vollzogen, mit dem ein tiefgreifender Eingriff erfolgte. Mit „Synodalität“ habe das aber nichts zu tun, so Meiattini.
Der Glaube werde in Amoris laetitia, das sei die Gesamtstoßrichtung, zur Ethik reduziert.
„Die Ethik hat aber weder das erste noch das letzte Wort.“
„Ich verstehe nicht, wie der Bischof von Rom,so etwas schreiben kann“
Und Meiattini weiter:
„Ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, wie ein Bischof, vor allem jener von Rom, solche Sätze schreiben kann: ‚Man sollte nicht zwei begrenzten Menschen die gewaltige Last aufladen, in vollkommener Weise die Vereinigung nachzubilden, die zwischen Christus und seiner Kirche besteht‘ (AS, 122)“.
Diese Formulierung sei Ausdruck eines ganz anderen Denkens: Eine vom Sakrament losgelöste Ethik des Evangeliums wird zu einer „gewaltigen Last“, anstatt ein „süßes Joch“ und eine „leichte Last“ zu sein.
Zu einer solchen Aussage könne man nur gelangen, wenn man das Christentum – vielleicht auch unbewußt – nur als Ethik begreift. Auf diese Weise gelange man zu Ergebnissen, die dem lutherischen Konzept des simul iustus et peccator entsprechen, das vom Konzil von Trient verurteilt wurde.
Die Interkommunion mit den Protestanten folge derselben Logik. Entscheidend sei nur mehr das mutmaßliche, innere Empfinden. Für die objektiven Kriterien werden alle denkbaren mildernden Umstände in Rechnung gestellt, und die subjektive Gewissensentscheidung bestimmend. Warum sollten dann, so P. Meiattani, nach diesem Muster nicht auch ein Buddhist oder ein Hindu die katholische Eucharistie empfangen können?
„Der Verhältnis zwischen Moral und Sakramenten zu beschädigen kann letztlich zu einem nicht katholischen Kirchenverständnis führen.“
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Catholica/Vida inteligente/Cooperatores veritatis (Screenshots)





Man muss sich die Frage stellen, hat die Vielzahl der Kardinäle und Bischöfe Angst vor Papst Franziskus, ihm offen die Wahrheit ins Gesicht zu sagen wie der Apostel Paulus dies Petrus gegenüber getan hat: Gal.2,11: Als Kephas aber nach Antiochia gekommen war, bin ich ihm offen entgegengetreten, weil er sich ins Unrecht gesetzt hatte oder fehlt ihnen der Mut sich zur Wahrheit des Evangeliums und zur Lehre Gottes zu bekennen. Sie scheinen offenbar nicht mehr zu bedenken, dass sie sich dafür einmal vor dem Angesicht Gottes verantworten werden. Erkennen sie nicht mehr, dass sie mit ihrem Schweigen zu Mietlingen werden,wie die Schrift sagt.
Es ist verheerend, das das falsche Evangelium verkündet wird und keiner von den Pupuraten ist in der Lage, dem Bischof von Rom das zu sagen. Weil die Mutigen schon weggemmobt sind und sonst ist alles im Schweigen umhüllt. Wie schrecklich!
Amoris laetitia beginnt mit einem nicht eindeutigen Satz, derweil übersetzt wird: Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche.
Dabei steht der Begriff Amor einmal für die geschlechtliche, sexuelle Liebe und zum anderen für den Römischen Liebesgott, dem die Römer göttliche Ehren zollten. Er war fester Bestandteil der römischen Götterwelt, einer Welt der toten Götter, der römische Götzen, die immer im Gegensatz stand zu dem Sohn des lebendigen Gottes und zu seinem Vater und der christlichen Lehre.
Hans – Gut und angebracht ist es, auf diesen semantischen Aspekt hinzuweisen. Das sollte regelmäßig in die Diskussion und Bewertung von „Amoris laetitia“ mit einbezogen werden.
Es ist kaum zu fassen, was die Haarspalter an Energien aufwenden müssen, um ihren Umsturz von Glauben und Kirche zu kaschieren und den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Diese nehmen das aber oft nicht wahr, sondern wollen endlich eine heile Welt ohne Kampf und Opfer nach ihrem Gutdünken, wobei der Begriff Gewissen mit Absicht verdreht wird und für alles Unmögliche herhalten muß- wie auch der Begriff Barmherzigkeit u.a.m.
Warum schweigen so viele Würdenträger angesichts der rasanten Fahrt in den Abgrund?- Womöglich auch, weil es sinnlos geworden ist, Starrsinnige und Unvernünftige korrigieren zu wollen. Bezüglich der sog. Interkommunion müssen das nunmehr auch die 7 deutschen Bischöfe feststellen, die sich ein Stück weit zumindest dagegen gesperrt hatten. Das Gespräch in Rom aber hat bekanntlich keine Klarheit gebracht im Sinne der Lehre, sondern eine deutliche Ermutigung für die irrige Position von Kardinal Marx und der anderen Bischöfe.
Vielleicht sollten die 7 Bischöfe ihren Rücktritt vom Amt erklären. Das wäre m.Er. noch das Beste. Besser selbst noch rechtzeitig nachgeben als gezwungen wie am „Beispiel“ Chile zu sehen ist.