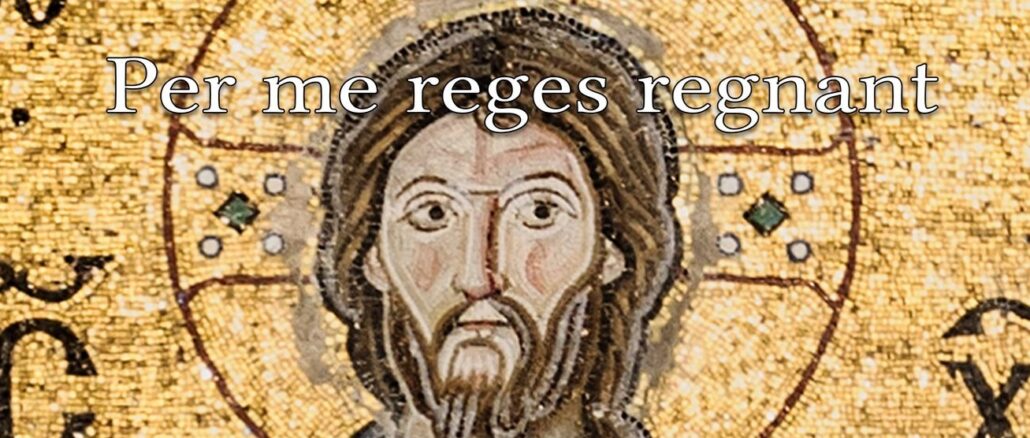
Am vergangenen 8. November fand in Gricigliano, dem Mutterhaus des Instituts Christus König und Hohepriester, die Tagung „Per me reges regnant“ statt. Diese Stelle aus dem Buch der Sprüche (8,15) findet sich auf der Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reichs.
Von Giovanni Formicola*
„Dixit itaque ei Pilatus: ‚Ergo rex es tu?‘. Respondit Iesus: ‚Tu dicis quia rex sum‘ “.
„Pilatus sagte zu ihm: ‚Also bist du doch ein König?‘ Jesus antwortete: ‚Du sagst es, ich bin ein König‘ “
(Joh 18, 37).
Jesus weist die Königsherrschaft nicht zurück, Er windet sich nicht heraus, Er fürchtet nicht das Gewicht der Worte, Er entzieht sich nicht der „Investitur“, Er lehrt nicht jene „falsche Bescheidenheit“, jene Verfälschung der Demut, mit denen man Ehren meidet, um deren Lasten nicht tragen zu müssen, oder mit denen man einen Egalitarismus bekennt, der ebenso unbegründet wie bloß zur Schau gestellt ist.
Er erklärt sich, als Mensch und als Gott, als Mensch-Gott, zum „König des Universums“. Eine „Gotteslästerung“ für den Sanhedrin, weil Er sich zu Gott macht; aber auch eine „Gotteslästerung“ für uns heutige Menschen, die wir Götzenanbeter von Freiheit und Gleichheit sind, weil Er sich zum „Höheren“ macht, sich als Autorität konstituiert, weil Er beansprucht, zu „befehlen“. Seine Königsherrschaft kann in der Tat nicht die eines modernen „konstitutionellen Königs“ sein, der herrscht, aber nicht regiert. Sie ist entweder effektiv oder sie ist es nicht. Sie kann nur eine authentische Souveränität sein: Jesus erklärt, daß Er der Herr ist. Der Einzige und der Alleinige: Er antwortet dem Vertreter des mächtigsten Herrschers jenes Ortes und jener Zeit, und mild, aber bestimmt, proklamiert Er sich als König, indem Er ihm sagt: „Du selbst erkennst mich als König an“, das heißt „auch jene zeitliche Macht, die du repräsentierst, ist mir unterworfen“. Er ist wahrlich Dominus Iesus, der Herr Jesus.
Und Er begnügt sich nicht damit, sich als König zu bezeichnen. Er erklärt auch, daß Sein Reich kein banales weltliches Reich ist, dazu bestimmt, zu entstehen und unterzugehen, einen Anfang und ein Ende zu haben, ein Reich für einige, aber nicht für alle – in diesem Sinne erklärt sich Jesus nicht zum Monarchen, denn Seine Königsherrschaft ist die der absoluten Eminenz, und Er verwendet den damals verständlichsten Begriff, um sie zu beschreiben. Unmittelbar nachdem Er sich zum König erklärt hat, sagt Er:
„Ego in hoc natus sum et ad hoc veni in mundum, ut testimonium perhibeam veritati“
„Dazu bin ich geboren und dazu bin ich in die Welt gekommen: um Zeugnis für die Wahrheit abzulegen.“ (Joh 18, 37).
Jesus ist König für die Wahrheit und aus der Wahrheit, Er selbst ist die Wahrheit, die sich in Ihm offenbart. Und da die Wahrheit eine ist, von jeher, und für alle, ist Jesus einzigartig als König, ist Er auf immer König, ist Er für alle König.
Ich glaube, daß nichts den modernen Menschen so sehr skandalisiert wie diese Aussage, ohne die jedoch der christliche Glaube seiner Essenz entleert ist. Denn er ist der Glaube an jene Person, die sich als König der Wahrheit und für die Wahrheit bezeichnet hat, und Jesus in diesem Punkt nicht ernst zu nehmen bedeutet schlicht, Ihn überhaupt nicht ernst zu nehmen. Alles, was Er gesagt und getan hat, gründet auf der Erklärung, der Herr zu sein, nicht einer von vielen. Und der heutige Mensch – so „bescheiden“, daß er sich der Wahrheit nicht gewachsen erklärt – kann alles ertragen, außer der Feststellung, daß die Wahrheit existiert und in irgendeiner Weise erkennbar ist; mehr noch, daß es jemanden gibt, der sie mit Autorität lehren kann und der den Lehrstuhl dafür errichtet hat. Und leider scheint es, daß sich dieses Wahrheitsanspruches auch viele schämen, die ihn eigentlich bekennen sollten.
Aber vielleicht gibt es eine andere Aussage, die in diesem Sich-als-König-Bekennen Jesu impliziert ist und die noch skandalöser klingt. Die Enzyklika von Papst Pius XI. Quas primas1, mit der das liturgische Hochfest Christkönig2 eingeführt wurde, lehrt klar, daß Jesus nicht nur König der einzelnen sein kann, nicht nur über die Herzen der Menschen herrschen kann, sondern daß Er auch über die Gesellschaft herrscht, da „kein Unterschied zwischen den einzelnen Menschen und dem häuslichen und bürgerlichen Gemeinwesen [besteht], denn die in Gesellschaft vereinten Menschen sind nicht weniger der Gewalt Christi unterstellt als die einzelnen Menschen. […] Die Führer der Nationen sollen sich daher nicht weigern, mit ihren Völkern das öffentliche Zeugnis der Ehrerbietung und des Gehorsams gegenüber dem Reich Christi abzulegen“. Und deshalb verurteilt sie „die Seuche unseres Zeitalters […], den sogenannten ‚Laizismus‘, der der Kirche das Recht – das aus dem Recht Jesu Christi entspringt – bestritten hat, […] die Völker zu lehren, Gesetze zu erlassen, die Völker zu regieren, um sie zur ewigen Seligkeit zu führen“.3
Gerade dieser Aspekt der Königsherrschaft – die, repetita iuvant, natürlich als Titel der „Hoheit“ verstanden wird und nichts mit der historisch bestimmten monarchischen Institution zu tun hat, so hochachtbar diese auch sein mag – den der Herr Jesus für die Welt beansprucht, ist wahrscheinlich noch skandalöser: Ihre öffentliche Dimension, die soziale Königsherrschaft, erscheint unannehmbar für jene, die meinen, der Glaube sei allenfalls eine Privatsache. Aber ob es gefällt oder nicht, das Reich des Herrn kann keine Grenzen haben; und es ist ein forderndes Reich.
Vielleicht wurde Er deshalb mit Dornen gekrönt. Diese höhnische Antwort auf die Erklärung Jesu, König zu sein, ist eine ewige Mahnung für jeden Christen. Wenn es wahr ist, daß viele Ihm gefolgt sind, Ihm folgen und Ihm folgen werden, so ist es auch wahr, daß in der Geschichte diejenigen wirkten, wirken und wirken werden, die der heilige Papst Johannes Paul II. als die „anti-evangelisierende Front“ 4 bezeichnete, bestehend aus den Feinden Gottes, die in der Geschichte unablässig wiederholen: „Nolumus hunc regnare super nos“, „Wir wollen nicht, daß dieser über uns herrsche“ (Lk 19, 14).
Die Königsherrschaft Christi ist daher, außer einer tröstlichen Realität, auch eine Mission: Sie muß gefördert und verteidigt werden, in unseren Herzen, aber auch in der Gesellschaft, damit sie anerkannt wird. Und in einer Gesellschaft, in der die Ablehnung dieser Herrschaft dominiert, leider auch unter vielen guten Gläubigen5, hat jener, der sich freiwillig zu ihrem Untertan macht, eine präzise Aufgabe6. Heute nennt man das Neuevangelisierung, das heißt keine „neue“ Verkündigung, sondern „von Neuem“ das immerwährende Evangelium zu verkünden. Aber ich ziehe es vor, Gegenrevolution zu sagen, was ein Prozeß ist, der dem revolutionären entgegengesetzt ist, der im Laufe der Jahrhunderte zur Verwüstung dessen geführt hat, was die christlich-abendländische Zivilisation war. Und zwar durch vier Phasen – die religiöse, die pseudo-protestantische Reformation; die sozio-politische, die sogenannte Französische Revolution; die sozio-ökonomische, die kommunistische Revolution, und die kulturelle, in die wir eingetaucht sind, das (emblematische) ’68 und alle seine libertinen, manipulierenden Konsequenzen des humanum in einer echten anthropologischen Katastrophe – denen die Anstrengung entgegengesetzt werden muß, ihren Weg zu unterbrechen und den gegenwärtigen Zustand des revolutionären Durcheinanders zu korrigieren. Damit nicht nur die Herzen, sondern auch die Völker, die Nationen, die Kulturen, die gesamte Zivilisation neu evangelisiert werden und das soziale Reich Jesu Christi von unten wiederhergestellt wird – indem von oben das himmlische Jerusalem herabsteigt.
Gegenüber dieser Mission kann man nicht einwenden, daß einem entthronten König nicht mehr Gehorsam geschuldet wird als einem aufgehobenen Gesetz. Sie kann auch nicht auf eine nostalgische Operation reduziert werden, eine Art anti-historischer Legitimismus, der sich zum Ziel setzt, einer Dynastie, die zu Unrecht ihrer beraubt wurde, den Thron zurückzugeben. Die Christenheit kann nicht für endgültig verloren erklärt werden, und der Verzicht auf das soziale Reich Christi ist, auch wenn er von hochrangigen, manchmal sehr hochrangigen Kirchenmännern kommt, per definitionem nichtig.
In der Tat ist die soziale Königsherrschaft Christi keine Tatsache der Vergangenheit, so wahr es auch ist, daß ihr heutzutage nicht nur der geschuldete Gehorsam, sondern sogar die Existenz selbst und ihre Notwendigkeit für die Stadt des Menschen, die die gesamte Geschichte durchzieht und die manchmal nicht einmal die Gläubigen anerkennen, verweigert wird. Die Königsherrschaft Christi, die auch sozial ist, ist eine stets aktuelle Realität, eine Tatsache, die den wechselnden Geschicken der Geschichte entzogen ist. Sie ist. Aber den Menschen ist die tragische Wahl gegeben, sie zu verleugnen, ihr zu entfliehen, sie nicht zu respektieren, anstatt sich ihr fügsam zu unterwerfen, so weit wie möglich post peccatum, eine Möglichkeit, der jedoch niemals die Unterstützung der Gnade fehlt, die niemandem verweigert wird, selbst dem, der sie nicht erbittet. Eine tragische Wahl, weil sie nicht ohne Konsequenzen ist, obwohl sie vom König „respektiert“ wird, der das Ende der Zeit erwartet, um das Unkraut vom Weizen zu trennen (vgl. Mt 13, 24–30 und 37–42).
Doch inzwischen wird die Welt, die sich schrittweise7 von jener historischen Inkarnation der sozialen Königsherrschaft Christi, die die christliche Zivilisation, die sogenannte mittelalterliche Christenheit, war, entfernt, die „moderne“ Welt, d. h. theophobisch und vollständig säkularisiert, immer unbewohnbarer, und das nicht nur für die verfolgten Guten.
„Die moderne Welt wird nicht bestraft. Sie ist die Strafe.“ 8
Wer die Stadt ohne Gott baut, baut sie gegen den Menschen9 und verwirklicht eine historische Hölle. Es ist schwierig, die totalitären Regime des Jahrhunderts des Bösen10 anders zu definieren, ebenso wie es unmöglich ist, anderes über unsere Zeit zu sagen, die mit Gott und der Königsherrschaft Christi folglich die menschliche Natur selbst, die geschlechtliche Realität des Menschen und damit Ehe, Familie und Fortpflanzung leugnet, die schlimmsten Schändlichkeiten und Greueltaten legitimiert – ja adelt –, bis hin zur Ermöglichung des Muttermordes durch die kostenpflichtige Leihmutterschaft oder adoptierte Kindschaft, das Recht auf Leben leugnet und es zu Labormaterial und zu Handelsware macht, als ob sie dessen Herr wäre, sich mit pflanzlichen, chemischen, akustischen und psychologischen Drogen betäubt, die elementarsten Freiheiten und das Eigentumsrecht leugnet.
Daher, wie der katalanische Jurist Àlvaro d’Ors – einer der vielen Meister ohne Schüler im saeculum – lehrt, „da […] Jesus Christus der ‚König‘ ist, existiert in der Geschichte keine andere ursprüngliche Macht, keine andere Souveränität, als die Christi. Alle, die als ‚Souveräne‘ bezeichnet werden, trotz ihrer scheinbaren Majestät, seien sie autokratische oder konstitutionelle Könige, oligarchische oder demokratische Regierungen, sind nichts anderes als Delegierte, die im Namen Jesu Christi befehlen müssen und denen aus folgendem Grund gehorcht werden muß: wegen der Macht, die sie von Ihm empfangen haben“.11
Es ist das einzige Kriterium der Legitimität jeder souveränen Macht, jedes Gesetzes, jeder Autorität, jeder zivilen Ordnung. Wenn es keine Macht gibt, die nicht delegiert ist – die Befehlsgewalt ist per Definition ein Mandat –, gibt es keine Delegierung, die letztlich nicht von Gott (Röm 13, 1), von Christus dem König, stammt: Ihm muß daher jede Souveränität Rechenschaft ablegen. Hier und jetzt, und im Jenseits.
„Nach der Erlösung kann es keine legitime Macht geben, die sich nicht als göttliche Delegierung von Christus dem König erkennt, dem die alleinige Souveränität dieser Welt zukommt. […]
In jedem Fall binden die konkreten Handlungen der Macht moralisch nicht, wenn sie jenen moralischen Geboten widersprechen, die konstitutiv für das soziale Ethos sind und die sich aus dem Naturrecht ableiten.
Die Kirche muß universell als authentische Interpretin des Naturrechts anerkannt werden. Von ihrer Autorität hängt die moralische Verpflichtung ab, der konstituierten Macht zu gehorchen.“ 12
Dies ist der eigentliche Sinn der Soziallehre der Kirche – nicht zu verwechseln mit dem Anspruch einer „sozialistischen Lehre der Kirche“, deren Zentrum sozioökonomische Fragen wären –, die das „Programm“ des sozialen Reiches Christi ist. Sie hat daher keinen geringeren Horizont und kann ihn nicht haben, als die christliche Instauratio der zeitlichen Realitäten13 – d. h. die soziale Achtung des ersten Gebots in der geschichtlichen Zeit –, die nicht aufgezwungen, sondern auch als historischer Weg des Heils anerkannt wird und daher, noch einmal, nicht von oben mit Gewalt herabgelassen wird, sondern organisch von unten entspringt.
Und so kehren wir zur Mission und zur Neuevangelisierung, d. h. zur Gegenrevolution, zurück.
John Henry Newman hatte ein tiefes und demütiges Konzept der Heiligkeit. Er sah sich nicht für das Leben der kanonisierten Heiligen „prädestiniert“, jenes der großen Gesten, der Wunder, des spektakulären Verzichts, sondern für eine verborgene, alltägliche, intellektuelle Heiligkeit, die aus Treue zum Gewissen und Liebe zur Wahrheit besteht. In diesem Sinne können wir sagen, daß er einen originellen Weg zur Heiligkeit aufgezeigt hat: den des gläubigen Denkers, des Mannes, der reflektiert, der zweifelt, der sucht, aber der sich schließlich der Wahrheit mit Klarheit und Mut ergibt. Sein Leben zeigt, daß auch die Intelligenz zum Ort der Heiligung werden kann, daß die Literatur die Suche nach dem Göttlichen ausdrücken kann und daß das Studium, wenn es als Dienst gelebt wird, zur Form der Nächstenliebe wird. Es ist bezeichnend, daß ein Schriftsteller wie James Joyce, der sich von der Kirche entfernt hatte, in Newman „den größten englischen Prosaiker“ erkannt hat. Das bedeutet, daß seine Schriften, die sich nicht nur in theologischen Abhandlungen, sondern auch in Romanen und Gedichten ausdrückten, auch in der säkularen Kultur Spuren hinterlassen haben, nicht nur in der kirchlichen. Der Satz über das Schuhputzen für die Heiligen ist emblematisch: Es ist keine falsche Bescheidenheit, sondern die Ironie dessen, der weiß, daß wahre Heiligkeit nicht auffällig sein muß. Newman lehrt uns, daß man auch in Bibliotheken, in Seminaren, in den Korridoren der Universitäten heilig sein kann. Eine intellektuelle, aber nicht intellektualistische Heiligkeit.
*Giovanni Formicola, Rechtsanwalt, verheiratet, Vater von fünf Kindern, Mitgründer der Alleanza Cattolica und der Gemeinschaft Option Benedikt. Autor mehrerer Bücher, darunter „Il Sessantotto“ („Achtundsechzig“), „Difesero la fede, fermarono il comunismo. La Cristiada, Messico 1926–1929. La Cruzada, Spagna 1936–1939“ („Sie verteidigten den Glauben und stoppten den Kommunismus. Die Cristiada, Mexiko 1926–1929. Die Cruzada, Spanien 1936–1939“).
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Opzione Benedetto/Facebook
[1] Vgl. Pius XI. (1922–1939), Enzyklika Quas primas über die Königsherrschaft Christi, 11. Dezember 1925.
[2] „Die Feier dieses Festes, das sich jedes Jahr wiederholt, soll auch eine Mahnung an die Nationen sein, daß die Pflicht, Christus öffentlich zu verehren und ihm Gehorsam zu leisten, nicht nur die einzelnen, sondern auch die Obrigkeiten und Regierenden betrifft: […] denn seine königliche Würde erfordert, daß die gesamte Gesellschaft sich den göttlichen Geboten und den christlichen Grundsätzen anpaßt, sei es bei der Festlegung von Gesetzen, sei es bei der Verwaltung der Gerechtigkeit, sei es schließlich bei der Prägung der Seelen der Jugend mit der heiligen Lehre und der Heiligkeit der Sitten“ (Ibidem).
[3] Ibidem.
[4] „Es wird vielleicht nicht übertrieben sein, wenn wir sagen, daß sich auf diesem Gebiet [Leben, Ehe und Familie, Anm. d. Red.] in besonderer Weise die ‚anti-evangelisierende Front‘ konzentriert, die über eine spezifische Argumentation und darüber hinaus über vielfältige ‚Mittel‘ verfügt“ (Hl. Johannes Paul II. [1978–2005], Ansprache an die Teilnehmer der IX. Vollversammlung des Päpstlichen Rates für die Familie, 4. Oktober 1991).
[5] „Dieser Zustand ist vielleicht der Apathie oder der Zaghaftigkeit der Guten zuzuschreiben, welche sich vom Kampf fernhalten oder nur schwach Widerstand leisten; daraus schöpfen die Feinde der Kirche größere Kühnheit und Wagemut“ (Pius XI., Enzyklika Quas primas, zit.).
[6] „Wenn aber alle Gläubigen begreifen, daß sie tapfer und immer unter den Fahnen Christi des Königs kämpfen müssen, werden sie sich mit apostolischem Eifer bemühen, die Aufständischen und Unwissenden zu Gott zurückzuführen, und werden sich anstrengen, die Rechte Gottes selbst unversehrt zu wahren“ (Ibidem).
[7] „Christus ja, Kirche nein. Dann: Gott ja, Christus nein. Schließlich der gottlose Schrei: Gott ist tot; oder besser: Gott ist nie gewesen. Und hier ist der Versuch, die Struktur der Welt auf Fundamenten zu errichten, die wir nicht zögern, als die Hauptverantwortlichen für die Bedrohung zu bezeichnen, die über der Menschheit schwebt: eine Wirtschaft ohne Gott, ein Recht ohne Gott, eine Politik ohne Gott. Der ‚Feind‘ hat sich bemüht und bemüht sich, daß Christus ein Fremder in den Universitäten, in der Schule, in der Familie, in der Rechtspflege, in der Gesetzgebung, im Kreis der Nationen, dort, wo über Frieden oder Krieg entschieden wird, sei“ (Pius XII. [1939–1958], Ansprache an die Männer der Katholischen Aktion, 12. Oktober 1952).
[8] Nicolás Gómez Dávila (1913–1994), Escolios a un texto implícito, Bd. II, Instituto Colombiano de Cultura, Santa Fe de Bogotá 1977, S. 344.
[9] „Eine Welt ohne Gott baut sich früher oder später gegen den Menschen auf“ (Hl. Johannes Paul II., Botschaft an die Jugend Frankreichs, Paris, 1. Juni 1980). Vgl. auch: „Der Versuch, die menschlichen Dinge so zu gestalten, daß man vollständig auf Gott verzichtet, führt uns immer mehr an den Rand des Abgrunds, zur totalen Ausklammerung des Menschen“ (Joseph Ratzinger, L’Europa di Benedetto nella crisi delle culture, Cantagalli, Siena 2005, S. 62). Die These wird anschließend mit päpstlicher Autorität wie folgt artikuliert und begründet: „Wer Gott aus seinem Horizont ausschließt, verfälscht den Begriff der ‚Wirklichkeit‘ und kann folglich nur in Irrwege und mit destruktiven Rezepten geraten. Die erste grundlegende Aussage ist daher folgende: Nur wer Gott anerkennt, kennt die Realität und kann ihr angemessen und wirklich menschlich antworten. Die Wahrheit dieser These wird angesichts des Scheiterns aller Systeme deutlich, die Gott in Klammern setzen“ (Benedikt XVI. [2005–2013], Ansprache bei der Eröffnung der V. Generalkonferenz des Lateinamerikanischen und Karibischen Episkopats, Aparecida 13. Mai 2007, in Beilage zu: L’Osservatore Romano vom 2. Juni 2007, S. 9). In diesen Äußerungen ist das Echo von De Lubac (1896–1991) zu hören: „Es ist dann nicht wahr, wie man manchmal sagen möchte, daß der Mensch unfähig sei, die Erde ohne Gott zu organisieren. Aber wahr ist, daß er sie ohne Gott letztendlich nur gegen den Menschen organisieren kann“ (Henri De Lubac, Das Drama des atheistischen Humanismus [Erste Ausgabe Paris 1945], Morcelliana, Brescia 1988, S. 9).
[10] Vgl. Alain Besançon, Novecento. Il secolo del male. Nazismo, comunismo, Shoah, ital. Übers., Lindau, Turin 2008.
[11] Álvaro d’Ors y Peréz-Peix (1915–2004), La violenza e l’ordine, Marco, Lungro di Cosenza [CS] 2003, S. 62.
[12] Ibid., S. 142–143.
[13] Vgl. Zweites Ökumenisches Vatikanisches Konzil, Dekret über das Laienapostolat Apostolicam actuositatem, 18. November 1965.



