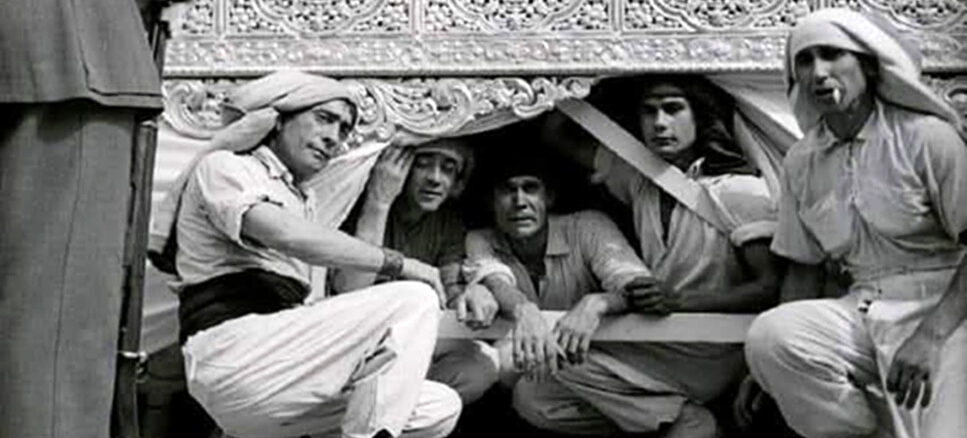
Der Spanier, der unter dem Pseudonym „Eck“ schreibt, wirft einen kritischen Blick auf bestimmte Aspekte in der Welt der Tradition, die er bedenklich findet. Er spricht über die „religiöse Unersättlichkeit“, wobei diese, wie er ausführt, mit dem Glauben eigentlich gar nicht zu tun hat. Eck konzentriert sich in seiner Darstellung auf Spanien, dennoch können Hinweise auch für den deutschen Sprachraum bedenkenswert sein.
Von Eck*
„Es ist sinnlos, wie sie mich verehren; was sie lehren, sind Satzungen von Menschen.“
(Mt 15,9)
„Es entspringt einem Geist, der im spanischen Katholizismus nur allzu häufig anzutreffen ist, der aber dem Wesen des Katholizismus fremd ist – einem Geist, den man als Unersättlichkeit bezeichnen könnte. In Spanien gibt es zu viele Menschen, die sich nicht damit zufriedengeben, daß jemand katholisch ist. Es genügt nicht, an die Glaubensartikel zu glauben, die Sakramente zu empfangen und sich nach Kräften an die Zehn Gebote zu halten. Nein, man muß darüber hinaus der Überzeugung sein, daß der einzig wahre Katholizismus der spanische ist. Man muß bestimmte politische Positionen vertreten, die von Katholiken im übrigen Teil der Welt nicht unbedingt geteilt werden. Man muß philosophisch Thomist sein. Man muß glauben, daß Balmes ein großer Philosoph ist, daß die Lösung für Spaniens Probleme bereits in den Büchern von Menéndez Pelayo zu finden ist. Man muß die Gedichte von Gabriel y Galán jenen von Jorge Guillén vorziehen; überzeugt sein, daß spanische Kunst zwingend realistisch zu sein hat; daß Amor Ruibal bedeutender ist als Unamuno; daß Gonzalo Bilbao ein besserer Maler ist als Picasso, Navarro Villoslada ein besserer Romancier als Baroja, der Filósofo Rancio ein besserer Katholik als Jovellanos; daß eine Zeitung dem El Siglo Futuro und nicht El Sol ähneln sollte; man muß meinen, daß das spanische Kino voller Spiritualität sei; daß, wer Donoso Cortés schätzt, sich nicht gleichzeitig für Valera interessieren könne; daß einzig die aristotelische Logik akzeptabel sei; daß bestimmte Schulcurricula unantastbar seien; daß christliche Moral identisch mit den Konventionen des kleinbürgerlichen Spanien der Provinzen sei. Versuchen Sie nur, in einem einzigen dieser Punkte zu widersprechen – dem kleinsten –, und Sie werden sehen, wie diese Leute sich geschlossen gegen Sie stellen.“
Julián Marías: Über das Christentum, „Gott und der Kaiser. Einige Worte über Morente“, Ed. Planeta, Barcelona 1998, S. 51f.
Natürlich weiß ich, daß der zitierte Text älteren Datums ist, wie jeder aufmerksame Leser leicht erkennen wird. Die Behauptung etwa, das spanische Kino sei voller Spiritualität, wirkt heute surreal, absurd, geradezu wahnsinnig – zumal seine Hauptthemen seit Langem sexuelle Perversion und der Bürgerkrieg sind, ob getrennt oder kombiniert. Ja, der Artikel stammt aus den 1950er Jahren, aber das Problem, das er anprangert – die religiöse Unersättlichkeit –, ist dasselbe geblieben, auch wenn sich Autoren, Themen und Fallbeispiele verändert haben. Die dahinterstehende Haltung jedoch ist vollkommen gegenwärtig, und wir werden sogleich einen Beleg dafür sehen, daß dieses Übel auch heute noch nagt.
Ein Beispiel aus dem Jahr 2025 – nicht aus den 1950ern
Ein ganz frisches Beispiel, sozusagen frisch gefischt aus den stürmischen Weiten des Internets. Es findet sich in dem Artikel „Tradicionalista? Por supuesto“ („Traditionalist? Selbstverständlich“) auf Infocatólica, veröffentlicht am 26. Juli 2025. Das eigentlich Interessante daran ist nicht der Artikel selbst, sondern die Kommentare und Reaktionen auf die Beiträge eines gewissen César, die in etwa folgenden Tenor haben:
„Das Problem ist: ‚Traditionalist‘ zu sein bedeutet heute nicht mehr, die Tradition dort zu ehren, wo sie hingehört, sondern sich noch viele andere Ideen anzueignen. Ich begann vor einigen Jahren, mich in ‚Tradi‘-Kreisen zu bewegen, weil ich von der zunehmenden lehrmäßigen Verwirrung abgestoßen war. Anfangs war das sehr schön – vor allem wegen der Liturgie. Aber sobald man sich mit bestimmten „Tradis“ trifft, um Gedanken auszutauschen, ändert sich alles: Man muß glauben, daß Kondensstreifen am Himmel Teil einer Verschwörung sind, um uns alle zu töten; man sollte möglichst Carlist sein; man muß die gesamte kirchliche Hierarchie schlechtreden; man muß beim Fronleichnamszug ‚Viva Cristo Rey!‘ mit militärischem Tonfall schreien, wie ein Soldat, der seinem Offizier antwortet: ‚Jawohl, Herr!‚
Kurz: Ich liebe die Tradition. Aber ich bin kein solcher ‚Tradi‘. Denn die Tradition zu lieben bedeutet nicht, ins Jahr 1936 zurückzureisen. Der Papst meiner Kindheit war der heilige Johannes Paul II. Aber viele ‚Tradis‘ handeln gegen das, was sein Lehramt fordert. Deshalb habe ich den Kontakt zu solchen Kreisen aufgegeben. Leider schaden diese ‚Tradis‘ der Tradition.“
Dieses Muster haben wir schon hunderte Male gesehen: Menschen, die zur Tradition kommen, weil sie nach der Schönheit des Kultes und lehrmäßiger Klarheit suchen – und dann desillusioniert, enttäuscht, manchmal regelrecht entsetzt oder fluchtartig wieder gehen. Warum? Wegen der Zehn Gebote? Wegen der Sakramente? Wegen des geistlichen Lebens? Nein. Sondern wegen der Unersättlichkeit vieler – also wegen einer Spielart des Pharisäismus, wie er heute bequem und weitverbreitet auftritt.
César selbst schreibt: „Anfangs wunderschön – wegen der Liturgie. Aber sobald die Tradis sich treffen, um Ideen auszutauschen, wird es schwierig … Deshalb habe ich mich von ihnen entfernt. Und leider schaden die Tradis der Tradition.“
Man vergleiche die „man muß“ und „du mußt“-Formeln, die César aufzählt, mit jenen, die Julián Marías vor Jahrzehnten benannte – und frage sich: Wie viele davon gehören wirklich zu dem, was die Kirche verlangt? Keine. Gar keine. Es handelt sich durchweg um Meinungen, Vorlieben, Geschmäcker – persönliche Präferenzen, die weder den Glauben noch die Sakramente noch die christliche Moral berühren.
Doch sehen wir uns die Antworten auf César an – viel aufschlußreicher, da sie die beschriebene Mentalität in ihrer ganzen Rohheit offenlegen. Gegen diese minimalen, zarten Kritiken – vergleichbar mit einem kleinen Klaps von einer Ursulinen-Schwester – erfolgten harsche Reaktionen, ganz so, wie Marías es vorhergesagt hatte. Die Struktur dieser Repliken ist stets gleich: zweigliedrig.
- (A) Zunächst ein scheinbar wohlwollender Einstieg – eine captatio benevolentiae, die in Wahrheit eine Opferrolle einnimmt: „Wir werden zu Unrecht angegriffen.“
- (B) Dann folgt der eigentliche Schlag – ein ad-hominem-Angriff, ohne sachliche Grundlage, gespeist aus Stolz und Narzissmus. Es wird mit böser Absicht unterstellt, der Kritiker sei unaufrichtig, habe versteckte Absichten oder sei Feind im Schafspelz. Man verweigert die Möglichkeit, daß Kritik in guter Absicht, auf Erfahrung beruhend und konstruktiv gemeint sein könnte.
Und nun zu den drei Reaktionen:
1. Andrés – oder die Anklage der Lauheit
(Denn „Tradi“ sein heißt, radikal zu sein. Natürlich.)
(A) Meine Erfahrung ist ganz anders als die von César. Ich habe eine „Tradi“-Messe besucht, und was Meinungen betrifft, war alles sehr vielfältig.
(B) Nun ja, nicht so vielfältig. In Nicht-Tradi Kreisen verteidigt man meist Abtreibung, Homo-Ehe, daß man nicht radikal sein müsse, Pachamama-Verehrung und „Kumbaya“. Wenn man meint, Nicht-Tradis seien so, wäre das dumm. Aber wie man sieht, gibt es alles überall.
Anfangs gut formuliert – doch in der zweiten Hälfte zerstört durch die perfide Kontaktschuld, mit der César indirekt mit solchen Verirrungen in Verbindung gebracht wird.
Natürlich, Andrés – der Traditionskatholizismus glänzt ja durch Abwesenheit in sozialen Fragen; besser, man ist nicht zu radikal, sonst denken noch Leute, man sei ein Linker oder gar Kommunist.
Und nein, wir verehren nicht die Pachamama – aber andere Götzen werden mitunter noch schlimmer verherrlicht, weil sie viel bürgerlicher daherkommen … Und besser, wir schweigen über die pseudo-viktorianische Rhetorik, die mancherorts schmerzhafter klingt als jedes Kumbaya.
2. LJo – der Verschwörungstheoretiker
(Denn nur ein Werkzeug des Bösen kann uns kritisieren – wir, die Crème de la Crème des Katholizismus.)
(A) Ein Segen für die „Tradis“, wie César sie nennt, dass dieser Mann sie nicht mehr besucht – so macht er keine Karikaturen von ihnen und verhöhnt sie nicht mit scheinbar harmlosen Spötteleien, die sie in Wahrheit diskreditieren sollen.
(B) Denn offensichtlich ist César ein verkappter Progressist, der Kommunismus, Feminismus und Modernismus gutheißt.
Und natürlich: für die Weihe von Frauen ist er auch.
Auch hier: keine Karikaturen, kein Spott, keine Böswilligkeit – aber dennoch wird César unterstellt, ein verdeckter Agent zu sein, der sich eingeschlichen hat, um die Bewegung zu diskreditieren.
Vielleicht ist LJo ja selbst ein als Ultra-Tradi getarnter Kritiker – ein Fall à la Chesterton’s „Der Mann, der Donnerstag war“?
3. Santiago Ll – mein Favorit, oder: Testosteron statt Argumente
(Denn gegen Bosheit hilft nur Kampfgeist.)
César:
(A) Du hast keine Klarheit. Vielen geht es so: Sie suchen nicht Gott, sondern eine perfekte Gruppe, auf die sie sich stützen können. Natürlich finden sie sie nie und analysieren jeden Gottesdienstbesucher unter der Lupe.
(B) Nicht mal „Viva Cristo Rey!“ erträgst du. Dann also: Viva Cristo Rey!!
Mein Favorit. Denn: Santiago sagt eine tiefe Wahrheit – die Perfektion gibt es in dieser Welt nicht, und viele suchen sie unbewußt. Aber seine Antwort ist: „Scheiß drauf – Viva Cristo Rey ins Gesicht, ob’s dir paßt oder nicht!“
Dabei interessiert ihn nicht, welche politischen oder historischen Implikationen dieser Ruf hat, noch daß viele ihn aus anderen Gründen rufen als dem wahren Sinn der Worte.
Aber klar: Die „modernistische Linke“ muß nicht bekehrt, sondern verjagt oder ausgerottet werden. Man ist nur einen Schritt entfernt von dem Messias, auf den die Pharisäer ihrer Zeit warteten…
Fazit
César hat ins Schwarze getroffen. Er kritisierte nicht das Wesentliche des Traditionalismus – weder Liturgie noch dogmatische Klarheit. Im Gegenteil, gerade deshalb suchte er diesen Weg.
Was er nicht wollte, war das „Komplettpaket“ kaufen: all diese menschlichen Traditionen, diese Zehntabgaben an Minze und Raute, diese mangelnde Nächstenliebe unter dem Deckmantel der Frömmigkeit, dieser Hochmut, verkleidet als Glaubensverteidigung. Und er hat Recht – denn weder Christus noch die Kirche fordern das. Im Gegenteil, sie lehnen es ausdrücklich ab, durch den Mund des Völkerapostels.
Schlußwort
Es handelt sich um ein altes Übel, geboren aus dem bequemen pharisäischen Gärstoff, der in jedem von uns schlummert. Wie einfach ist es doch, innerhalb eines geschlossenen Systems zu leben, das alles vorgibt – mit festen Regeln, die es ermöglichen, sich selbst und vor allem die anderen leicht zu beurteilen. Der Himmel in Ratenzahlung.
Doch Christus hat uns befreit zur Freiheit:
„Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft auflegen! Hört, was ich, Paulus, euch sage: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird Christus euch nichts nützen.“
(Gal 5,1–2)
Und wenn schon die Beschneidung, ein von Gott selbst an Abraham gegebenes Zeichen, nichts mehr gilt – wie viel weniger all diese „man muß“- und „du sollst“-Regeln?
„Denn in Christus Jesus kommt es nicht darauf an, beschnitten oder unbeschnitten zu sein, sondern darauf, den Glauben zu haben, der in der Liebe wirksam ist.“
(Gal 5,6)
Es ist der Glaube, die Sakramente und die in unserem Leben verwirklichte Liebe, die uns retten – nicht all diese leeren Forderungen und Albernheiten. Der Zorn des Apostels Paulus gegenüber den Unersättlichen seiner Zeit geht so weit, daß er sagt:
„Diese Leute, die Unruhe bei euch stiften, sollen sich doch gleich entmannen lassen.“
(Gal 5,12)
Diese Unersättlichkeit, diese Überforderungen, die Paulus zur Weißglut brachten, binden schwere Lasten und legen sie den Menschen auf die Schultern (Mt 23,4). Und diejenigen, die diese Lasten aufbürden – es sind viele in diesen Kreisen, und schlimmer noch: sie geben den Ton an –, sind es, die den Menschen das Himmelreich mit dem Schlüssel verschließen. Sie selbst gehen nicht hinein – und die, die hineingehen wollen, halten sie ab (Mt 23,13).
Sie durchziehen Land und Meer, um einen einzigen Proselyten zu machen, und wenn es ihnen gelingt, machen sie ihn doppelt zum Sohn der Hölle (Mt 23,15) – voller Feuereifer des Neubekehrten, dem es wichtiger ist, zur „alten Messe“ zu gehen, Modernismus zu bekämpfen und Rosenkränze zu häufen, als Nächstenliebe zu üben, wenn diese verlangt ist – ohne das andere zu vernachlässigen (Mt 23,23).
Die Messe, die liturgischen Formen, die ehrwürdigen Traditionen unserer Vorfahren – sie sind Gaben und Mittel zur Freiheit, um Christus zu begegnen und das göttliche Leben zu leben. Sie sind keine Fesseln, die uns an bestimmte Gesellschafts- oder Kulturmodelle ketten, die von manchen egoistisch vergötzt und sakralisiert werden.
Christus hat uns durch seine Gnade befreit – von der doppelten Knechtschaft des Gesetzes und des Gewissens –, damit wir Frucht bringen in Werken der Gerechtigkeit, nicht aus Zwang und Pflicht, sondern aus Liebe und Freiwilligkeit – als freie Kinder Gottes, nicht als Sklaven der Sünde.
Diese religiöse Unersättlichkeit ist ein sicheres Mittel, diese Gaben zu sterilisieren, und ein schweres Sakrileg, denn sie macht das Göttliche und Heilige zur Quelle von Sünde und Verdammnis.
Kehren wir zu Gott zurück, mit einem zerknirschten und demütigen Herzen, wie der Zöllner im Gleichnis, mit dem Glauben des Hauptmanns – damit wir würdig sind, zum Altar des Herrn zu treten.
*Der Spanier Eck publiziert auf dem Blog von Caminante Wanderer.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Caminante Wanderer



