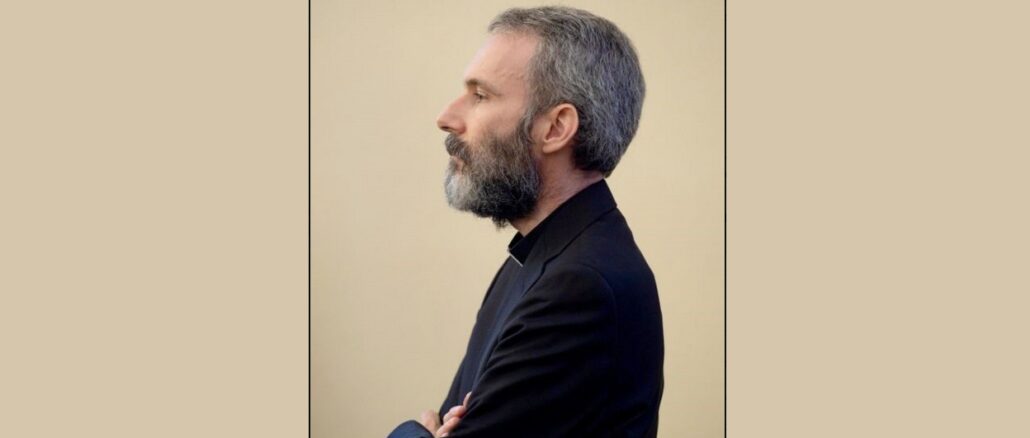
Carlo Alberto Capella, einst Diplomat an der Apostolischen Nuntiatur in Washington, sorgt erneut für Schlagzeilen, dieses Mal in der Washington Post. Der 58jährige italienische Priester war wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornographie verurteilt worden. Nach seiner Haftentlassung 2022 wurde er unter Papst Franziskus überraschend wieder in den Dienst der vatikanischen Staatssekretariats aufgenommen – ein Schritt, der heftige Kritik von Opferschutzgruppen hervorrief, die damit nun erneut Zugang zu führenden Medien erlangten, die den Druck auf Leo XIV. erhöhen.
Der Fall Capella war 2017 öffentlich geworden, als bekannt wurde, daß US-Behörden über zwei Jahre gegen ihn ermittelt hatten. Trotz eines Antrags des US-Außenministeriums auf Aufhebung seiner diplomatischen Immunität verweigerte der Vatikan diese unter Verweis auf geltendes Recht und holte ihn stattdessen, wie es für Diplomaten aller Staaten der Fall ist, in sein Dienstgeberland zurück, konkret in den Vatikan. Dort gestand Capella vor einem vatikanischen Gericht die Tat, wurde 2018 zu fünf Jahren Haft verurteilt und saß diese im kleinsten Gefängnis der Welt ab – in der vatikanischen Haftanstalt, in der es nur drei Zellen gibt.
Nachdem er aufgrund von guter Führung in der ersten Jahreshälfte 2022 vorzeitig entlassen wurde, kehrte Capella mit Jahresbeginn 2023 zu einem Schreibtisch an der Römischen Kurie zurück. Sein Tätigkeitsbereich umfaßt vor allem Übersetzungen und Archivarbeit, direkten Kontakt zu Gläubigen oder die Ausübung priesterlicher Funktionen ist ihm verboten. Laut seinem Anwalt wurde ihm zudem der Ehrentitel „Monsignore“ aberkannt. Formell ist er weiterhin Teil des Staatssekretariats.
Diese Wiedereingliederung löste Empörung aus, besonders bei dem selbst nicht unumstrittenen Survivors Network of those Abused by Priests (SNAP). Der Vorwurf lautet: Ein verurteilter Täter, der kinderpornographisches Material konsumiert hat, habe im Vatikan keinerlei Rolle zu spielen. In der Tat wäre es denkbar, Capella ganz andere Aufgaben im Vatikan zu übertragen und nicht eine am Staatssekretariat oder an der Kurie.
Einige Organisationen sehen die Gelegenheit eines neuen Papstes, um mediale Aufmerksamkeit zu erreichen, was ihm auch gelungen ist. Seit dem Pontifikat von Johannes Paul II. trafen alle Päpste mehr oder weniger intensive Vorwürfe, zu wenig gegen sexuellen Kindesmißbrauch durch Kleriker unternommen zu haben. Dabei gab es allerdings deutliche Unterschiede. Während Benedikt XVI. von den USA aus mit internationalem Haftbefehl gedroht wurde, faßte man Franziskus mit Samthandschuhen an. Selbst Skandale wie der um Kardinal McCarrick, immerhin einst Erzbischof von Washington, schienen am argentinischen Papst abzuprallen. Dafür sorgten die meinungsführenden Medien, eben jene, die gegen Benedikt XVI. ganz andere Töne angeschlagen hatten.
Anfragen zur Tätigkeit von Capella bleiben von vatikanischen Stellen unbeantwortet, was an sich nicht weiter verwundert. Es gibt eine begründete Auskunftspflicht. Es gibt aber keine Verpflichtung, PR-Aktionen irgendwelcher Organisationen zu unterstützen.
Die Washington Post verweist auf einen hochrangigen anonymen Mitarbeiter des Vatikans, der betonte, daß Capella eine Tätigkeit ohne öffentlichen Kontakt ausübt und damit eine Chance zur „Wiedergutmachung“ erhalte. Gleichzeitig räumte er ein, daß einige Opferverbände dies nicht akzeptieren würden.
Parallel sorgt auch ein französischer Fall für Aufsehen: Dort wurde ein Priester, der 1993 wegen Vergewaltigung eines Jugendlichen verurteilt wurde, von einem Erzbischof zum Kanzler ernannt – mit der Begründung der zeitlichen Distanz und der moralischen Pflicht zur Vergebung. Auch hier fordern Opfergruppen Papst Leo XIV. zum Eingreifen auf.
Gleich nach der Wahl von Leo XIV. erfolgten geradezu konträre Reaktionen. Mißbrauchs-Experten stellten ihm ein sehr gutes Zeugnis aus, während einige Opferverbände ihn durch Vorwürfe unter Druck zu setzen versuchten. Vor allem SNAP wurde in der Vergangenheit vorgeworfen, viel Selbstdarstellung und Eigenpromotion zu betreiben.
Der Fall Capella illustriert natürlich ein grundlegendes Dilemma der katholischen Kirche. Die Inszenierung durch interessierte Kreise, als sei das sexuelle Mißbrauchsproblem ein vorrangiges Problem der Kirche, will gezielten Druck erzeugen und auch von anderen Schauplätzen ablenken. Tatsache ist jedoch, daß es das Problem gibt und mit den auch von bestimmten kirchlichen Seiten geförderten gesellschaftlichen Umbrüchen seit dem kirchlichen wie weltlichen 68er Jahr zusammenhängt. Für die Kirche kommt noch das Problem hinzu, wie die Lehre von Barmherzigkeit und Buße mit der berechtigten Forderung nach Gerechtigkeit und Opferschutz vereint werden kann?
Mit dem Fall Capella wurde die Frage nach dem Umgang mit Mißbrauchstätern auch Leo XIV. auf den Schreibtisch geknallt. Wird er, wie der von den Medien unterstützte Franziskus, das eigentliche Problem ausklammern oder beim Namen nennen? Mindestens 80 Prozent aller Mißbrauchsfälle durch Kleriker betreffen homosexuellen Mißbrauch. Die Mißbrauchsgeißel, die die Kirche quält, ist ein homosexuelles Problem. Das verschwieg Franziskus und das verschweigen ganze Bischofskonferenzen, darunter die deutsche und die belgische.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: VaticanMedia (Screenshot)



