
Von Roberto de Mattei*
Die Cholera, die Europa im 19. Jahrhundert heimsuchte, hatte 1817 ihren Ausgang an den Ufern des Ganges in Indien genommen. Der Weg der Krankheit war langsam, aber unaufhaltsam. Die Pandemie breitete sich auf China und Japan aus, drang in Rußland ein und strahlte von dort in die skandinavischen Länder, nach England und Irland aus, von wo aus sie in den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts mit Auswandererschiffen nach Amerika gelangte und zur Geißel für Kanada, die USA, Mexiko, Peru und Chile wurde. 1831 kam sie von Rußland über Österreich und Preußen auch in den Deutschen Bund.
1832 erreichte sie Paris, dann Spanien und erreichte schließlich im Juli 1835 in Nizza, Genua und Turin Italien. Der Historiker Gaetano Moroni (1802–1883) bezeichnete sie in seinem berühmten Dizionario di erudizione, parlando del distruggitore e desolante flagello del Cholera morbus, indiano o asiatico („Wörterbuch der Gelehrsamkeit, das vom Zerstörer und der trostlosen Geißel des Morbus Cholera oder der indischen oder asiatischen Cholera spricht“) als „Pest“, die er wie folgt definierte:
„Pest bedeutet jede Art von Geißeln, göttlicher Bestrafung, die allen heilsame Angst und Furcht einflößt und hartnäckige Sünder zur wahren Buße mit bewundernswerten Auswirkungen erschüttert, da die Sünden die beständige Quelle aller Widrigkeiten sind.“[1]
Gregor XVI., 1831 auf den päpstlichen Thron gewählt, sandte 1835 eine Ärztekommission nach Paris, um eine wissenschaftliche Darstellung der Krankheit zu erhalten, deren Art unbekannt war, und um festzustellen, ob die Cholera eine ansteckende oder eine epidemische Krankheit war. Beim ersten Auftreten der Krankheit war es nämlich zu einer hitzigen Debatte zwischen zwei medizinischen Schulen gekommen, den „Ansteckungsverfechtern“ und den „Epidemisten“. Die „Ansteckungsverfechter“ waren der Ansicht, daß die Ausbreitung der Krankheit durch direkten oder indirekten Kontakt mit den Kranken erfolgte und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung folglich in der Einrichtung von Isolationsgebieten und Quarantäne bestehen sollten. Die „Epidemisten“ behaupteten hingegen, daß die Ursachen der Krankheit bei den schlechten hygienischen Bedingungen und in den Miasmen der Atmosphäre zu suchen sind, weshalb sie gegen Maßnahmen der Isolation und Quarantäne waren, da es unmöglich sei, die Luftzirkulation zu verhindern.[2] Im Allgemeinen neigten die monarchistischen Regierungen zur ansteckenden Hypothese, während die Liberalen und die Carbonari, die alle Initiativen, die die individuellen Freiheiten beschnitten, als tyrannisch betrachteten, die epidemische Hypothese unterstützten. Als die Krankheit das Königreich Beider Sizilien erreichte, verbreiteten sie die Nachricht, die Cholera sei durch die bourbonische Regierung mittels Gift verbreitet worden.
Papst Gregor XVI., der in der Enzyklika Mirari vos vom 15. August 1832 den Liberalismus verurteilt hatte, neigte zur ansteckenden Hypothese. Am 12. August veröffentlichte die vom Papst eingerichtete Gesundheitskongregation das Dokument Verordnung und Verfahren zur Aktivierung der Isolation[3], um die Ein- und Ausreise von Personen und die Ein- und Ausfuhr von Dingen, die auf irgendeine Weise die Ansteckung übertragen und verbreiten konnten, an den Grenzen der Kirchenstaaten und in einige Gebieten im Inneren derselben zu verhindern.
Die zwei überwachten Linien, die „infizierte“ Linie und die „gesunde“ Linie, bestanden aus einem Sicherheitsstreifen von der Breite einer Meile. Eine Reihe von Wachposten kontrollierten diese Linien und verhinderten jeden Zugang streng. Zwischen den beiden Absperrungen waren mindestens drei Häuser vorgesehen, in denen die Menschen vierzehn Tage in Quarantäne zu verbringen hatten. Dem Edikt waren weitere Auflagen beigefügt, darunter die Verwendung von „Gesundheitspässen“, die an jene ausgestellt wurden, die dann frei zirkulieren konnten, und die sofortige und vollständige Abschottung der Gemeinden ermöglichte „wo als Gipfel der Katastrophe das Böse ausbrechen würde“. Es wurde zudem angeordnet, sollte die Krankheit trotz aller Vorsichtsmaßnahmen in einen Teil der Stadt eindringen, daß „die Straßen verbarrikadiert“ werden sollten und für Nahrung für die dort ansässige Bevölkerung zu sorgen war. Schließlich wurde an die schweren Strafen erinnert, mit denen Verstöße gegen diese Bestimmungen bestraft würden: lebenslange Gefängnishaft bei Mißachtung der Absperrungen und die Todesstrafe für schuldhafte Ansteckung anderer.[4]
Die Cholera hatte Rom noch nicht getroffen, dennoch veröffentlichte am 20. September 1836 Antonio Domenico Kardinal Gamberini, Innenminister der Kirchenstaaten, ein Edikt, in dem er im Namen von Gregor XVI. verkündete, daß, „um alles zu tun, was die menschliche Klugheit rät“ und „um die Invasion der Krankheit weniger schädlich zu machen“, sollte „diese als Strafe für unsere Sünden für uns vorgesehen sein“, in Rom eine „außerordentliche Kommission für die öffentliche Unversehrtheit“[5] eingerichtet wird. Sie stand unter dem Vorsitz von Giuseppe Kardinal Sala und bestand aus sechs Mitgliedern, drei Ordensleuten und drei Laien, die von einem Ständigen Ärzterat[6] beraten wurden.
Rom wurde in 14 Gesundheitszonen unterteilt, die den Stadtvierteln entsprachen, und jede mit einer Sonderkommission aus Ärzten, Chirurgen und Krankenschwestern ausgestattet. Jede Kommission hatte die Aufgabe, für saubere Straßen, den Verkauf von Lebensmitteln und Getränken, Hilfe für die Armen und Versorgung der Cholera-Erkrankten zu sorgen. Die Apotheken hatten für die Kranken kostenlose Medikamente zur Verfügung zu stellen, während die Ärzte täglich die Fälle zu registrieren hatten. Der Priester Don Gioacchino Pecci, der zukünftige Papst Leo XIII., der im selben Jahr in Theologie und kanonischem Recht promoviert wurde, hatte Kardinal Sala als Assistent bei seiner Mission als Aufseher aller Krankenhäuser der Stadt zu unterstützen.
Am 7. Januar 1837 gab die von Gregor XVI. eingesetzte Militärkommission bekannt, daß sechs Personen zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, weil sie den Cordon Sanitaire durchbrochen hatten. Am 14. Januar wurde unter zahlreichem Protest ein Edikt erlassen, mit dem die Abhaltung des historischen Karnevals von Rom verboten wurde. Am Aschermittwoch erinnerte Kardinal Odescalchi die Römer, „durch Fasten, Gebet und andere Werke der Frömmigkeit den Zorn des Allmächtigen besänftigen zu wollen, um die Geißeln fernzuhalten, die uns bedrohen.“
Im Juli 1837 wurden in Rom die ersten Cholera-Fälle gemeldet. Die öffentliche Meinung teilte sich in jene, die die Existenz einer Epidemie anerkannten, und jene, die sie bestritten. Die Cholera breitete sich zwischen Juli und September weiter aus. Während liberale Kreise weiterhin das Gerücht ausstreuten, daß die päpstliche Regierung die Krankheit absichtlich verbreiten würde, befahl Gregor XVI., die Isolationslinien zu verstärken und alle Feste und Kirchtage und jede Art von Ansammlungen auszusetzen. Die Milizen wurden mobilisiert, Grenzen und Häfen geschlossen und die Kavallerie angewiesen, auch die entlegensten Orte zu überwachen.
Am 6. August fand eine feierliche Prozession mit der dem heiligen Lukas zugeschriebenen Ikone Salus populi Romani von der Basilika Santa Maria Maggiore bis zur Jesuskirche des Jesuitenordens statt, wo das wundertätige Bild acht Tage lang ausgestellt wurde. Der Gottesmutter, die von einer Abordnung berittener Dragoner begleitet wurde, huldigten auf dem Weg der Papst und das heilige Kardinalskollegium sowie die römische Regierung.
Die Chroniken dokumentieren die Buße und Aufopferung der Diözesan- und Ordensprieser und die „evangelische Hingabe des Papstes, der nicht zögerte, dorthin zu gehen, wo die Krankheit am meisten wütete, und auch persönlich auf die geistigen und materiellen Bedürfnisse der Opfer einzugehen“[7]. Zu den Priestern, die sich durch heldenhafte Hilfeleistung für die Kranken und durch Beistand für die Sterbenden auszeichneten, gehörten der heilige Vinzenz Pallotti und der heilige Gaspare del Bufalo. Nach dem Diario di Roma vom 28. Juli bis 9. Oktober 1837 waren in der Ewigen Stadt 8.090 Menschen von Cholera betroffen. 4.446 von ihnen starben. Am 28. Dezember starb auch der heilige Gaspare del Bufalo. Bei seinem Tod war der heilige Vinzenz Pallotti anwesend und sah, daß seine Seele wie eine Flamme zum Himmel aufstieg. Unter jenen, die in milderer Form von der Cholera betroffen waren, befand sich der Benediktinerabt von Solesmes, Dom Prosper Guéranger, der in Rom war, um die offizielle Genehmigung seiner Klostergründung zu erhalten. Nach seiner Genesung und der Anerkennung durch Gregor XVI. versuchte Dom Guéranger nach Frankreich zurückzukehren, aber sein Biograph sagt, daß die Verbindung zwischen den Kirchenstaaten und dem Rest der Welt unterbrochen war und der Hafen von Civitavecchia und alle Straßen blockiert waren. Erst am 4. Oktober gelang es Dom Guéranger den Staat des Papstes zu verlassen und nach einer endlos scheinenden Reise schließlich Paris zu erreichen.[8] In der Zwischenzeit verschwand die Epidemie langsam und am 15. Oktober wurde in den drei Patriarchalbasiliken San Giovanni in Laterano, dem Petersdom und Santa Maria Maggiore sowie in allen Pfarrkirchen zum Dank für das Ende der Cholera feierlich das Te Deum gesungen.
Zwölf Jahre später, 1849, suchte der Sturm der Römischen Republik die Stadt Rom heim, der weitaus schlimmer wütete als die Cholera-Epidemie und eine neue Etappe im revolutionären Prozeß darstellte, der bis in unsere Tage andauert. Erst 1884 wurde von Robert Koch die für die Cholera verantwortliche Vibrionen-Art identifiziert und im folgenden Jahr konnte der spanische Arzt Jaime Ferran den ersten Impfstoff dagegen herstellen.
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017 und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen2011.
- Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Der Vortrag wurde beim Rome Life Forum 2020 (20.–22. Mai) gehalten, das wegen der staatlichen Corona-Maßnahmen nur virtuell stattfinden konnte. Siehe auch „Die Eucharistie, der größte Schatz der Kirche, in Zeiten der Drangsal“ von Weihbischof Athanasius Schneider.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana
[1] Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica (Wörterbuch der historisch-kirchlichen Gelehrsamkeit), Tipografia Emiliana, Venedig 1840–1861, Bd. 52, S. 219.
[2] vgl. Eugenia Tognotti: Il mostro asiatico. Storia del colera in Italia (Das asiatische Monster: Geschichte der Cholera in Italien), Laterza, Rom–Bari 2000.
[3] Regolamento e metodo per l’attivazione dei cordoni sanitari.
[4] s. Marcello Teodonio, Francesco Negro: Colera, omeopatia ed altre storie, Rom 1837 (Cholera, Homöopathie und andere Geschichten, Rom 1837), Fratelli Palombi, Rom 1988, S. 38–39.
[5] Commissione straordinaria di pubblica incolumità.
[6] Consiglio medico permanente.
[7] Paolo Dalla Torre: L’opera riformatrice ed amministrativa di Gregorio XVI (Das erneuernde und administrative Wirken von Gregor XVI.), in: Gregor XVI., Pontificia Università Gregoriana, Rom 1948, Bd. 2, S. 70.
[8] s. Dom Guy-Marie Oury: Dom Guéranger, moine au coeur de l’Église (Dom Guéranger, Mönch im Herzen der Kirche), Editions de Solesmes, 2000, S. 158–160.


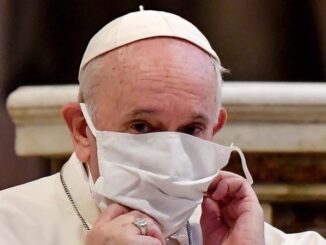
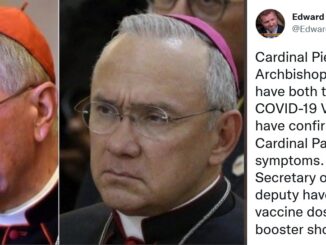
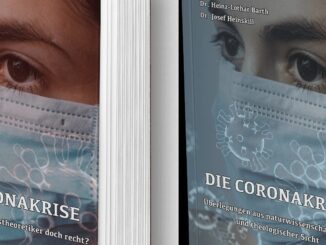
Mir scheint, hier drängt sich der Schluss auf, die empirische Wissenschaft habe im 19. Jahrhundert in Bezug auf die Cholera erreicht, was den Antimodernisten um Papst Gregor XVI nicht möglich war. Das versucht die öffentliche Berichterstattungen in unseren Zeiten nicht anders zu vermitteln.
Dagegen behaupte ich aus Überzeugung, Corona ist eine göttliche Strafe.