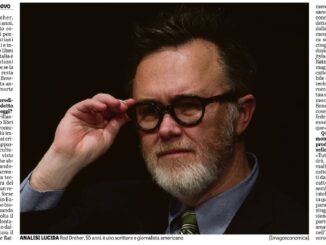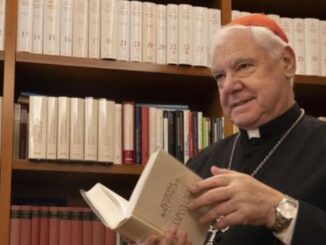(Rom) Am 15. Mai 1969 veröffentlichte die spanische Presseagentur EFE, die viertgrößte der Welt, die Meldung: „‚Sie verändern die Kirche in einem subversiven Prozeß.‘ Der Osservatore Romano spricht von rebellischen Katholiken“. Erstmals berichtete die Tageszeitung des Papstes über eine innerkirchliche Auflehnung, die sich nicht zu einer Einzelfrage äußerte, sondern von prinzipieller Natur war.
EFE meldete:
„Die vatikanische Tageszeitung L’Osservatore Romano beklagt heute, daß rebellische und kritisierende Katholiken den Erneuerungsprozeß der Kirche in einen subversiven Prozeß umwandeln. Sie attackieren nicht nur, was in der Kirche einer Änderung bedarf, sondern greifen auch ihre Fundamente, ihre Hierarchien und ihre Ordnung an, so die Zeitung.“
Anlaß für den Artikel der „Tageszeitung des Papstes“, damals regierte Papst Paul VI., war ein Treffen von „Priester-Dissidenten“ in Turin, das in der Vorwoche stattgefunden hatte, „um gegen das zu protestieren, was sie den Autoritarismus der Kirche nennen“.
„Man nimmt an, daß es sich um den ersten Vorfall dieser Art in Italien handelt, einem Land, in dem der Klerus generell konservativer ist, als in anderen Ländern Europas“, so EFE.
Der Osservatore Romano schrieb:
„Es fällt schwer, zu glauben, daß die Nachrichten von diesem Aufbegehren den Tatsachen entsprechen, weil solche Erklärungen sehr nach einem Mangel an Glauben und an Liebe für die Heilige Mutter Kirche klingen.“
Und weiter:
„Andererseits ist unschwer in dem unglücklichen Protest ein Echo jener Tendenzen zu erkennen, die sich in den Gruppen und Fraktionen der Hyperkritiker und Unduldsamen ausbreiten, die das Konzept der ‚Erneuerung‘ an die Grenzen zur ‚Subversion‘ treiben, wie der Heilige Vater sehr beklagte. Umgestürzt werden soll nicht nur, was in der Kirche verbessert werden kann, sondern auch die Fundamente ihrer Verfassung, das übernatürliche Verständnis ihrer Ordnung und ihrer Disziplin.“
Es gebe eine Auflehnung gegen die Autorität. Nach außen sei die Kritik zwar wenig sichtbar, doch wo sie erkennbar sei, zeige sie eine substantielle Leugnung der Autorität in ihren Fundamenten.
Die Probleme des katholischen Priestertums „in unserer Zeit“, seien zwar nicht zu leugnen. Die Lösung könne aber nicht sein, die Verbundenheit in der brüderlichen Einheit des Klerus zu kappen, oder die Verbundenheit zwischen den Priestern und der Hierarchie oder zwischen dem Klerus und den Gläubigen.
Der Osservatore Romano erinnerte zudem an eine „jüngst“ gemachte Aussage von Papst Paul VI.:
„Die wahre Jugend der Kirche wird nicht erreicht durch die Säkularisierung oder Liberalisierung des kirchlichen Lebens. Es sei vielmehr notwendig, innerhalb der Kirche „das Wehen des lebendigmachenden Geistes wiederzubeleben, ein Leben des Gnadengebets zu fördern und sich in Liebe, Gehorsam und Heiligkeit zu üben“.
Die rebellierenden Priester behaupten, „sie wollen auf ‚ihre Privilegien‘ und damit auf die ‚Herrschaft über die Gemeinschaft‘ und das Schema ‚unserer klassischen, klerikalen Kultur‘ verzichten“. Stattdessen fordern sie „die Freiheit, zu arbeiten, zu denken, zu schreiben, einen Beruf auszuüben, sich in Gewerkschaften einzuschreiben“. Das seien alles Forderungen, so die Tageszeitung des Papstes, „die mehr eine Verweltlichung als eine Sublimierung des Priestertums zu scheinen wollen“.
Dazu stellte die Zeitung einige Fragen:
Welche Freiheit könnte dem Priester verweigert werden, die seinem Auftrag als Diener Gottes und seiner Persönlichkeit als Hirte entspricht? „Und was heißt ‚Herrschaft über die Gemeinschaft‘“, wenn der Auftrag des Priesters darin besteht, „das gläubige Volk zu unterweisen, zu heiligen und zu führen?“
Die Zeitung äußerte die Hoffnung, daß es sich bei dem beklagten Turiner Treffen von Priesterrebellen um eine „begrenzte Episode“ handelt, die durch einen mehr ‚krankhaften‘ als ‚unduldsamen‘ Geist verursacht worden sei.
Soweit der Artikel.
50 Jahre später weiß man, daß sich diese Hoffnung nicht bewahrheiten sollte. Mit dem Treffen von Turin wurde eine subversive Rebellion im Klerus sichtbar, die ansonsten im Verborgenen wühlte. Innerkirchliches Rebellentum ist in der Regel nicht nur in der Zielsetzung, sondern auch in der Methodik subversiv.
Die Türen dazu hatte das Zweite Vatikanische Konzil aufgestoßen, woran ein halbes Jahrhundert danach kein Zweifel mehr bestehen sollte. Die Einberufung des Konzils öffnete – lange vor dem 68er-Jahr – ein Ventil. Seither wird die Kirche die Plagegeister nicht mehr los, die ihre höchsten Repräsentanten selbst gerufen haben.
Das Problem ist: Die Kirche hat nicht nur den Schaden, es will für den Schaden auch keiner verantwortlich sein. Beide Päpste, die am Ventil drehten, wurden zu den Altären erhoben. Es heißt, die Welt sei immer ein Spiegelbild der Kirche (oder umgekehrt die Kirche ein Spiegelbild der Welt?), entsprechend zeigt sich die heute grassierende Realitätsverweigerung nicht nur außerhalb, sondern auch innerhalb der Kirche.
Und nicht zuletzt: Da die Kirche ihrem Wesen nach hierarchisch verfaßt ist, sind ihre Gebrechen, die im Gegensatz zum Klimawandel tatsächlich menschengemacht sind, zuallererst und immer Ausdruck eines Versagens von oben und nicht von unten.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Faro di Roma (Screenshot)