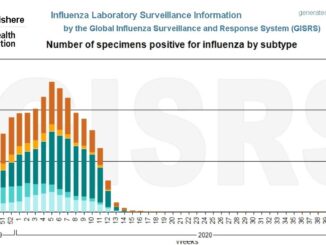(Rom) Die italienischen Eheleute Emilio und Maria Antonietta Biagini wurden gemeinsam zu den Autoren eines historischen Romans, der nichts weniger als die Geschichte Österreichs erzählt. Was ist daran besonders? Einiges. Der erste Band liegt nun vor.
Dem italienischsprachigen Publikum wird eine breite Darstellung der österreichischen Geschichte geboten, die für den Leser garantiert viel Unbekanntes und Neues präsentiert. Das ist nicht ohne Bedeutung, da sich die Nachbarn Österreich und Italien noch vor hundert Jahren in einer „Erbfeindschaft“ gegenüberlagen, was auch die Geschichtsschreibung nicht unbeeinflußt ließ.
Seither hat sich viel getan, und es fehlt nicht an Publikationen, die den alten Hader überwunden haben, als die italienische Nationalbewegung das deutsch geprägte, aber übernationale Gebilde namens Österreich noch als das Haupthindernis ihrer Verwirklichung betrachtete. Das nach dem Ersten Weltkrieg kleingemachte Österreich, dem kaum mehr als die Hälfte seiner deutschen Bewohner angehörte, geschweige denn noch andere Völker, die sich alle selbständig machten, wurde von Rom mehr gönnerhaft behandelt als ernst genommen. Der Vatikan bemühte sich um Milde gegenüber der einstigen katholischen Vormacht.
Und dann ist da immer noch die Südtirol-Frage, von der heute wegen der verordneten Globalisierung viele nichts mehr wissen wollen, was sie aber nicht aus der Welt zaubert.
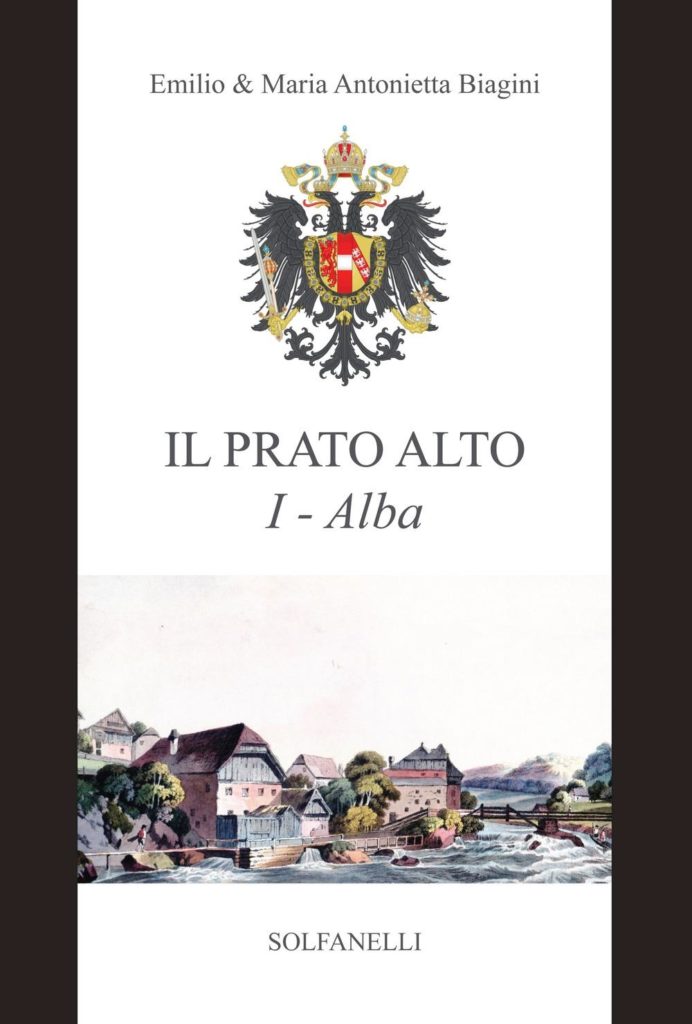
In dieses gewandelte Klima, in diesem Fall tatsächlich und ganz auf der menschlichen Ebene „menschengemacht, stößt das Buch des Autorenduos hinein, und das auf höchst erfreulich Weise, soweit es zumindest den nun vorliegenden ersten Band betrifft. Er trägt den Titel „Alba“ und meint die Morgendämmerung Österreichs. Der Band umfaßt den für die menschliche Vorstellungskraft kaum faßbaren Zeitraum von 7500 vor Christus bis 1233 nach Christus.
Die Eheleute Biagini sind in Italien als Publizisten und Vortragende einem katholischen Publikum bekannt durch Romane, aber auch Essaybände, etwa die gemeinsam verfaßten Bücher „Die häßlichsten Geschichten. Wie erzählt man den Enkelkindern die Lügen der Zeitgeschichte“ („Le storie più brutte“) oder „Klerikale Satiren“ („Satire clercali“), die sich auf ironische Weise der aktuellen Gebrechen in der Kirche annehmen. Die nun veröffentlichte Darstellung der österreichischen Geschichte kommt nicht nur ohne alte, nationalistische Seitenhiebe aus, sondern auch ohne die neuen ideologischen Verrenkungen, die nicht selten einen antichristlichen Zungenschlag verraten.
Der für den ersten Band gewählte Zeitraum umfaßt die über weite Strecken quellenarme Ur- und Frühgeschichte, die mühsam interdisziplinär erschlossen werden muß. Vieles ist diesbezüglich im Dunkeln und wird es wohl auch bleiben. Da mag man vielleicht auch nicht allem zustimmen, was im Buch dargelegt wird. Emilio Biagini, der an den Universitäten Genua und Cagliari Geographie lehrte, kennt das von ihm behandelte Gebiet durch viele Reisen jedenfalls aus eigener Anschauung, und das offensichtlich sogar sehr gründlich. Dabei muß wohl eine Liebe zu diesem Land in den Alpen und an der Donau entstanden sein, die seine Frau mit ihm teilt. Mit ihr wählte er das Genre eines Romans, wohl um der Trockenheit einer fachspezifischen Abhandlung zu entgehen und ein möglichst großes Publikum mit auf die Reise in die Vergangenheit zu nehmen. Trotz dieser Weichenstellung steckt das Buch voller Gelehrsamkeit und ist kenntnisreich gefüllt mit historischen Fakten, die nicht nur für eine italienische Leserschaft viel Interessantes über Entwicklungen und Verwerfungen der Geschichte, über Menschen, Völker und Sprachen, über Brauchtum, Nahrung und Sitten enthüllen.
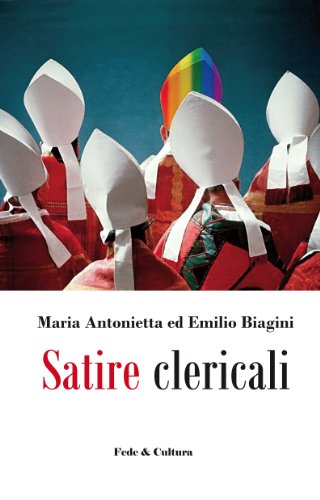
An dieser Stelle entfalten sich die philologischen Kenntnisse des Ehepaars, das gründlichen Einblick vor allem in sprachliche Entwicklungen bietet, akribisch die vollzogenen Volks- und Sprachwechsel dokumentiert und kaum den Namen einer Stadt oder einen Begriff ohne etymologische und semantische Anmerkungen in den Text einfließen läßt. Das Spektrum schließt nicht nur die allgemein bekannten keltischen Bewohner und den Einfluß der lateinischen Sprache mit ein. Im Buch findet sich ebenso das Vaterunser auf Gotisch und auf Altbairisch. Es geht um Skiren, Quaden, Markomannen, Rugier, Heruler, Vandalen, Burgunden und natürlich Alemannen und Franken, um den Reigen der germanischen Völker zu vollenden, die seit Christi Geburt am anderen Donauufer saßen und auf ihre Gelegenheit warteten, Österreich formen zu können. Dazwischen traten einige Zeit die Awaren auf, die von ihrem Zentrum zwischen Donau und Theiß im heutigen Ungarn ihren Machtbereich nach Westen ausstreckten, und mit ihnen die Slawen. Während die Awaren wieder verschwanden, sind die Slawen geblieben, zunächst im Norden, Osten und Süden. Ihren Platz im Osten, der einstigen karolingischen Ostmark, weder zu verwechseln mit Ostarichi noch mit Hitlers „Ostmark“, nahmen dann die Ungarn ein.
Und überhaupt: So einfach war das natürlich nicht mit der Formung Österreichs. Wer und was dafür alles notwendig war, das schildert das besprochene Buch unter Betonung des alles entscheidenden Beitrags des Christentums – im Roman emblematisch in der Figur des heiligen Severins kristallisiert –, der heutzutage gerne in Abrede gestellt oder heruntergespielt wird. Das Christentum zivilisierte die germanischen Völker und befähigte sie, selbst zu Trägern der Zivilisation zu werden. Wer glaubt, es wäre alles Positive der vergangenen 1.500 Jahre ohne diese christliche Umwandlung genauso erfolgt, oder gar meint, es würde heute ohne Christentum gehen, der sollte sich lieber nicht täuschen. Echte Zivilisation ist christlich oder gar nicht. Ein ideologisch unbefangener Blick in das Buch der Geschichte liefert den vielfältigen Beweis.
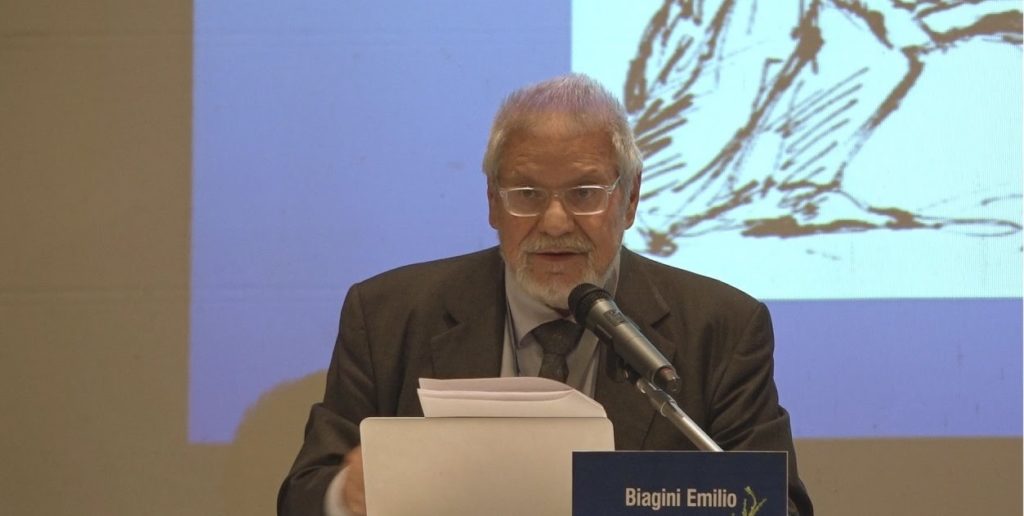
Die beiden Autoren verstehen es, lebendig zu schreiben, und das mit einem guten Schuß Ironie und nicht ohne gelegentliche Seitenhiebe auf die grassierende politische Korrektheit. Geschildert wird die Zeitreise anhand der fiktiven Familie Adler und ihrer Verzweigungen, Abenteuer, Eheschließungen und Todesfälle. Es ergießt sich eine schnelle Abfolge von ernsten und heiteren, tragischen und komischen Ereignissen. Im Mittelpunkt steht das kleine Bergdorf Wiesenberg, von dem der Roman seinen Namen hat, italienisch „Prato alto“. Die Angehörigen der Familie Adler durchleben und durchleiden die Geschichte Österreichs, sie kämpfen für das christliche Europa und stehen sogar vor Jerusalem. Es ist eine Geschichte von Mut und Verrat, und selbst der Gang ins Exil bleibt ihnen nicht verwehrt, aber sie finden immer wieder zurück nach Wiesenberg. Da führt der Weg geradezu zwangsläufig vom ersten Einritzen eines Adlers in den Balken der familieneigenen Blockhütte über das blutverschmierte Hemd eines Kreuzritters zum Wappentier und der Fahne des heutigen Österreichs. Dazwischen liegen Hunderte von historischen Fragen, die durch das Autorenpaar beantwortet werden. Nur so können wir wirklich verstehen, warum bestimmte Entwicklungen in der Geschichte geschahen, wie sie geschehen sind, und nicht anders.
An der Donau kann man sich freuen, in dem Autorenduo Emilio und Maria Antonietta Biagini sympathische Bannerträger für Österreich bekommen zu haben.
Emilio und Maria Antonietta Biagini: Prato Alto, Alba, Edizioni Solfanelli, Chieti 2019, 424 Seiten, ISBN-978–88-3305–089‑8.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Solfanelli/MiL