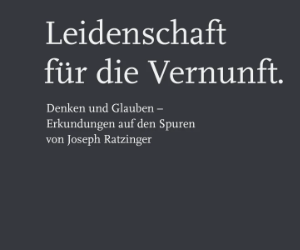Gestern ist der Filmregisseur Bernardo Bertolucci verstorben. Er wurde 77 Jahre alt. Bekannt wurde er durch Spielfilme wie „Der letzte Tango in Paris“, „Der letzte Kaiser“ oder „Der große Irrtum“. Zahlreiche Medien trauern heute um ihn. Das hat seinen Grund und verlangt nach einem etwas anderen Nachruf.
Bernardo Bertolucci stammte aus Baccanelli, einem Ortsteil im Südwesten von Parma, einer Stadt, die nach dem Krieg fest in der Hand der kommunistischen Partei war. Geboren wurde er 1941. Auch Bertolucci bekannte sich ein Leben lang zur politischen Linken. Seine nennenswerten Filme haben zwei Schwerpunkte, die seine Phantasie beflügelten: Sex & Revolution.
In einem Interview für die Internet-Zeitung Quotidiano.net sagte er am vergangenen 6. Mai: „1964 zeigte ich in Vor der Revolution einen bürgerlichen Kommunisten, der gegen eine erstarrte Partei polemisierte, die gegenüber dem Neuen verschlossen war.“ Das war keine grundsätzlich Kritik, sondern bestenfalls der Ansatz einer innerlinken Kritik an der kommunistischen Partei
Wie der fast gleichaltrige Liedermacher Fabrizio De André in seinem Album „Storia di un impiegato“ (Geschichte eines Angestellten) entfaltete auch Bertolucci linke Machtphantasien. So wie De André Zeit seines Lebens Anarchist war, war Bertolucci Kommunist. „Vielleicht ist das das Laster der italienischen Cineasten“, so der Kulturkritiker Rino Cammilleri. Gérard Depardieu sagte einmal von ihnen, daß sie „alles Kommunisten mit Häusern“ sind. Mit Häusern meinte er verschwenderische Villen, mit denen sie ihren Reichtum und ihren gesellschaftlichen Status zur Schau stellen, sich aber zur Linken bekennen.
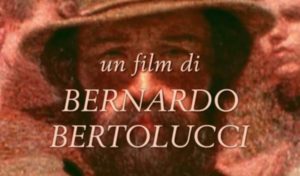
Sex & Revolution ist der stilistische Schlüssel zu vielen seiner Filme, einschließlich seinem vorletzten: „Die Träumer“ (2003), in dem die Hauptfiguren Doktor spielen im aufgewühlten Paris des Jahres 1968. Sein Hauptwerk, der Film „1900“ (Novecento) von 1976, zeigt einen alten Burt Lancaster als Grundherr neben einem ebenso alten Sterling Hayden, der einer seiner Angestellten ist. Ersterer lädt ein, auf die Geburt seines Enkels anzustoßen, was Letzterer aus Klassenhaß ablehnt.
Die nächste Szene zeigt den Grundherren, wie er einem sehr jungen Mädchen, der Tochter seiner Angestellten, eindeutige Avancen macht. Als sie sich in kindlicher Art darüber lustig macht, erhängt er sich. Eine Welt ohne Sex lohnt es nicht, zu leben.
Später sieht man den reichen Robert De Niro, der in einer Rollenverteilung aus klassenkämpferischer Perspektive natürlich Faschist wird, und den armen Gerard Depardieu nackt mit der Prostituierten Stefania Casini im Bett. Eine Ménage-à-trois, die explizit gezeigt wird.
Der Film beginnt mit einer Szene, die einem bewaffneten, kommunistischen Partisanen zeigt, der ein Partisanenlied singt und Jagd auf Faschisten und deutsche Soldaten macht. Gezeigt wird ein Idyll mit „Hoch Stalin“-Rufen. Plötzlich schießt ein bewaffneter Faschist auf ihn. Der blutüberströmte, sterbende Partisan fragt: „Warum?“ Umgekehrt wäre die Szene dieses Bürgerkrieges für Bertolucci undenkbar gewesen.
Der fünf Stunden dauernde Film will dem Arbeiterkampf des 20. Jahrhunderts ein Denkmal setzen und endet mit der Machtübernahme der Kommunisten, zumindest in der Gegend der Emilia, in der er spielt. Die rote Fahne ist das Symbol, mit dem der Film schließt.
Was als Schlußszenen gezeigt wird, war die Zeit, als kommunistische Partisanen Selbstjustiz übten, und nach neueren historischen Studien mindestens 25.000 Menschen ermordeten: Faschisten, Kollaborateure der Deutschen, politische Gegner aller Art, vor allem Katholiken und nicht-kommunistische Partisanen, kurzum alle, die der angestrebten Nachkriegsordnung als Sowjetrepublik unter der Führung Moskaus im Wege stehen konnten. Die ganzen persönlichen Rechnungen, die beglichen wurden, erst gar nicht erwähnt. Zum Vergleich: Das faschistische Regime von Benito Mussolini ließ während seiner 20jährigen Herrschaft durch einen Sondergerichtshof in Italien „nur“ 42 politische Gegner hinrichten. Die Opfer der „Kampfzeit“ vor der Machtübernahme sind darin nicht berücksichtigt.
Die Kommunisten und ihre Nachfolger wollen heute nicht mehr an ihre Morde bei Kriegsende und danach, an jene Zeit, die Bertolucci in seinem Film verherrlicht, erinnert werden. Soweit so verständlich. Sie verbreiten allerdings das Märchen, als Partisanen für Freiheit und Demokratie gekämpft zu haben, also als Demokraten gegen „Nazifaschisten“. Eine glatte Lüge.
In dem Film kommt auch die bezeichnende Szene vor, wo sie zu ihm sagt: „Schwöre, mich immer zu lieben, aber nie zu heiraten“.

Bertoluccis erfolgreichster Film ist zweifelsohne „Der letzte Kaiser“ (1987), der mit neun Oscars ausgezeichnet wurde. In die Filmgeschichte ging der Regisseur allerdings vor allem wegen „Der letzte Tango in Paris“ (1972) ein. Er brachte ihm sogar eine Verurteilung wegen Schamlosigkeit ein. Der Film wurde für mehrere Jahre beschlagnahmt, was die Medien erst recht aufmerksam machte und dazu führte, daß selbst jene in die Kinosäle rannten, um ihn schließlich zu sehen, die ihn sonst verpaßt hätten. Die berüchtigte „Butterszene“ mit Marlon Brando wurde so „populär“, daß in manchen Kreisen der schlechte Geschmack vorherrschte, Neuvermählten zur Hochzeit ein Stück Butter zu schenken. Die damals 19 Jahre alte Hauptdarstellerin Maria Schneider, Tochter des französischen Schauspielers Daniel Gélin, der als Araber verkleidet am Beginn des Hitchcock-Films „Der Mann, der zuviel wußte“, niedergestochen wird, sagte später, daß sie von dieser Szene negativ gezeichnet blieb und überhaupt vom ganzen Film, in dem sie nackt zu sehen ist. Sie starb 2011 im Alter von erst 58 Jahren, ohne jemals noch in einem erwähnenswerten Film mitgespielt zu haben. Für Marlon Brando, der sich damals längst auf dem unaufhaltsam scheinenden Abstieg befand, bedeutete der Film hingegen einen unverhofften Karriereschub. Bertolucci hatte für die Rolle ursprünglich an Jean-Paul Belmondo und Jean Louis Trintignant gedacht. Der eine wie der andere lehnte ab. Erst dadurch kam der Regisseur zum bereits abgehalfterten Brando.
Bertolucci, der im Herzen von Jugend an Kommunist war – nicht von ungefähr begann er seine Karriere als Regieassistent von Pier Paolo Pasolini – wurde erst 1969, im Alter von 38 Jahren, eingeschriebenes Mitglied der Kommunistischen Partei Italiens (KPI), als deren Aufstieg zur Macht unaufhaltsam schien. Inzwischen sind es viele, die nicht mehr an ihre Militanz für Sichel und Hammer und Roten Stern erinnert werden wollen. Die meisten Medien ersparen ihnen diesbezüglich jede Peinlichkeit, gehören zahlreiche Journalisten ja selbst zu dieser Spezies. Als eine Tageszeitung, Il Giornale, von orthodoxen und nicht orthodoxen Linken in den 70er Jahren als „Faschistenblatt“ verschrien, Bertolucci vor einigen Jahren dennoch darauf ansprach, sagte er ausweichend nur, sein Parteiausweis sei „langsam vergilbt … Mitte der 80er Jahre habe ich ihn nicht mehr erneuert“. Es kamen neue Zeiten. Moskau war auf der Verliererspur. Bertolucci drehte 1990 „Himmel über der Wüste“ und 1994 „Little Buddha“. The Oxford History of World Cinema schrieb zu letzterem: „Ein unerwartet ruhiger, gelassener Film, aus dem Klassenkampf und verquälte Sexualität verbannt sind“.
2007 erhielt Bertolucci in Venedig den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk, immerhin ein Preis, der noch von Benito Mussolini gestiftet wurde und ursprünglich Coppa Mussolini hieß. Wegen seiner „faschistischen“ Wurzeln war er zwischen 1969 und 1979 nicht mehr verliehen worden, just in der Zeit als Bertolucci KP-Mitglied war, und das Gesamtklima nach links zu kippen schien.
2008 wurde ihm auf dem Walk of Fame des Hollywood Boulevard in Los Angeles ein Stern gewidmet. In seinem Klassenkampf-Epos „1900“ ließ er den jungen, bewaffneten Leonidas (Partisanenname „Olmo“), noch ein Kind, Symbol der neuen Generation der kommunistischen Zukunft, mit proletarischem Stolz die Lockrufe seines Grundherrn abweisen, daß es in Amerika besser sei (als in der Sowjetunion).
Text: Andreas Becker
Bild: Archive.org/Novecento (Screenshot)