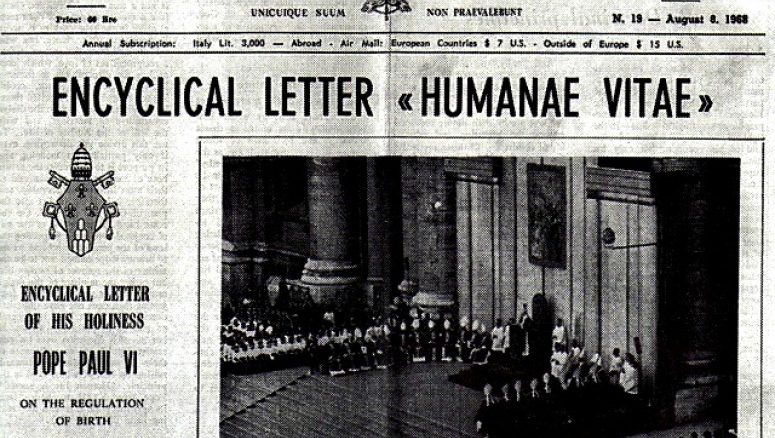
(Rom) Was Papst Franziskus „große Angst“ in der Priesterausbildung macht, und das Lob des Papstes für den Theologen Bernhard Häring (1912–1998), einen der schärfsten Kritiker der Enzyklika Humanae vitae, sind zwei erstaunliche Dinge, die ein Gesprächsprotokoll enthält, das soeben veröffentlicht wurde. Das Gesprächsprotokoll gibt die Begegnung des Papstes mit den Oberen des Jesuitenordens wieder, die am 24. Oktober in Rom stattfand.
Lob für Humanae vitae oder für Bernhard Häring?
Ein Teil dieses Protokolls wird als neues Beispiel für einen päpstlichen Zick-Zack-Kurs interpretiert, nämlich das Lob von Franziskus für den vor 18 Jahren gestorbenen deutschen Redemptoristenpater und Theologen Bernhard Häring.
Bekannt wurde Häring vor allem durch seine harte Kritik an der „prophetischen“ Enzyklika Humanae vitae von Papst Paul VI. aus dem Jahr 1968. Mit dieser Enzyklika verurteilte Paul VI. die sich damals ausbreitende Verhütungs- und Abtreibungsmentalität. Diese Enzyklika, mit der die Bischöfe des deutschen Sprachraums bis heute auf dem Kriegsfuß stehen, wurde zur Grundlage des „Evangeliums des Lebens“ von Papst Johannes Paul II. Für sein Festhalten an der kirchlichen Morallehre griff Häring auch Johannes Paul II. wiederholt an.

Papst Franziskus lobte Humanae vitae am 5. März 2014 in seinem Interview mit dem Corriere della Sera als „prophetisch“. Am 16. Januar 2015 verteidigte er Paul VI. und „seine Enzyklika“, ohne sie namentlich zu nennen, bei seiner Begegnung mit den Familien in Manila auf den Philippinen: „Er schaute auf die Völker der Erde und sah diese Bedrohung der Zerstörung der Familie durch Kinderlosigkeit. Paul VI. war mutig, er war ein guter Hirte und warnte seine Schafe vor den kommenden Wölfen.“
Am 24. Oktober 2016 lobte Franziskus hingegen einen der schärfsten Kritiker dieser Enzyklika.
Härings Morallehre steht in offenem Widerspruch zur Enzyklika Veritatis splendor. Bereits wegen seines 1972 erschienenen Buches „Heilender Dienst. Ethische Probleme der modernen Medizin“ leitete die Glaubenskongregation Untersuchungen gegen Häring ein. Unter Kardinal Joseph Ratzinger folgte ein weiteres Lehrbeanstandungsverfahren.
Die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica berichtete in ihrer jüngsten Ausgabe über die 36. Generalkongregation des Jesuitenordens, die im Oktober in Rom stattfand. Bei ihr wurde der venezolanische Jesuit Arturo Sosa Abascal zum neuen Generaloberen gewählt (s. „Schwarzer Papst“ mit „marxistischer“ Vergangenheit – Jesuiten haben neuen Ordensgeneral und Die marxistische Vermittlung des christlichen Glaubens – Von Arturo Sosa Abascal (1978), dem neuen Jesuitengeneral).
„Dekadente Scholastik“ – „Häring hat Moraltheologie wieder zum Blühen gebracht“
Im Rahmen der Generalkongregation besuchte Papst Franziskus, selbst Jesuit, am 24. Oktober die aus aller Welt versammelten Oberen seines Ordens. Franziskus hielt den Jesuiten zunächst eine Ansprache und stellte sich dann den Fragen seiner Mitbrüder. „Der Papst wollte weder, daß die Fragen vorher ausgewählt werden, noch wollte er sie vorab kennen.“ Die Civiltà Cattolica veröffentlichte nun ein umfassendes Gesprächsprotokoll dieser Begegnung, bei der Papst Franziskus auf Bernhard Häring zu sprechen kam. Dieser habe, so der Papst, die Moraltheologie wieder „zum Blühen“ gebracht.

La Civiltà Cattolica zitiert Papst Franziskus mit den Worten:
„Es war eine der Unterscheidung sehr ferne Moral. In jener Epoche herrschte ‚el cuco‘ [dt. das Schreckbild, der Butzemann], das Gespenst der Situationsethik … ich glaube, daß Bernhard Häring der Erste war, der begann, einen neuen Weg zu suchen, um die Moraltheologie wieder zum Blühen zu bringen. Natürlich hat die Moraltheologie in unseren Tagen große Fortschritte gemacht in ihren Überlegungen und in ihrer Reife. Inzwischen ist sie nicht mehr eine ‚Kasuistik‘.“
So antwortete Papst Franziskus auf die Frage eines Ordensoberen zur „Unterscheidung“ als Grundlage der Moral, über die der Papst so häufig spricht.
Franziskus kritisierte in seiner Antwort das, was er eine „dekatente Scholastik“ nennt. In dieser „dekadenten Scholastik“ sei seine Generation erzogen worden. Sie habe, so der Papst, in Moralfragen eine „kasuistische Haltung“ hervorgebracht. „Es war eine Moral, der die ‚Unterscheidung‘ fernlag“, Bernhard Häring „war der Erste“, der nach einem neuen Weg suchte, „die Moraltheologie wieder zum Blühen zu bringen“.
Allerdings zitierte Franziskus Paul VI. an anderer Stelle bereits falsch und strickte daraus eine „typisch kasuistische These“.
Häring, eine Schlüsselfigur des Zweiten Vatikanischen Konzils
Der deutsche Redemptorist Bernhard Häring war im Bereich eine Schlüsselfigur des Zweiten Vatikanischen Konzils. Er wandte das Prinzip der Nouvelle Théologie einer „Evolution des Dogmas“ auf die Moral an. Roberto de Mattei schrieb über diese „neue Moral“ Härings, daß sie letztlich „die Existenz eines absoluten und unveränderlichen Naturrechts leugnet“.
Häring, der damals in Rom an der Redemptoristenakademie Alfonsiana lehrte, wurde als „Experte“ zum Konzil hinzugezogen. Später wurde er Sekretär der Kommission, die sich mit der „modernen Welt“ befaßte, in der er, so de Mattei, zu einem Hauptbaumeister der Pastoralkonstitution Gaudium et spes wurde, besonders des Teils, der sich mit der Ehe befaßt.
Laut de Mattei kam es während der Ausarbeitung dieses Konzilsdokumentes zu einer harten Auseinandersetzung zwischen den beiden Minderheiten der Progressisten und der Traditionalisten zu Fragen der Zeugung und der Ehe. Als die progressive Richtung eine Verurteilung der „Pille“ befürchten mußte, gelang es ihr, angeführt von Häring, Papst Paul VI. zu überzeugen, die Frage der Verhütung aus dem Dokument auszuklammern.
Humanae vitae: der Zorn Härings und der Ungehorsam der deutschen Bischöfe
1968 veröffentlichte derselbe Papst dann aber die Enzyklika Humanae vitae, in der es unmißverständlich heißt, daß „jeder eheliche Akt von sich aus auf die Erzeugung menschlichen Lebens hingeordnet bleiben muß“ und empfängnisverhütende Mittel „immer unerlaubt“ und „in sich schlecht“ sind. Außerehelicher Geschlechtsverkehr wurde selbstverständlich verurteilt.

Damit zog sich Paul VI. explosionsartig den Zorn und die ganze Abneigung der Progressiven zu, die sich im Bereich der Moral weitgehend von ihm abwandten. Häring war einer ihrer Wortführer. Er setzte viel Energie ein, um Paul VI. scharf zu kritisieren, ebenso danach Papst Johannes Paul II., für dessen Verteidigung der kirchlichen Morallehre. Ob Abtreibung, Verhütung, außerehelicher Geschlechtsverkehr, wilde Ehe, Homosexualität: Es fanden sich immer neue Reizthemen, und die meisten kreisten um die Sexualität, um sich an der Kirche zu reiben. Den Ton gaben Theologen und Kleriker an, die dem Volk nach dem Mund redeten.
Härings war einer der entscheidenden Stichwortgeber für die Auflehnung der Bischofskonferenzen des deutschen Sprachraumes gegen Humanae vitae. Auf ihn beriefen sich damals die verschiedenen Kirchenvertreter für eine Haltung des Ungehorsams, die in den Erklärungen von Königstein, Maria Trost und Solothurn der Bischöfe der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und der Schweiz ihren Höhepunkt erreichte. Die Bischöfe waren es, die dem gläubigen Volk sagten, es müsse sich nicht an die päpstliche Weisung halten. Dieser Ungehorsam der deutschen Bischöfe wurde bis heute nicht zurückgenommen. Die drei Erklärungen, klaffende Wunden des Widerspruchs, wurden von den Bischofskonferenzen nie korrigiert.
Verurteilung durch die Glaubenskongregation
In den 70er Jahren begann die Glaubenskongregation gegen Härings Morallehre zu ermitteln, die in so offenem Widerspruch zu Humanae vitae stand.
Die erste Verurteilung Härings unterzeichnete Papst Johannes Paul II. 1979. Da sich Häring weigerte, seine irrigen Thesen zurückzunehmen, ist er verurteilt gestorben. Im progressiven Hochmut, wie er für die 70er Jahre charakteristisch war, stellte er sich vielmehr als „Opfer“ der Römischen Kurie dar.

Häring war am Alfonsianum in Rom Lehrer von Charles Curran, einem dissidenten Priester, der die Kirche für ihre Ablehnung der Abtreibung, der Verhütung und der Homosexualität angriff. Curran vertrat zur Homosexualität Anfang der 70er Jahre Positionen, wie sie homophile Kirchenkreise seit der Amtsübernahme von Papst Franziskus in der Kirche durchzusetzen versuchen. 1986 wurde Curran von der Glaubenskongregation verurteilt. Ihm wurde untersagt, an katholischen Einrichtungen zu lehren. Vor allem durfte er sich nicht mehr als „katholischer“ Theologe ausweisen.
Häring stand seinem Zögling im Verfahren vor der Glaubenskongregation bei. Häring sagte zur Verteidigung Currans spöttisch: „Wer befindet sich im Widerspruch zur Lehre der Kirche: die Kongregation oder Curran? Die Geschichte beweist unmißverständlich, daß sich das Heilige Offizium und die Inquisition zu wichtigen biblischen wie dogmatischen Themen nicht in Übereinstimmung mit dem Empfinden der Gläubigen und der Mehrheit der Theologen befand.“
Häring griff ebenso scharf den späteren Kardinal Carlo Caffarra an, heute einer der vier Kardinäle, die mit ihren Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia Papst Franziskus in Bedrängnis gebracht haben. Ins Visier Härings geriet Caffarra, weil der spätere Erzbischof von Bologna bereits damals standhaft die katholische Morallehre verteidigte.
„Das macht mir große Angst“ – Der volle Wortlaut der Papst-Antwort an die Jesuiten
Die gesamte Passage zur „Unterscheidung“, Bernhard Häring und dem, was Franziskus „große Angst“ macht, im Wortlaut. Die Empfehlungen des Papstes an die Jesuitenoberen:
Frage: In seiner Rede haben Sie uns eindeutig eine Moral nahegelegt, die auf der Unterscheidung gründet. Wie empfehlen Sie uns im Bereich der Moral in Bezug auf diese Dynamik der Unterscheidung in moralischen Situationen vorzugehen? Mir scheint, daß es nicht möglich ist, daß wir bei einer subsumptiven Interpretation der Norm stehenbleiben, die sich darauf beschränkt, die besonderen Situationen als Fälle der allgemeinen Norm zu sehen …
Papst Franziskus: Die Unterscheidung, die Fähigkeit zu unterscheiden, ist das Schlüsselelement. Und ich stelle gerade den Mangel an Unterscheidung in der Ausbildung der Priester fest. Wir laufen in der Tat Gefahr, uns an „schwarz oder weiß“ zu gewöhnen und an das, was legal ist.
Wir sind ziemlich verschlossen, generell, gegenüber der Unterscheidung. Eines steht fest: Heute ist in einer bestimmten Menge von Seminaren wieder eine Strenge eingezogen, die einer Unterscheidung der Situationen nicht nahesteht. Und das ist eine gefährliche Sache, weil sie uns zu einem Verständnis der Moral führen kann, die einen kasuistischen Sinn hat. Wenn auch mit unterschiedlichen Formulierungen wäre das immer auf dieser selben Linie. Das macht mir große Angst. Ich habe das bereits in einer Begegnung mit den Jesuiten in Krakau beim Weltjugendtag gesagt. Dort haben mich die Jesuiten gefragt, was die Gesellschaft [Jesu] tun könne, und ich habe geantwortet, daß eine ihrer wichtigen Aufgaben die ist, die Seminaristen und Priester zur Unterscheidung auszubilden.
Ich und jene aus meiner Generation – vielleicht nicht mehr die Jüngeren, aber meine Generation und einige der Nachfolgenden – wurden zu einer dekadenten Scholastik erzogen. Wir studierten mit einem Handbuch der Theologie und der Philosophie. Das war eine dekadente Scholastik. Zum Beispiel, um das „metaphysische Kontinuum“ zu erklären – ich muß immer lachen, wenn ich mich daran erinnere – wurde uns die Theorie der puncta inflata [1]Der Papst bezieht sich hier auf Theorien und Diskussionen am Beginn des 17. Jahrhunderts, in die auch Jesuiten, darunter Rodrigo und Arriaga, involviert waren; Anm. La Civiltà Cattolica. beigebracht. Als die große Scholastik begann an Höhe zu verlieren, trat jene dekadente Scholastik an ihre Stelle, mit der zumindest meine Generation und andere studiert haben.
Es war diese dekadente Scholastik, die eine kasuistische Haltung hervorbrachte. Und es ist kurios: die Materie „Bußsakrament“ an der Theologischen Fakultät wurde normalerweise – aber nicht überall – von Professoren der Sakramentenmoral unterrichtet. Der ganze Moralbereich wurde auf das „man darf“, „man darf nicht“, „bis da ja, bis dort nicht“ reduziert. In einer Prüfung ad audiendas [2]Dabei handelt es sich um eine Prüfung, die in der Gesellschaft Jesu in Gebrauch ist, die dazu dient, die Fähigkeit eines Priesteramtskandidaten zu prüfen, die Beichte zu hören; Anm. La Civiltà … Continue reading sagte ein Studienkollege, dem eine ziemlich verwickelte Frage gestellt wurde, in aller Schlichtheit: „Aber bitte, Vater, solche Dinge passieren in der Wirklichkeit doch gar nicht!“ Und der Prüfer antwortete: „Aber in den Büchern schon!“
Es war eine Moral, die der Unterscheidung sehr fern war. In jener Epoche herrschte el cuco [dt. das Schreckbild, der Butzemann, Anm. Katholisches.info], das Gespenst der Situationsethik … ich glaube, daß Bernhard Häring der Erste war, der begonnen hat, einen neuen Weg zu suchen, um die Moraltheologie wieder zum Blühen zu bringen. Natürlich hat die Moraltheologie in unseren Tagen große Fortschritte gemacht in ihren Überlegungen und in ihrer Reife. Inzwischen ist sie nicht mehr eine „Kasuistik“.
Im Bereich der Moral muß man vorrücken, ohne in einen Situationismus zu fallen, andererseits ist dieser große Reichtum, der in der Dimension der Unterscheidung enthalten ist, wiederzuerwecken; und das ist gerade die große Scholastik. Wir stellen eine Sache fest: Der heilige Thomas [von Aquin] und der heilige Bonaventura sagen, daß das allgemeine Prinzip für alle gilt, aber – das sagen sie ausdrücklich – in dem Maß, in dem man in Details geht, unterscheidet sich die Frage und bekommt Schattierungen, ohne daß das Prinzip sich ändern muß. Diese scholastische Methode hat ihre Gültigkeit. Das ist die moralische Methode, die der Katechismus der Katholischen Kirche angewandt hat. Und es ist die Methode, die im jüngsten apostolischen Schreiben Amoris laetitia angewandt wurde nach der Unterscheidung, die von der ganzen Kirche durch zwei Synoden gemacht worden war. Die in Amoris laetitia angewandte Moral ist thomistisch, aber jene des großen heiligen Thomas, nicht die des Autors der puncta inflata.
Es ist offenkundig, daß man im Bereich der Moral mit wissenschaftlicher Strenge vorgehen muß und mit Liebe für die Kirche und mit Unterscheidung. Es gibt bestimmte Punkte der Moral, zu denen man nur im Gebet das nötige Licht erhalten kann, um durch theologische Überlegung weitergehen zu können. Und was das betrifft, erlaube ich mir zu wiederholen: man muß „Theologie auf den Knien“ machen. Man kann Theologie nicht ohne Gebet betreiben. Das ist ein Schlüsselaspekt, und man muß es so machen.
Die Worte von Papst Franziskus über Bernhard Häring haben neue Befürchtungen geweckt, daß die Enzyklika Humanae vitae überwunden werden soll, und ebenso die Enzyklika Veritatis splendor, mit der Johannes Paul II. der Situationsethik Härings einen Riegel vorgeschoben hat.
Der wirre und verwirrende Zick-Zack-Kurs von Papst Franziskus wird durch die Veröffentlichung der Civiltà Cattolica um ein weiteres Kapitel reicher. Der Papst lobt Humanae vitae als „prophetisch“ und lobt zugleich Bernhard Häring, einen der schärfsten und giftigsten Kritiker von Humanae vitae.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL/Zenit/CR (Screenshots)
-
| ↑1 | Der Papst bezieht sich hier auf Theorien und Diskussionen am Beginn des 17. Jahrhunderts, in die auch Jesuiten, darunter Rodrigo und Arriaga, involviert waren; Anm. La Civiltà Cattolica. |
|---|---|
| ↑2 | Dabei handelt es sich um eine Prüfung, die in der Gesellschaft Jesu in Gebrauch ist, die dazu dient, die Fähigkeit eines Priesteramtskandidaten zu prüfen, die Beichte zu hören; Anm. La Civiltà Cattolica |

