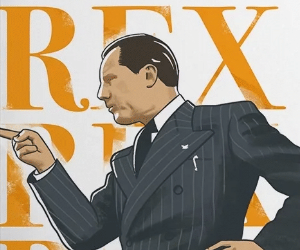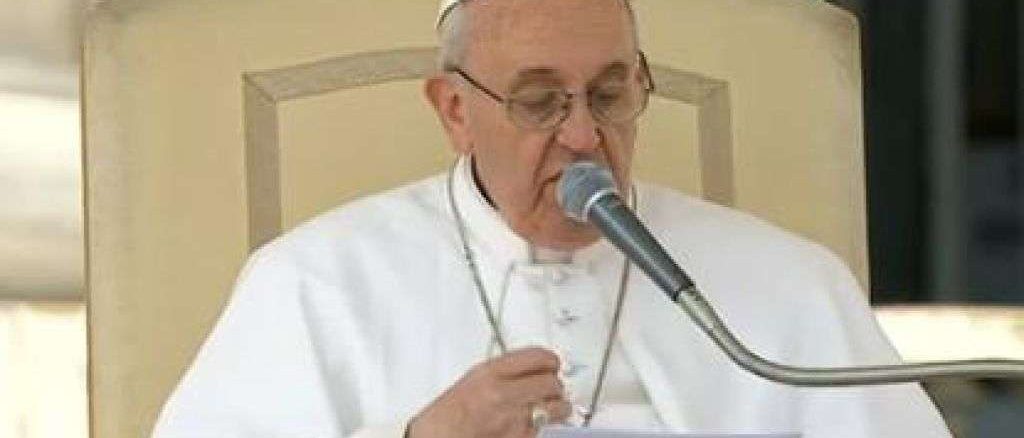
Liebe Brüder und Schwestern,
das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter erklärt uns, was Nächstenliebe bedeutet: Drei Menschen, ein Priester, ein Levit und ein Samariter kamen an einem Mann vorbei, den Räuber überfallen und halbtot liegengelassen hatten.
Obwohl die ersten beiden regelmäßig ihren Dienst im Tempel versahen und die Gesetze Gottes kannten, gingen sie einfach vorüber. Ein vermeintlicher, oberflächlicher Glaube lebt weder die wahre Liebe zu Gott, noch zum Nächsten. Der Samariter endlich, der den Juden als unzuverlässiger Ausländer galt, hielt beim Verletzten an. Er blieb nicht nur Zuschauer, sondern „hatte Mitleid“ (Lk 10,33). Das Herz des Samariters war verbunden mit dem Herzen Gottes, der auch mit uns Menschen Mitleid hat. Mitleid haben heißt, im Innersten ergriffen sein angesichts des Elends des anderen. Wie der Samariter lässt sich Gott von unserer Not berühren. Er wendet nicht den Blick von uns ab, er kennt unsere Schmerzen und ist uns immer nahe. Auch wir sollen die Verpflichtung erkennen, dem Notleidenden nahe zu sein, uns mit ihm zu identifizieren. Genau das bedeutet: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (V. 27). Am Ende des Gleichnisses erwies sich nur der vielfach verachtete Samariter als Nächster, als einer, der dem Notleidenden nahe war. Wir alle sollen ein Herz haben, das zum Mitleid fähig ist, und so zu einem Nächsten für Menschen in Not werden.
Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache, insbesondere an die Pilgergruppe aus dem Bistum Bozen-Brixen mit ihrem Bischof Ivo Muser. Ich grüße auch euch, liebe Jugendliche, die ihr so zahlreich zugegen seid. Ich möchte euch ermutigen, im Alltag die vielfältigen Gelegenheiten zu erkennen, um ein Nächster zu werden, einer, der dem Leidenden nahe ist. Macht es wie der Barmherzige Samariter. Gott segne euch alle.