Von Amand Timmermans
Vor genau hundert Jahren, im Jahr 1916, während in Verdun und an der Somme die gewaltigste Vernichtungsschlachten an der Westfront des Ersten Weltkriegs tobten, erschien im Inselverlag ein kleines Büchlein mit einer Auslese von Gedichte des flämischen Priester-Poeten Guido Gezelle.
Die Übersetzung stammte von Rudolf-Alexander Schröder, laut Kolophon damals beim Deutschen Kulturdienst in Brüssel (Belgien) tätig.
Guido Gezelle wurde am 1. Mai 1830, wenige Monate vor der Lostrennung der südlichen (einst österreichischen) Niederlande vom Königreich Niederlande und der Ausrufung als Königreich Belgien, in einer armen Gärtnerfamilie in Brügge in Westflandern geboren. Von Jugend an mit einer zarten Gesundheit behaftet und häufig kränkelnd, konnte er nur unter großen Entbehrungen und fern von zu Hause auf einem Internat in der Provinz studieren.
1854 wurde er zum katholischen Priester geweiht.
Kurz war er Priesterlehrer am bischöflichen Kolleg in Roeselare (11. Klasse, sogenannte „Poesis“), ab 1859 dann sehr lange Vikar in der Grenzstadt Kortrijk und Geistlicher für Ordensschwestern („Englische Fräulein“) in Brügge.
Als Dichter war Gezelle ein Naturtalent.
In einer Zeit wo das Flämische/Niederländische in Belgien schwer unterdrückt wurde und der Volkssprache mit Verachtung begegnet wurde, wo zu gleicher Zeit von der Regierung wilder Liberalismus und Atheismus/Agnostizismus beworben wurde, und das flämische Volk kulturell darniederlag, strahlte Gezelles Dichtkunst durch ihre Meisterschaft und ihr europäisches Niveau über alles hinweg.
Gezelle katapultierte die flämische Dichtkunst von der Gosse in den Himmel
Bildlich gesprochen: Gezelle katapultierte die flämische Poesie von der Gosse bis in den hohen Himmel.

Seine Poesie ist gekennzeichnet durch genaue und empathische Naturbeobachtung und tiefste mystisch-religiöse Gefühle, beeinflußt von der altgriechischen und lateinischen (Horaz/Vergil), der hebräischen Bibel- sowie der deutschen, französischen und englischen (Longfellow) Poesie. Er spielte mit Bildern und Worten, mit Sprachen (Gezelle beherrschte teils aktiv, teils passiv insgesamt 15 Sprachen!), experimentierte mit Neologismen, Lautmalerei, mit Vers- und Strophenformen, und war beseelt von Idealismus für die flämische Sache. Er schuf eine vollkommene Synthese von Romantik und Impressionismus.
Guido Gezelle ist höchstwahrscheinlich der größte religiöse Dichter im Europa des 19. Jahrhunderts. Das katholische Flandern, besonders die Studentenbewegung und die kulturellen Vereine, haben Gezelle verehrt, gelesen und rezitiert.
Er wurde ab 1900 hoch geschätzt und übersetzt durch Engländer und Deutsche.
Nicht zuletzt von Seiten des belgischen Staates und atheistisch/agnostisch orientierten Liberalen, aber auch der belgischen kirchlichen Hierarchie wurde Gezelle argwöhnisch beäugt und ihm mit Neid, Kritik und Distanz begegnet.
Wie bei jedem großartigen Vorbild haben dann in den Nachfolgegenerationen nicht selten weniger begabte Literaten versucht, ihren Frust und ihre schlechte Laune an ihm zu kühlen.
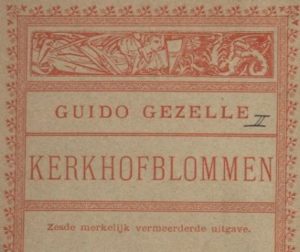
Gezelles zeitlose Poesie
Gezelles Poesie ist jedoch zeitlos und ungemein herrlich.
Es ist ein typisches Armutszeugnis unserer Zeit und nicht zuletzt des Mainstreams auch in sogenannten „christlichen“ Kreisen, daß die schönste und tiefste religiöse Dichtkunst kaum noch rezipiert wird.
Gerade in dem hochgradig entkirchlichten Nordbelgien, wo eine defekte Katechese und Sexualmißbrauch mit Vertuschung und Involvierung der kirchlichen Hierarchie zu einer beispiellosen allgemeinen Glaubensschwäche geführt haben, läßt sich dieses Desinteresse an Gezelles Poesie besonders bitter spüren.
Religiöse und kulturelle Verwahrlosung gehen Hand in Hand.
Das folgende Gedicht ist ein hervorragendes Beispiel von Gezelles Dichtkunst: Es basiert auf einem Zitat aus dem Hohelied Salomons (2,1) und aus nur zwei Worten in der lateinischen Vulgata: „Ego flos“ – „Ich (bin) eine Blume“.
Es entwickelt sich eine Ansprache, eine Bitte, fast ein mystisches Gebet zu Gott, dem Schöpfer, dem großen Licht, der Sonne, geprägt von Demut, von realistisch festgestellter Unvollkommenheit und von tiefster Sehnsucht nach dem Ewigen Leben, nach der vita venturi saeculi.
Gezelles Poesie entfaltet ihren Reiz erst wirklich, wenn sie rezitiert wird:
Optisch fallen schon die kurzen Zeilen auf (z.B. drei Worte/vier Silben). BeimVortragen kommen dagegen der Rhythmus, die Kadenz, die Tempiwechsel, die Alliterationen, die Antithesen und die Innen- und Endreime vollends zur Geltung.
Tiefes Naturempfinden und mystische Religiosität – poésie pure – und christlicher Glaube sind aufs Engste verbunden.
Ego Flos
(Canticum Canticorum II,1; Hohelied II,1)
Übersetzung von Rudolf Alexander Schröder, 1916
Bin eine Blume,
Blüh vor deinen Augen,
Gewaltig Sonnenlicht,
Das ewig einer Art
Mich nichtiges Geschöpf
Läßt Lebensfülle saugen,
Und nach dem Leben mir
Das ewige Leben spart.
Bin eine Blume,
Tu des Morgens öffnen,
Des Abends zu mein Blatt;
Und wiederum, wie dein
Heraufgestiegenes Licht,
O Sonne, mich getroffen,
Erwach ich oder schlaf
Gebeugten Hauptes ein.
Mein Leben ist
Dein Licht, mein Tun, mein Werben,
Mein Hoffen und mein Glück,
Mein Wissen und mein Recht:
Was kann ich ohne dich
Als ewig, ewig sterben,
Was habe ich ohne dich,
Das ich beminnen möcht?
Bin fern von dir,
Obschon du, süßer Bronnen
Von allem, das da lebt
Und Leben wiederschafft,
Mir nächst von allem nahst
Und zückst, o liebe Sonne,
Bis in mein tiefstes Herz
Den alldurchdringenden Schaft.
Wohlan, wohlauf!
Entbind mein‘ irdsche Banden,
Entwurzel mich, entgrab
Mich…, hinnen laß mich…, laß,
Wo allzeit Sommer ist
Und Sonnenschein, mich eilen,
Und wo du, Blume, blühst
Allschön ohn‘ Unterlaß.
Laß alles sein,
Vorbei, getan, vergeben,
Das Abschied zwischen uns
Und tiefe Klüfte spannt,
Laß Morgen, Abend, all
was hinnen muß, verschweben,
Laß dein unendlich Licht
mich schaun im Vaterland.
Dann werd ich vor…
O nein, nicht Dir vor Augen,
Doch nah, doch neben Dir,
Doch in Dir blühend stehn,
Wo du Dein arm Geschöpf
Läßt Lebensfülle saugen,
Wo in Dein ewig Licht
Mich lässest binnengehn.
Text: Amand Timmermans
Bild: Wikicommons/bibliotheek.nl

