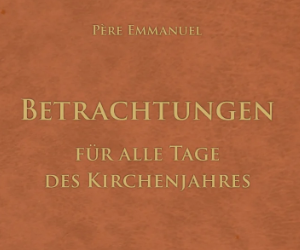(Paris) In vielen Gegenden im säkularisierten Europa findet eine regelrechte geistliche Versteppung statt. Emblematisch dafür ist die Berufungskrise in Frankreich. Die Zahlen sprechen für sich: 1966 gab es in Frankreich 4.536 Seminaristen. Nur wenige Jahre später, im Jahr 1975, war ihre Zahl auf 1.297 eingebrochen. Der Niedergang konnte dann verlangsamt werden, setzte sich aber fort. 1996 gab es 1.103 Seminaristen. Es folgte ein weiterer Einbruch: 2005 waren es nur mehr 784. 2011 wurde schließlich mit 710 Seminaristen der niedrigste Stand seit der Zeit der Französischen Revolution erreicht.
Wenn die Mathematik keine Meinung ist, ergibt das seit 1966 einen Rückgang von 84 Prozent. „Das ist das Ergebnis der von den modernistischen Theologen vorangetriebenen Wende, mit der sie den Sinn für das Übernatürliche zerstört haben. Die Zahlen sind von solcher Eindeutigkeit, daß sie jedem ‚modernen‘ Theologen die Schamesröte ins Gesicht treiben und ihn für immer in ein Bußschweigen verfallen lassen müßten. Jedenfalls bedürfen sie keines weiteren Kommentars!“, so der traditionsverbundene Blogger Cordialiter.
Gefragt ist eine ernste Analyse einer katastrophalen Situation. „Zahlen sind weder traditionalistisch noch modernistisch. Sie sind Fakten, die es gilt, zur Kenntnis zu nehmen“, so Cordialiter.
Die Lage in Frankreich ist dramatisch. In absehbar wenigen Jahren wird es in einigen Diözesen kaum mehr aktive Priester geben. Das Durchschnittsalter der Priester liegt in diesen Diözesen bereits heute bei 75 Jahren.
Schlüssel zur Berufungskrise wird in den Diözesen ignoriert
„Die Lage ist dramatisch ernst. Sie ist kein Grund, sich zurückzulehnen, aber auch kein Grund, zu verzweifeln“, so Cordialiter. Innerhalb der Berufungskrise lassen sich gegenläufige Tendenzen feststellen. Während der Diözesanklerus fast auszusterben droht, wachsen die Orden und Gemeinschaften des alten Ritus. Die Berufungen, die heute noch durchdringen, führen die jungen Männer dorthin, wo der Glauben, die Liturgie, die Treue zu Christus, zur Heiligen Schrift und zur Tradition ernst genommen werden.
„Die Hoffnung ist, daß weitere Seminare eröffnet werden, in denen es einer noch größeren Zahl an traditionsverbundenen jungen Männern ermöglicht wird, das katholische Priestertum anzustreben. Es sind die heiligen Priester, durch deren Vorbild die Berufungen heranreifen.“
Dort wo die heilige Liturgie ehrfürchtig und würdig zelebriert wird, dort wo die Lehre Christi getreu verkündet und die Ordnung der Kirche geachtet wird, finden sich auch heute Berufungen. Diese blühenden Oasen in der Wüste, die Gemeinschaften der Tradition, einige alte Klöster und einige neue Institute, sollten die ganze Aufmerksamkeit der Kirchenoberen finden, denn in ihnen liegt der Schlüssel verborgen, die Berufungskrise zu überwinden.
Erstaunlicherweise erweisen sich die diözesanen Kirchenleitungen als träge, desinteressiert oder sogar feindselig. „Das Dilemma ist, daß der Weg zur Überwindung der Berufungskrise vor aller Augen liegt, doch viele – und ich spreche nur von den Verantwortungsträgern – demonstrativ wegschauen.“ Man müsse den Eindruck gewinnen, sie wollten gar keine Verbesserung. Die Gründe dafür seien vielschichtig und reichen tiefer. Es sei nicht nur „Bequemlichkeit“ oder „Weltangepaßtheit“, sondern in vielen Fällen gehe es um eine „andere Theologie“. Um diese nicht in Frage stellen zu müssen, werde lieber der Niedergang der Priesterberufungen in Kauf genommen.
„Die Diözesanbischöfe tragen die Verantwortung dafür, wie in ihrer Diözese auf die Berufungskrise reagiert wird, ob das gute Beispiel ignoriert wird oder Nachahmung findet. Sie werden dafür einmal zur Verantwortung gezogen werden. Unabhängig davon schreitet die Auflösung des Diözesanklerus voran und es ist nur mehr eine Frage der Zeit, wann die Priesterweihen der Tradition jene des Novus Ordo überrunden werden, jedenfalls in Frankreich“, so Cordialiter.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: FSSP