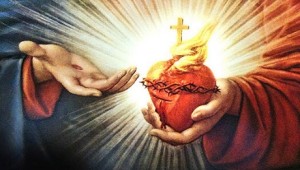Wenn man im Kontext des Disputs über die Liebe schreiben will, riskiert man viel. Gerade hier darf die Art der Rede den Inhalt nicht diskreditieren. – Von daher sind folgende Zeilen ein Wagnis.
Näherhin geht es um das Liebesgebot. John Lamont hat auf dem Blog Rorate-Caeli gegen Vatikanum II, Gaudium et Spes Nr. 24 den Vorwurf erhoben, hier würde mit der konkreten Kennzeichnung des Liebesgebotes bzw. der Liebesgebote (und hier beginnt schon das Problem) geradewegs gegen die Treue zum Herrenwort im Neuen Testament gesündigt.
Die faktische Bedeutung dieser Notiz für das Gespräch mit „den Traditionalisten“ (wobei sich Lamont gerade nicht der FSSPX oder deren Umkreis zurechnet) ist wohl eher gering zu veranschlagen. De jure handelt es sich jedoch um einen Vorwurf von enormem Gewicht. – Und ich möchte die Gelegenheit ergreifen, auf diesem Blog den Vorwurf wenigstens entschieden zu entkräften.
Denn: Wenngleich ich – vor dem Hintergrund der Causa FSSPX – stets für eine größere Offenheit in Sachen Vatikanum II plädiert habe, allerdings unter entschiedener Wahrung bestimmter „Untergrenzen“, so liegt mir im Gegenzug daran, nach Möglichkeit die tatsächliche Vertrauenswürdigkeit der Konzilsaussagen (eben auch anhand inhaltlicher Kriterien) herauszuarbeiten. Und so erfüllt es mich auch mit einem gewissen Unwillen, wenn immer wieder und dabei überflüssigerweise neue Hürden errichtet werden.
Und so eine Hürde sehe ich mit Lamonts Einspruch denn auch errichtet. – Wie lautet nun aber sein Einspruch? Das Konzil hatte an besagter Stelle (GS 24) so formuliert: „Deshalb ist die Liebe zu Gott und zum Nächsten das erste und größte Gebot.“ – Im Neuen Testament lesen wir aber (unter anderem) bei Matthäus (22,37–39): „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben … Dies ist das große [/ größte] und erste Gebot. Ein zweites aber ist diesem ähnlich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ – Hat somit nicht das Konzil die vom göttlichen Meister selbst vorgenommene Hierarchisierung verraten, indem es (schon schier blasphemisch) die Liebe zu Gott und zum Nächsten unter das „erste und größte Gebot“ subsumierte? Wird damit nicht dem säkularen Humanismus gehuldigt?
Ein Vorbild oder wenigstens einen Vorgänger für die formelhaft-gedrängte Ausdrucksweise des Konzils weiß ich nun, zumal in der Kürze der Zeit, nicht zu benennen. Aber, im Sinne eines methodisch vielleicht etwas einsilbigen, aber ebenso bewährten wie ergiebigen „Geht zu Thomas!“ („Ite ad Thomam!“) läßt sich nach meinem Dafürhalten das Recht der Ausdrucksweise des Konzils massiv erhärten, ohne daß dies Verrat bedeutet an jener Hierarchisierung, wie sie das Herrenwort deutlich einfordert.
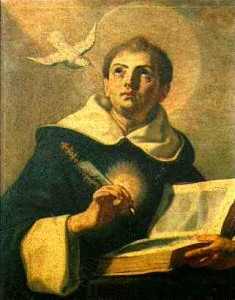
Nahezu vorexerziert bekommen wir die Antwort vom Aquinaten in dessen Summe, und zwar unter II/II, 44,2. Ich kann nur die gründlich-meditierende Lektüre empfehlen! Knapp läßt sich die Erläuterung des heiligen Thomas so zusammenfassen: Wie im Theoretischen die Reichweite („Kraft“) der Prinzipien mitumfaßt die Folgerungen, derer wir uns wegen unserer Begrenztheit eigens vergewissern müssen, so ist im Praktischen im Ja zum Ziel eo ipso mitgegeben das Ja zu dem, was auf das Ziel hingeordnet ist (wenn nämlich das Ja zum Ziel mit dem Nicht-Ja zu dem auf das Ziel Hingeordneten unvereinbar ist); entsprechend ist im Gebot zur Bejahung oder Realisierung des Ziels das Gebot zur Bejahung oder Realisierung des darauf Hingeordneten eingeschlossen, noch bevor letzteres ausdrücklich gemacht wird, und zwar mit Notwendigkeit ausdrücklich gemacht wird. Von daher Thomas‘ Resümee: „Und deshalb mußte nicht nur das Gebot über die Liebe zu Gott gegeben werden, sondern auch über die Liebe zum Nächsten, [und zwar] wegen denjenigen mit geringerer Fassungskraft, die nicht mit Leichtigkeit in Betracht ziehen würden, daß das eine dieser Gebote im anderen enthalten ist.“ – Ich zitiere noch das Ad-secundum und das Ad-quartum: „Gott wird im Nächsten geliebt wie das Ziel in dem, was auf das Ziel hin ist. Und dennoch mußten betreffs beiderlei [nämlich Liebe zu Gott und Liebe zum Nächsten] Gebote gegeben werden, aus bereits besagtem Grund.“ – „In der Liebe zum Nächsten ist eingeschlossen die Liebe zu Gott wie das Ziel in dem, was auf das Ziel hin ist, und umgekehrt. Und dennoch mußte jedes Gebot explizit gegeben werden, aus bereits besagtem Grund.“
Also: Mit Blick auf das Einschlußverhältnis (wonach Gottesliebe und Nächstenliebe – auf je andere Weise – einander einschließen) ist „das Liebesgebot“ ein einziges Gebot; hinsichtlich der Explikation sind es zwei Gebote. – Von daher: Wenn beziehungsweise insoweit die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten unter ein einziges Gebot fallen, ist dieses eine, beides umfassende Gebot auch das „erste und größte“; nicht wegen der gebotenen Nächstenliebe, sondern wegen der gebotenen Liebe zu Gott (in der ja jene finalisiert ist). – Wenn beziehungsweise insoweit es (hinsichtlich der Explikation) zwei Gebote sind, besteht ein hierarchisches Gefälle zwischen diesen Geboten, und dies gemäß dem unermeßlichen Hiat von Schöpfer und Geschöpf, höchstem Gut und daran bloß Teilhabendem: der Inhalt des Gebotes der Liebe zu Gott ist Ziel des Inhaltes des Gebotes der Nächstenliebe (so wie Summum-Bonum und das dessen Gleichnis Partizipierende [1]Konkret: Gottes seliger Selbstbesitz und die in der Gnade daran (aktuell oder potentiell) Teilnehmenden. sich zueinander als Ziel und Hin-auf-das-Ziel verhalten). Entsprechend steht der Inhalt des Gebotes der Nächstenliebe, insofern er präzis gegen den Inhalt des Gebotes der Liebe zu Gott abgehoben wird, und so dieses Gebot selber gemäß dem Wort unseres Herrn erst an zweiter Stelle, um dem ersten und größten Gebot (der Liebe zu Gott) nur ähnlich zu sein. – Ergo: Die sehr knappe Fassung in Vatikanum II GS 24 läuft in gar keiner Weise auf eine vermessene Verfälschung der Herrenworte zu den Grundgeboten der Liebe hinaus!
Da meine Notiz auf Knappheit angelegt ist, darf ich nicht überbordend werden. Aber man verzeihe mir, daß ich kaum widerstehen kann, noch aus dem Matthäuskommentar des hl. Thomas zu zitieren; just zur Stelle (22,38) hat er folgendes zu sagen:
„Nachdem Er dies [nämlich: ‚Du sollst den Herrn, Deinen Gott etc.‘] gesetzt hat, fügt Er bei: ‚Das ist das erste und größte Gebot.‘ Das größte dem Umfang nach: dieses nämlich ist es, in dem alle [Gebote] enthalten sind, da in diesem die Liebe zum Nächsten enthalten ist, demgemäß es in 1 Joh 4,21 heißt: ‚Wer Gott liebt, liebt auch seinen Bruder.‘ Und deshalb ist es das größte. Außerdem das erste dem Ursprung nach und das größte der Würde und dem Umfang nach …“
Selbstredend hindert dies den heiligen Thomas nicht, nachfolgend im Kommentar eigens auf die „Setzung“ des zweiten (Liebes-)Gebotes, des der Liebe zum Nächsten, einzugehen. Den theoretischen Unterbau bieten die Erläuterungen der Summe.
Einen Kommentar des Konzilstextes muß ich mir nun vollends ersparen: Nach Textcollage und Kontextierung mag man problematische Anknüpfungen an das Fluidum der sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts ausfindig machen, Tendenzen und Akzentuierungen, die sich längst nicht nur als fruchtbar, vielleicht sogar als verhängnisvoll erwiesen haben. Das mag so sein, und ich sage nicht, daß der Konzilstext „toll“ ist (wie ich ihn noch weniger vorschnell und vermessen disqualifizieren will). Ich will nur dokumentiert haben: Eine Apologie des Textes zugunsten seiner Treue zur Tradition und zumal zum Herrenwort ist möglich; möglich hinsichtlich dessen, was diese Worte strikt an ihnen selber besagen.
Damit endet denn auch mein knapper Debatteneinwurf. – Den Lesern des Forums möchte ich nun noch die Gelegenheit geben, sich zum Gebot der Liebe, wie der Scholastiker sagt, nicht nur in actu signato, sondern auch in actu exercito zu bekennen.
*Dr. theol. Klaus Obenauer ist Privatdozent für Dogmatische Theologie an der katholisch-theologischen Fakultät der Universität Bonn.
Bild: sspx.org/Iteadthoman
-
| ↑1 | Konkret: Gottes seliger Selbstbesitz und die in der Gnade daran (aktuell oder potentiell) Teilnehmenden. |
|---|