
(Rom) Alberto Melloni, der Leiter der Schule von Bologna und Msgr. Agostino Marchetto, der „beste Hermeneut des Zweiten Vatikanischen Konzils“ lieferten sich in diesen Tagen einen schriftlichen Disput zur Konzilsgeschichte mit aktuellem Bezug zur Bischofssynode. Wenn Ereignisse eine Bedeutung haben, dann ist es auch ein Signal, daß Melloni seine Ansichten im Corriere della Sera veröffentlichen konnte, Marchettos Antwort hingegen nicht dort veröffentlicht wurde. Ein Signal, daß die historische Aufarbeitung des Zweiten Vatikanischen Konzils noch längst nicht abgeschlossen ist.
Gilt die Maxime auch für die Kirche, daß der Sieger die Geschichte diktiert, würde das die Tabuisierung der Diskussion über das Zweite Vatikanum erklären. In der Kirche scheint sich aber auch eine zunehmende Scheu vor inhaltlicher Auseinandersetzung auszubreiten. Wieviel erst aufzuarbeiten ist, machte 2011 die vom Historiker Roberto de Mattei vorgelegte Konzilsgeschichte ebenso deutlich wie immer neu auftretende Fragen. Stattdessen wurde dem Konzil in der Nachkonzilszeit ein Deutungskorsett übergestülpt, das bis heute weitgehend eine kritische Auseinandersetzung verhindert. Das Korsett trägt den Stempel einer bestimmten Richtung, der„Rheinischen Allianz“ (siehe zur Gesamtfrage Roberto de Mattei: „Entdogmatisierung“ oder „Wer hat das Konzil verraten?“ und Das Konzil: Opfer gegensätzlicher Fraktionen? – Fragen zum Konzil klären, da es nicht zwei Kirchen geben kann).
Der Schule von Bologna fiel die Aufgabe zu, dieses Korsett mit ihrer Konzilsgeschichte festzuschreiben, die auch im deutschen Sprachraum als offizielle Konzilsdeutung gilt. Die deutsche Übersetzung des fünfbändigen Werks wurde von der Deutschen Bischofskonferenz finanziert. Zu den Gegenspielern dieser Schule gehört der Kirchenhistoriker Agostino Marchetto. Zur allgemeinen Verblüffung bezeichnete ihn Papst Franziskus im vergangenen Jahr in einem Schreiben als den „besten Hermeneuten des Konzils“. Eine „Nobilitierung“, die eigentlich seine Konzilsinterpretation zum Deutungsmaßstab erhebt (siehe „Schule von Bologna“ von „ihrem“ Papst verraten? – Papst Franziskus lobt „besten Hermeneutiker des Konzils“) und zu jenen widersprüchlichen Signalen des derzeitigen Pontifikats gehört, deren Interpretation vorerst offenbleiben muß.
Obwohl diese Aufwertung von Msgr. Marchetto einen vernichtenden Schlag ins Gesicht für die Schule von Bologna bedeutete, hält diese – zumindest nach außen – unbeeindruckt an ihrer Begeisterung für Papst Franziskus fest, den sie als „neuen Johannes XXIII.“ bezeichnet und in direkten Gegensatz zu den „rückwärtsgewandten“ Pontifikaten von Johannes Paul II. und Benedikt XVI. stellt, während man sich vom aktuellen Pontifex einen entscheidenden Schritt in einen progressiven „Frühling“ erwartet (siehe beispielsweise Progressiver Konzilshistoriker: Lampedusa-Predigt wie Eröffnungsrede des Konzils).
In diesen Kontext fällt ein schriftlicher Disput zwischen Alberto Melloni, den Leiter der Schule von Bologna und Msgr. Marchetto. Vordergründig geht es dabei um das Zweite Vaticanum und Papst Paul VI., in Wirklichkeit aber mehr um die Bischofssynode und das Jetzt und Heute. Der Vatikanist Sandro Magister faßte den jüngsten Deutungskonflikt zusammen.
.
Melloni zieht Paul VI. auf seine Seite, doch Marchetto ertappt ihn auf frischer Tat

von Sandro Magister
Wenn Professor Alberto Melloni bei der Darstellung des Zweiten Vaticanum versucht, zuviel Wasser auf seine eigenen Mühlen zu leiten, klopft ihm Monsignore Agostino Marchetto pünktlich auf die Finger, der Mellonis Rezensent ist, seit die „Bologneser“ ihre berühmte Interpretation des Konzils als verpaßte Revolution in den Ring geworfen haben.
Dieses Mal gab Melloni das seine im Corriere della Sera vom 21. Oktober zum Besten. Er jubelte darüber, wie sehr auf der soeben zu Ende gegangenen Synode das Spiel der Mehrheiten und Minderheiten eine Neuauflage der Konzilsschlachten bis zur letzten Stimme gewesen sei und damit „die Zukunft der katholischen Synodalität“ eröffnet worden sei, mit der Niederlage jener, „die davon geträumt haben“, den siegreichen Papst Franziskus „unterzukriegen“.
Marchetto nahm es aber nicht mit dem auf, was Melloni zum derzeitigen Papst sagte. Ihm stieß vielmehr auf, Papst Paul VI. in eine Reihe mit Don Giuseppe Dossetti [1]Giuseppe Dossetti, 1913–1996, war Jurist beider Rechte, Universitätsprofessor für Kirchenrecht, 1943–1945 Mitglied des antifaschistischen Befreiungskomitees CLN und führender Vertreter des linken … Continue reading gestellt zu sehen mit einem „also haben wir gewonnen“, das er den Papst nach einer Konzilsabstimmung sagen läßt, die vom damaligen Sekretär von Kardinal Giacomo Lercaro und Strategen der vier Moderatoren-Kardinäle organisiert worden war.

Paul VI. war alles andere als Dossettianer, widerspricht Marchetto Melloni. Tatsache sei vielmehr, daß der Papst nach jenen Ereignissen „kategorisch erklärte, daß er Dosetti nicht auf jenem Platz haben wollte; und dieser vielmehr nach Bologna zurückgehen solle“. Und so geschah es auch.
Die Reaktion Marchettos ging beim Corriere della Sera schon am Tag nach der Veröffentlichung von Mellonis Artikel ein und umfaßte einen ausführlichen, erklärenden Anhang zu den damaligen Konzilsereignissen.
Doch die Tageszeitung mit Sitz in der Via Solferino in Mailand veröffentlichte nichts, weder am nächsten Tag noch später. Es war die Tageszeitung Il Foglio, die Marchettos Gegendarstellung auf Veranlassung des Vatikanisten Matteo Matzuzzi abdruckte.
Der Corriere della Sera erklärte darauf, Marchettos Text nur als „private“ Antwort verstanden zu haben. Aber auch Melloni scheint das seine dazu getan zu haben, daß sie nicht veröffentlicht wurde, besonders seit Marchetto die offizielle Stellung des „besten Hermeneuten des Zweiten Vaticanums“ innehat, die ihm kein Geringerer als Papst Franziskus persönlich im November 2013 in einem Schreiben verliehen hatte.
Nachfolgend die Antwort Marchettos auf den Artikel Mellonis:
Der Brief Marchettos an den Corriere della Sera
Sehr geehrter Herr Chefredakteur,
in diesen Tagen der Seligsprechung von Paul VI. erlebe ich die „Rückgewinnung“ vieler, die seinerzeit gegen ihn geschrieben und gesprochen haben und dabei soweit gingen, in ihm sogar jenen zu benennen, der das Ökumenische Zweite Vatikanische Konzil versenken würde. Es würde genügen, sich die fünf Bände der Geschichte jenes Konzils anzuschauen, die von der sogenannten Schule von Bologna herausgegeben wurden.
Würde es sich um eine „historische Conversio“ handeln, könnte ich mich darüber freuen, doch der gestern in Ihrer Zeitung veröffentliche Artikel von Alberto Melloni zeigt mir, daß dem nicht so ist.
Das zeigt bereits die Art, wie er die „qualifizierte“ Minderheit zum künftigen Dei Verbum behandelt, die am Ende richtigerweise Heilige Schrift, Tradition und Lehramt zusammenführte, aber mehr noch der Hinweis auf den Vorschlag von Dossetti über die Vorabstimmungen zur Ekklesiologie, deren Stimmzettel Paul VI. zerstören ließ.
Man ging dann anders vor, was die Formulierung der Fragen betraf, so daß die Antworten nicht die folgende Konzilsdiskussion blockierten.
Der Eindruck, den der Text [Mellonis] vermittelt, Paul VI. habe sich nach der Abstimmung mit einem „also haben wir gewonnen“ gefreut und sich mit Dossetti identifiziert, entspricht nicht den Tatsachen (siehe mein Buch „Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia“, S. 122–125).
Schließlich klingt es nicht minder schlecht, die Nachkonzilszeit durch Paul VI. belastet zu sehen, gerade so, als müsse sich ein Papst nicht um eine korrekte Hermeneutik und eine richtige Rezeption eines Konzils, groß „in casu“, sorgen.
Für Ihre Aufmerksamkeit dankend wünsche ich alles Gute und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Msgr. Agostino Marchetto
Die historischen Hintergründe oder: Wie lenke ich ein Konzil?
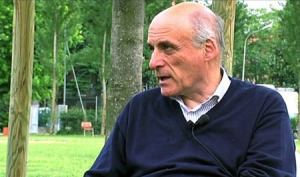
Um die Episode der Zerstörung der Stimmzettel, mit der man sehen wollte, welche Richtung das Konzil nehmen sollte, besser zu verstehen, ist daran zu erinnern, daß die Moderatoren begonnen hatten, eigenmächtig zu handeln und das Generalsekretariat zu umgehen, indem sie sich Don Dossettis bedienten, den Kardinal Lercaro als Sekretär der Moderatoren vorstellte. [Moderatoren des Konzils waren die vier Kardinäle Julius Döpfner von München-Freising, Giacomo Lercaro von Bologna, Léon-Joseph Suenens von Mecheln-Brüssel und Gregoire-Pierre Agagianian, emeritierter Patriarch der Armenier.]
Kurienerzbischof Pericle Felici, der Generalsekretär des Konzils, ließ anfangs gewähren, solange das Faß nicht überging, was mit dem Abstimmungsantrag über die fünf berühmten Punkte zum Episkopat und dem Diakonat der Fall war. Dagegen protestierte Msgr. Felici gegenüber Kardinal Agagianian mit der Feststellung, daß der Sekretär der Moderatoren laut Geschäftsordnung der Generalsekretär ist [und nicht Don Dossetti]. Er erklärte zudem, daß er alles für null und nichtig hielt, was Don Dossetti gemacht hatte. Dasselbe wiederholte Felici auch gegenüber Kardinal Döpfner.
Der Papst, darüber informiert, erklärte kategorisch, „daß er Dosetti nicht auf jenem Platz [als Moderatoren-Sekretär] haben wollte; und dieser vielmehr nach Bologna zurückgehen solle“.
Als die Moderatoren daraufhin Felici anwiesen, die Fragen drucken zu lassen, gehorchte dieser, informierte gleichzeitig aber den Kardinalstaatssekretär (15. Oktober), der wiederum den Heiligen Vater informierte, der den Vorschlag für unangebracht hielt. Bereits am nächsten Tag waren die Moderatoren gezwungen, die Abstimmung zu verschieben. Innerhalb von zwei Stunden wurden die bereits gedruckten Fragestellungen vernichtet.
Da die Moderatoren weiterhin auf einer Abstimmung beharrten, wurde die Frage an den Vorsitz und die Koordinierungsstelle weitergeleitet. Die Moderatoren wollten, daß nur die Koordinierungsstelle damit befaßt werden sollte. Was die Frage der Kollegialität anbelangte, wurden die Kardinäle Suenens und Siri beauftragt, eine Formulierung zu finden und der gemeinsamen Kommission zu unterbreiten.
In Wirklichkeit wurde die gemeinsame Kommission erst wieder nach Vorlegung der Fragestellungen einberufen. Bis dahin machten die Moderatoren eigenmächtig weiter und so mußte auch Kardinal Siri getrennt handeln.
Die Moderatoren erhielten eine Audienz beim Papst, wo sie behaupteten, daß der Vorschlag von Kardinal Siri mit ihrem übereinstimmen würde – „quod verum non erat“. Die Moderatoren behaupteten später, der Papst hätte ihren Vorschlag mit den Anmerkungen approbiert.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Chiesa Cattolica/RomeReports (Screenshot)
-
| ↑1 | Giuseppe Dossetti, 1913–1996, war Jurist beider Rechte, Universitätsprofessor für Kirchenrecht, 1943–1945 Mitglied des antifaschistischen Befreiungskomitees CLN und führender Vertreter des linken Flügels der italienischen Christlichen Demokratie, der sich nach Kriegsende für eine linke Allianz aus Christdemokraten und den Volksfrontparteien der Sozialisten und Kommunisten stark machte, Gegenspieler von Alcide De Gasperi, der sich für die Westbindung einsetzte und sie durchsetzte, 1945/46 und 1950/51 stellvertretender Parteivorsitzender der Democrazia Cristiana (DC), Mitglied der Verfassungsgebenden Versammlung Italiens 1946–1948 und Abgeordneter des Italienischen Parlaments 1948–1952, Verfechter der Republik gegen die Monarchie, 1958 Rücktritt von allen politischen Ämtern und Wunsch an den Erzbischof von Bologna, Kardinal Lercaro, Priester werden zu wollen, im selben Jahr Priesterweihe, Teilnahme als Peritus von Kardinal Lercaro am Zweiten Vatikanischen Konzil, maßgeblicher Autor der neugefaßten Geschäftsordnung des Konzils, organisierte das Vorgehen der progressiven Allianz strategisch wie in einem politischen Parlament. |
|---|

