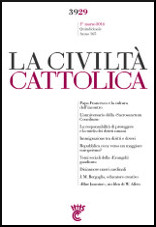
(Rom) Die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica bietet in ihrer neuen Ausgabe eine Nachlese auf die Bischofssynode über die Familie. Autor ist Chefredakteur Pater Antonio Spadaro persönlich. Der Bericht liefert interessante Rückschlüsse auf die postsynodale Stimmung im Lager um Kardinal Walter Kasper. Der Tenor des Aufsatzes ist moderat und ausgleichend, ergreift jedoch Partei für Kaspers „Öffnungen“. Da die Zeitschrift nur mit Druckerlaubnis des Vatikans erscheinen kann und Pater Spadaro zum engeren Vertrautenkreis des Papstes gehört, lohnt eine gründliche Analyse des Textes, der bis ins päpstliche Arbeitszimmer blicken läßt. Eine solche Analyse kann an dieser Stelle bestenfalls angestoßen werden. Das aber soll geschehen.
Unikat Civiltà Cattolica
Die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica stellt ein Unikat dar, dessen Kenntnis erst ihre Bedeutung erklärt. Die seit mehr als 150 Jahren erscheinende Zeitschrift besitzt den Status eines offiziösen Organs des Heiligen Stuhls. Alle Beiträge werden vor ihrer Drucklegung dem vatikanischen Staatssekretariat vorgelegt und bedürfen einer Druckerlaubnis. Dementsprechend lassen sich aus den Beiträgen zumindest gewisse Rückschlüsse auf die offizielle Linie des Vatikans ziehen. Die Verbindung zwischen der Zeitschrift und dem Heiligen Stuhl wurde noch verstärkt, seit erstmals in der Kirchengeschichte ein Jesuit den Stuhl Petri eingenommen hat. Die Civiltà Cattolica veröffentlicht nämlich ausschließlich Beiträge von Jesuiten. Die Wahl von Papst Franziskus schuf eine neue Synergie zwischen Pater Antonio Spadaro, Schriftleiter seit der Ausgabe vom 1. Oktober 2011, und dem Kirchenoberhaupt.
Im September 2013 veröffentlichte die Zeitschrift eines jener umstrittenen Interviews von Papst Franziskus. Das Interview wurde von Pater Spadaro geführt. Veröffentlicht wurde es zeitgleich von der Civiltà Cattolica, Radio Vatikan und zahlreichen Jesuitenzeitschriften in verschiedenen Sprachen rund um den Globus. Größtmögliche Aufmerksamkeit war das Ziel. Es handelt sich unter mehreren um das einzige Interview, das der Papst bisher einer kircheneigenen Zeitschrift gewährte.
„Eine Kirche auf dem synodalen Weg“
Seither gehört Pater Spadaro zum Vertrautenkreis des Papstes und stellt seine Zeitschrift auch strategischen Planungen zur Verfügung, wie die Bischofssynode über die Familie zeigte. Am Vorabend zum Synodenauftakt veröffentlichte die Zeitschrift einen Aufsatz, der die „Öffnungs“-These von Kardinal Walter Kasper unterstützte.
In der jüngsten Ausgabe der Civiltà Cattolica (Heft Nr. 3945 vom 1. November 2014, S. 213–227) ist mit dem Titel „Eine Kirche auf dem synodalen Weg. Die pastoralen Herausforderungen zur Familie“ ein Resümee der Bischofssynode aus der Feder von Pater Spadaro erschienen, der Einblick in die nachsynodale Einschätzung auf höchster kirchlicher Ebene bietet. Man könnte zum Teil von einer Katerstimmung sprechen, liest man bestimmte Formulierungen als Ärger über eine mißlungene „Neuausrichtung“ der kirchlichen Ehe- und Morallehre. Diesbezüglich ist Pater Spadaro nicht zimperlich, der selbst, als von Papst Franziskus persönlich ernannter Synodale an der Synode teilnahm.
Verärgerung über teilmißglückte Synode

Der Paragraph 52 der Relatio Synodi behandelte die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehenden wiederverheiratet Geschiedenen, zu denen Kardinal Kasper „neue Wege“ formuliert und gefordert hatte, mit wenig verschleierter Unterstützung durch Papst Franziskus. Doch der Paragraph 52 erreichte keine qualifizierte Mehrheit unter den Synodenvätern. Die Abstimmung sei „in un certo senso anomala, perché ਠcome se 74 padri su 183 avessero voluto negare persino la registrazione della discussione di fatto vissuta“, so Pater Spadaro, der damit gleich eine Schuldzuweisung vornimmt. Das Votum sei gewissermaßen „anomal“, gerade so, als hätten 74 von 184 Synodenvätern sogar die tatsächlich erlebte Diskussion leugnen wollen. Harte Worte, die erkennen lassen, welche Verärgerung die verpaßte Zweidrittelmehrheit im näheren Umfeld des Papstes ausgelöst haben muß.
Auf der Synode seien „unterschiedliche Kirchenmodelle“ sichtbar geworden, aber auch unterschiedliche kulturelle Prägungen, die „in Zügen sogar gegensätzlich“ sind, je nach Herkunftsland oder Kontinent der Synodenväter, so Pater Spadaro. Der nicht eine von der Kasper-Partei vom ersten Synodentag an ausgegebene Parole aufzugreifen vergißt, wenn er schreibt, daß man in der Synodenaula „wirklich ein ‚konziliares‘ Klima geatmet hat“.
Zwischen „voller erwachsenen Reife“ und Unreife
Die in der Debatte aufgetretenen konträren Positionen wertet er nicht inhaltlich, sondern formal und spricht von „Abgeklärtheit und Offenheit“, die zwar die Diskussion nicht weniger hart gemacht hätten, sondern „im Gegenteil es erlaubt haben, eine wirkliche Dynamik zu leben, die keineswegs ‚Verwirrung’ist, sondern ‚Freiheit‘: zwei Begriffe, die nie zu verwechseln sind, will man nicht mutig die volle erwachsene Reife leben“. Eine im Zusammenhang mit einer Synode ziemlich kurios anmutende Formulierung, will man darin nicht eine wohlwollende Anspielung auf das progressive Konzept des „mündigen Christen“ erkennen. Im Umkehrschluß scheint Pater Spadaro sagen zu wollen, daß eine Ablehnung, über Kaspers „Öffnung“ zu diskutieren, ein Mangel an „voller erwachsener Reife“ wäre.
Die Möglichkeit der meritorischen oder formalen Unzulässigkeit einer Position, wie sie jede Rechtsordnung kennt, im konkreten Fall etwa, weil in offensichtlichem Widerspruch zur kirchlichen Lehre und Ordnung, wird von Pater Spadaro nicht erwogen.
Der Schriftleiter der Jesuitenzeitschrift setzt andere Akzente, etwa wenn er betont, daß Papst Franziskus „die Korrektheit des synodalen Verfahrens bestätigt“ habe, „von dem man sich nicht eine vollständige Übereinstimmung erwarten konnte“. Pater Spadaro zitierte in diesem Zusammenhang das „Klima“ des sogenannten Jerusalemer Apostelkonzils aus der Apostelgeschichte, wo eine „große Diskussion“ stattgefunden habe.
„Ohne je die Wahrheit des Ehesakraments in Frage zu stellen“ und doch…
Diese „direkte Konfrontation Aug in Aug“, so die Civiltà Cattolica, sei das, was der Papst von den Synodalen gewünscht habe, denn er habe gewußt, daß alle vom „Wohl der Kirche, der Familie und der suprema lex, der salus animarum“ geleitet seien. Das habe eine Diskussion möglich gemacht „ohne je die grundlegende Wahrheit des Ehesakraments in Frage zu stellen: die Unauflöslichkeit, die Einheit, die Treue und die Fortpflanzung, das heißt, die Offenheit für das Leben“.
Nachdem Pater Spadaro beklagte, daß ein Teil der Synodenväter, seiner Meinung nach, sogar „leugnen“ wollten, daß es eine Diskussion über die wiederverheiratet Geschiedenen gegeben habe, bringt er seine Genugtuung darüber zum Ausdruck, daß das Thema in der Schlußbotschaft doch vorhanden sei, die als Ganze abgestimmt wurde und mit 158 gegen 174 Stimmen angenommen wurde. Dort heißt es: „Deshalb haben wir im ersten Teil unseres synodalen Weges über die pastorale Begleitung und den Zugang zu den Sakramenten der wiederverheiratet Geschiedenen nachgedacht“. Dieses Zitat ist als einziges im ganzen Aufsatz kursiv gesetzt und damit herausgehoben, was gleichzeitig auch betont, welche Haltung Pater Spadaro und die Civiltà Cattolica einnimmt.
Lob für die Relatio post disceptationem mit „frischerer und zeitgemäßerer Sprache“

Pater Spadaro lobt die umstrittene Relatio post disceptationem mit exakt jener Diktion, die auch die Kardinäle Kasper, Schönborn und Marx in- und außerhalb der Synode gebrauchten. „Generell können wir sagen, daß die Relatio die Anerkennung der positiven Elemente auch in den nicht perfekten Familienformen und den problematischen Situationen aufgenommen hat.“ Es werde darin gesagt, daß „das Positive in den nicht perfekten Situationen anzuerkennen“ sei. Die von Pater Spadaro in diesem Zusammenhang bemühten Stichworte lauten „Lebenswirklichkeit“, „wirkliches Leben“, „reale Geschichte“. Damit habe die „Relatio eine Kirche gezeigt, die mit ihren Energien mehr darauf abzielt soviel Getreide als möglich zu säen anstatt Unkraut auszureißen.“
Dann kommt der Jesuit ins Schwärmen: „Obwohl es noch ein provisorischer, zu vertiefender und zu korrigierender Text war, löste er bei einigen die Freude über eine ‚frischere’ und zeitgemäßere Sprache aus“. Das Verdienst des umstrittenen Dokuments sei, laut Pater Spadaro, daß es „die konkrete Existenz der Menschen aufgegriffen hat, anstatt abstrakt über die Familie zu sprechen, wie sie sein sollte“. Zu diesem positiven Aufgreifen der „konkreten Existenz der Menschen“ zählt er „die Würdigung der nur durch eine Zivilehe verbundenen Paare, die Situation der wiederverheiratet Geschiedenen und ihren eventuellen Zugang zu den Sakramenten der Versöhnung und der Eucharistie, die gemischten Ehen, die Fälle von Nichtigkeit, die Situation homosexueller Menschen, die Herausforderung des Geburtenrückgangs und der Erziehung“.
Ablehnung des „Gradualitäts“-Prinzips vorkonziliar?
Zur von Kardinal Schönborn, und dann auch anderen vertretenen neuen „Gradualität“ schreibt Pater Spadaro, die Positionen der Arbeitskreise haben vom „Mut an verbotene Türen zu klopfen“ (Circulus Anglicus A) bis zur „völligen Zurückweisung des Prinzips der vom Zweiten Vaticanum inspirierten ‚Gradualität‘ (Circulus Gallicus B) gereicht. Angesichts einer innerkirchlich weitgehend durchgesetzten Tabuisierung von jeder Kritik am Konzil, das a priori „positiv“ zu werten sei, will der Schriftleiter mit seinem Hinweis auf das Zweite Vaticanum den Eindruck signalisieren, die Kritiker der Gradualitäts-These seien im Unrecht, da vor- oder antikonziliar, was wohl ohne jede „Gradualität“ gleichermaßen schlimm sein muß. Nur nebenbei sei erwähnt, daß der Circulus Anglicus A an der genannten Stelle eigentlich etwas ganz anderes aussagt und nur „ein Mitglied“, wie ausdrücklich vermerkt wurde, auf die oben zitierte Aussage „drängte“.
Interessant ist noch die Feststellung, daß die Relatio post disceptationem, laut Darstellung der Civiltà Cattolica „Kardinal Peter Erdö mit Unterstützung des Sondersekretärs Msgr. Bruno Forte redigiert hat, wie es der Ordo Synodi“ vorsehe. Die Relatio sei auf der Grundlage der Wortmeldungen entstanden, die vor Synodenbeginn dem Generalsekretariat zukamen.
Nicht minder interessant, daß die Kommission für die Schlußbotschaft bereits tagte, als die Arbeitskreise erst ihre Arbeit aufnahm und damit deren Arbeit gar nicht berücksichtigen konnte. Die Kommission bestand ursprünglich ausschließlich aus Mitgliedern, die der Kasper-These wohlwollend gegenüberstanden. Erst der „afrikanische Unfall“ Kaspers während der Synode führte dazu, daß Papst Franziskus zur Beruhigung des aufgewühlten Klimas, von dem Spadaro nichts zu berichten weiß, noch zwei Mitglieder nachbestellte.
Von intransparenter Transparenz und anderen Unterschlagungen
In der Veröffentlichung der Abstimmungsergebnisse auch über die einzelnen Paragraphen „hat Franziskus den ganzen Prozeß transparent gemacht, indem er den Gläubigen die Lesart und die Beurteilung der Fakten überließ, auch jene, die schwerer zu interpretieren sind“. Mit keinem Wort erwähnt Pater Spadaro hingegen den Unmut nicht weniger Synodenväter, die gerade einen Mangel an Transparenz kritisierten, bzw. der Synodenleitung eine selektive Transparenz vorwarfen, mit der Kaspers Partei begünstigt werden sollte. So wurden die Wortmeldungen der Synodalen im Gegensatz zu den früheren Synoden nicht veröffentlicht und damit das genaue Gegenteil von Transparenz praktiziert. Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Einzelabstimmungen und nicht nur das Endergebnis sei erfolgt, weil Kaspers Position eine leichte, wenn auch nicht ausreichende Mehrheit hatte. Wäre diese nicht der Fall gewesen, hätte es wahrscheinlich auch diese „Transparenz“ nicht gegeben.
„Dieser ganze Prozeß hat die Veröffentlichung der Arbeitsmaterialien (Relatio und relationes der Arbeitskreise) für eine größere externe Teilhabe außerhalb der Synode notwendig gemacht“, so Pater Spadaro, der mit keinem Wort erwähnt, daß die Veröffentlichung der relationes erst widerwillig nach einem Aufstand der Synodalen erfolgte. Statt dessen heißt es im Aufsatz: „Es soll nicht verschwiegen werden, daß die Veröffentlichung aller Diskussionsunterlagen von einigen als riskant betrachtet wurde, weil sie ein Bild der Kirche in ihrer Vielschichtigkeit unterschiedlicher Positionen lieferte“. Kein Wort darüber, daß die Veröffentlichung oder Nicht-Veröffentlichung nicht nur eine Frage der Opportunität war, sondern einen inhaltlichen Konflikt widerspiegelte, weil die Verteidiger der kirchlichen Ehe- und Morallehre in der Nicht-Veröffentlichung ein Todschweigen ihrer Position erkannten, mit dem der Gegenposition von Kardinal Kasper eine Monopolstellung gesichert werden sollte, wie dies durch Papst Franziskus bereits beim Kardinalskonsistorium im vergangenen Februar vorexerziert worden war.
So versteht sich von selbst, daß Pater Spadaro den erhobenen Vorwurf der „Manipulation“ ebensowenig erwähnt, wie die noch während der Synode von Kardinal Burke geäußerte Kritik, Papst Franziskus habe durch seine Haltung in der Gesamtfrage „eine Menge Schaden angerichtet“. Ebensowenig thematisiert wird Kritik an Kardinal Kasper vor allem durch afrikanische Synodale. Statt dessen lobt er, daß Papst Franziskus die Veröffentlichung auch jener Teile verfügte, die keine Mehrheit erhielten.
„Mutige pastorale Entscheidungen“
Pater Spadaro betont als Neuerung, daß im angenommenen Teil des Schlußberichts „positive Elemente“ auch in Zivilehen und ohne Trauschein zusammenlebenden Paaren anerkannt würden und die Rede von „mutigen pastoralen Entscheidungen“ sei. Dazu gehört auch, daß Pater Spadaro unverkennbar eine „Öffnung“ der Kirche gegenüber Homosexuellen vertritt. Mit keinem Wort erwähnt er auch nur ansatzweise Kritik am sündhaften Verhalten Homosexueller, betont aber ausdrücklich, daß die „Willkommenshaltung“ einen Einsatz der Nähe bedeute, „der auch imstande ist, ungerechte und gewalttätige Diskriminierungen anzuklagen“. Homosexuelle, werden nur als verteidigungs- nicht aber als kritikwürdig benannt.
Pater Spadaro berichtet, daß die drei Paragraphen zu den wiederverheiratet Geschiedenen und den Homosexuellen zwar abgelehnt wurden, nicht ohne zu erwähnen, daß sie aber „eine satte Mehrheit“ erhalten haben. Dabei unterstellt er den Verteidigern der kirchlichen Ehe- und Morallehre wahrheitswidrig „weniger geneigt zur pastoralen Annahme dieser Menschen zu sein“.
Das Feldlazarett, das sich selbst belagert
Schließlich macht sich der Jesuitenschriftleiter das von Papst Franziskus wiederholt vorgetragenen Bild von der Kirche als „Feldlazarett“ zu eigen: „Viele Menschen sind verletzt, die von uns Nähe erbitten, die von uns erbitten, worum sie Jesus baten: Nähe, unmittelbare Nähe“. Es drängt sich die Frage auf, ob das wirklich alles ist, was die Menschen von Jesus erbaten und noch mehr, ob das alles ist, wozu Jesus zu den Menschen ging. Vor allem bliebt ausgeklammert, daß die „vielen Verletzten“ auch jene voraussetzen, die verletzen, einschließlich der Frage, ob die Darstellung der Menschen nur unter dem Blickwinkel von „Verletzten“ der menschlichen Natur und der beschworenen „Lebenswirklichkeit“ gerecht wird. Wohl kaum.
Dennoch unterläßt es Pater Spadaro nicht, einen Seitenhieb auszuteilen. Er sagt nicht gegen wen, doch sind die Adressen hinlänglich bekannt. Denn das Bild der Kirche als „Feldlazarett“ sei „das Gegenteil einer belagerten Festung“. Nach der Wahl von Papst Franziskus wurde damit mit dem Finger auf Benedikt XVI. gezeigt. Das sei nicht „bloß eine schöne poetische Metapher: aus ihr kann ein Verständnis des Auftrags der Kirche kommen und auch der Bedeutung der Heilssakramente“, heißt es im Aufsatz. Die simple Tatsache, daß sich niemand selbst belagern kann, sondern nur von Dritten belagert werden kann und dabei feindliche Absicht Voraussetzung ist, zeigt die Haltlosigkeit des Vergleichs.
Die Fähigkeit zu falschen Fragen
Das Kampffeld seien heute einige Herausforderungen, die die Familie betreffen. Dabei nennt Spadaro unter anderen „Paare ohne Trauschein, die die Frage der sozialen Institutionalisierung ihrer Beziehungen aufwerfen“; ebenso „homosexuelle Personen fragen sich, warum sie nicht ein Leben stabiler affektiver Beziehung als praktizierende Gläubige führen können“. Antworten gibt der Schriftleiter keine, sondern will durch die Auflistung einen großen Handlungsbedarf signalisieren. Deshalb thematisiert Spadaro weder den Widerspruch einen nicht-institutionellen Weg institutionalisieren zu wollen noch die falsch gestellte und damit irreführende Fragestellung fiktiver Homosexueller.
„In Wirklichkeit aber ist das wahre Problem, die wirklich tödliche Wunde der Menschheit heute, daß die Personen sich immer schwerer tun aus sich selbst herauszugehen und Treuepakte mit einem anderen Menschen abzuschließen, selbst einem geliebten. Es ist diese individualistische Menschheit, die die Kirche vor sieht. Und die erste Sorge der Kirche muß die sein, nicht die Türen zu schließen, sondern sie zu öffnen, das Licht anzubieten, das in ihr wohnt, hinauszugehen um einem Menschen entgegenzugehen, der, obwohl er glaubt, keine Heilsbotschaft zu brauchen, sich oft verängstigt und vom Leben verletzt wiederfindet. Wenn die Kirche wirklich die Mutter ist, behandelt sie ihre Kinder nach ihrer „barmherzigen Liebe“.“
„Synodaler Weg“ steht erst „ganz am Anfang“
Spätestens beim letzten Satz fragt man sich staunend, in welcher Kirche Pater Spadaro eigentlich aufgewachsen und Priester geworden ist: „Einige Synodenväter haben sich die Frage gestellt, ob es eine „sakramentale Ökonomie geben kann, die unrettbare Situationen vorsieht, die dauerhaft vom Zugang zum Sakrament der Versöhnung ausschließen?“
Der „synodale Weg“ sei beschritten. Das sei erst „ganz der Anfang“ gewesen, resümiert der Chefredakteur der Jesuitenzeitschrift. Der Ablauf der Bischofssynode versetzte dem Kasper-Lager einen unerwarteten Dämpfer. Das läßt sich auch bei Pater Spadaro herauslesen. Gemäß einer positivistischen Grundsicht, die gewöhnlich Fortschrittgläubigen innewohnt, scheint man die teilmißglückte Bischofssynode als Betriebsunfall zu betrachten und beim begonnenen „synodalen Weg“ auf den Faktor Zeit zu setzen.
Reue, Umkehr, Buße scheinen vergessene Fremdwörter eines Vokabulars aus dunkler Vorzeit. Der Rückblick von Pater Spadaro auf die Bischofssynode bleibt ein in der Sprache auf Zurückhaltung wertlegender Text, der den Eindruck einer moderaten, ausgewogenen Position vermitteln möchte, der er inhaltlich aber nicht ist.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons/Civiltà Cattolica/Gesuitinews

