 (Kitzbühel) Pater Serafino Maria Lanzetta lebt seit einem Dreivierteljahr in der Verbannung in Kitzbühel in Tirol, wo sich das einzige Kloster des Ordens der Franziskaner der Immakulata im deutschen Sprachraum befindet. Einer der herausragenden Köpfe dieses geschundenen Ordens legte soeben ein neues Buch vor. Die Waffen des Geistes können auch kommissarisch nicht gebunden werden. Es handelt sich um seine Habilitationsschrift an der Theologischen Fakultät Lugano in der Schweiz, die dort vom bekannten deutschen Dogmatiker und Mariologen Manfred Hauke betreut wurde. Erschienen ist das Buch im katholischen Verlag Cantagalli in Siena. Das Thema? Das Zweite Vatikanum, ein Pastoralkonzil. Hermeneutik der Konzilslehren.
(Kitzbühel) Pater Serafino Maria Lanzetta lebt seit einem Dreivierteljahr in der Verbannung in Kitzbühel in Tirol, wo sich das einzige Kloster des Ordens der Franziskaner der Immakulata im deutschen Sprachraum befindet. Einer der herausragenden Köpfe dieses geschundenen Ordens legte soeben ein neues Buch vor. Die Waffen des Geistes können auch kommissarisch nicht gebunden werden. Es handelt sich um seine Habilitationsschrift an der Theologischen Fakultät Lugano in der Schweiz, die dort vom bekannten deutschen Dogmatiker und Mariologen Manfred Hauke betreut wurde. Erschienen ist das Buch im katholischen Verlag Cantagalli in Siena. Das Thema? Das Zweite Vatikanum, ein Pastoralkonzil. Hermeneutik der Konzilslehren.
Der Autor greift für seine Arbeit auf Primärquellen zurück, darunter vor allem die theologischen Gutachten der Glaubenskommission und den Briefverkehr zwischen Konzilsvätern und mit Papst Paul VI.
Konstitutive Tradition: Meinungsunterschiede zwischen Papst und treibenden Konzilskräften
Auf diese Weise ist es Pater Lanzettta gelungen, einige Knoten an entscheidenden historischen Momenten des Konzils zu entwirren. Momente, in denen Paul VI. aufmerksam die Arbeiten des Konzils und besonders der Glaubenskommission mitverfolgte. Der Papst informierte sich ständig bei Kardinal Alfredo Ottaviani, dem Vorsitzenden der Glaubenskommission über die zentrale Frage, wie die konstitutive Tradition, jene zweite, von der Heiligen Schrift unabhängige Offenbarungsquelle, die sich aus der Schrift nur durch das Licht der Tradition erschließt, in das entsprechende Konzilsdokument eingeflochten wird. Einige wollten ihr in Dei verbum die Kanten nehmen, andere wollten ihr nur mehr einen recht allgemein gehaltenen Platz zuweisen, während wieder andere sie ökumenischer kleiden wollten. Die Periti zuerst und dann auch die Konzilsväter hatten diesbezüglich ziemlich unterschiedliche Ansichten.
Paul VI. wollte hingegen, daß die konstitutive Bedeutung der Apostolischen Tradition deutlich ausgesprochen wird, indem ein Text des Kirchenvaters Augustinus (De baptismo contra Donatistas, V, 23,31), zitiert wird, in dem dieser ausführte, daß viele Dinge, die von den Aposteln gelehrt wurden, sich nicht in den Schriften finden. Es ging um die Dualität der Offenbarungsquellen, die das Konzil überwinden wollte, indem es den Akzent auf die Offenbarung statt auf die Quellen der Überlieferung verschieben wollte. Im endgültigen Text von Dei Verbum (9) setzte die Konzilsmehrheit jedoch eine neutrale Formulierung durch, die der Frage auszuweichen versucht: „So ergibt sich, daß die Kirche ihre Gewißheit über alles Geoffenbarte nicht aus der Heiligen Schrift allein schöpft.“
Die Schwäche von Kompromißformulierungen
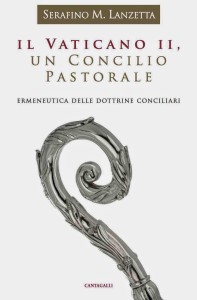 Dei Verbum führte zu einer beachtlichen theologischen Entwicklung des Offenbarungsverständnisses, allerdings auf der Grundlage einer Kompromißformulierung, die zuerst von einer Mehrheit der Periti der Glaubenskommission, dann auch von den Konzilsvätern vertreten wurde, mit ökumenischem Einschlag, vor allem um zu verhindern, daß das Konzil nicht gegen die Position Luthers – das Konzil war ja nicht gerufen Irrtümer zu verurteilen oder neue Dogmen zu verkünden – eine Position der Sola Traditio einnahm.
Dei Verbum führte zu einer beachtlichen theologischen Entwicklung des Offenbarungsverständnisses, allerdings auf der Grundlage einer Kompromißformulierung, die zuerst von einer Mehrheit der Periti der Glaubenskommission, dann auch von den Konzilsvätern vertreten wurde, mit ökumenischem Einschlag, vor allem um zu verhindern, daß das Konzil nicht gegen die Position Luthers – das Konzil war ja nicht gerufen Irrtümer zu verurteilen oder neue Dogmen zu verkünden – eine Position der Sola Traditio einnahm.
Tatsache ist, daß diese pastoralere Formulierung der Lehre über die konstitutive Tradition eine Flut an möglichen Interpretationen auslöste und noch immer auslöst, sobald man davon abrückt, was die Kirche vorher lehrte und was die Kirche auch noch in den anderen Konzilsdokumenten und den nachfolgenden lehramtlichen Verlautbarungen, vor allem im Katechismus der Katholischen Kirche lehrt: Zwei sind die Quellen, durch die der Kirche die Offenbarung anvertraut wurde, die Schrift und die Tradition, die beide mit „pari pietatis affectu ac reverentia“, mit gleicher Liebe und Achtung angenommen und verehrt werden sollen (Dei Verbum 9, unter Verweis auf das Konzil von Trient, Decr. De canonicis Scripturis: Denz. 783 [1501]).
Konzilsinterpretation nur im Licht der Tradition möglich
Anhand diesem und zahlreichen anderen Beispielen vertritt Pater Lanzetta den Standpunkt, daß die doktrinellen Formulierungen des Konzils alleine nicht ausreichen, da sie mit der Absicht zustande kamen, unter den Konzilsvätern eine große Mehrheit zu finden. Es braucht daher, so Lanzetta, ein höheres hermeneutisches Prinzip für die Interpretation der Konzilsdokumente: den Glauben der Kirche und damit die Homogenität ihrer Glaubenslehre.
Versuch der Bischöfe sich selbst als Kollegium Lehrfähigkeit zuzusprechen
Paul VI. verlangte vom Konzil, daß in Lumen gentium (Drittes Kapitel) mit Klarheit die konstitutive Abhängigkeit des Bischofskollegiums von der Autorität des römischen Papstes unterstrichen wird. Er forderte eigens ein zusätzliches Gutachten zum vorliegenden Text an. Der Text blieb dennoch in seinem Kern so verschwommen, daß der Papst die Anfügung einer ergänzenden Nota praevia anordnete. Darin wurde klargestellt, welche Rolle das Bischofskollegium hat und vor allem welche nicht, eben daß es einzig unter und mit dem Papst lehrfähig ist, nicht aber aus sich selbst heraus, weder generell noch anteilsmäßig.
Der Titel von Pater Lanzettas Arbeit unterstreicht bereits die Besonderheit des Zweiten Vatikanums: ein in seinem Ursprung pastorales Konzil, das jedoch ein umfangreiches doktrinelles Lehramt entfaltete, für die es alle führenden und einflußreichen Theologen seiner Zeit einbinden konnte. Letztlich blieb der pastorale Ansatz, der eigentliche Zweck des Konzils, in vielen Fällen vorherrschend, was keine Erleichterung brachte, sondern zum Teil sofort zu Problemen führte.
Welche Verbindlichkeit kann das Konzil für sich beanspruchen?
Ein grundsätzliches hermeneutisches Problem, das der Autor angeht, läßt sich in folgender Frage zusammenfassen: Welchen Grad an lehramtlicher Verbindlichkeit hat das Zweite Vatikanische Konzil? Eine Frage, auf die es keine korrekte Antwort geben kann, wenn nicht die einzelnen Lehren, des an Lehren reichen Konzils einer Prüfung unterzogen werden. Eine Antwort ist daher nicht möglich, wenn man nicht in die mens des Konzils eindringt, die sich nur durch ein systematisches Studium der Konzilsquellen erschließt, die wiederum zwangsläufig im Licht der lebendigen Tradition der Kirche und des päpstlichen Lehramtes zu lesen sind.
Vom analytischen Studium der mens der Konzilsväter gelangt der Autor zum Schluß, daß den Dokumenten des Konzils, die zwar der Form nach dem feierlichen und außerordentlichen Lehramt zuzuordnen wären, tatsächlich aber nur den Verbindlichkeitsgrad des ordentlichen Lehramtes beanspruchen können.
Die zahlreichen offenen Fragen des Konzils
 Pater Lanzetta wählte für seine Darstellung drei zentrale Themen, um die große Frage der Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils zu erhellen. Das Verhältnis zwischen Schrift und Tradition in Dei Vebum; das Geheimnis der Kirche in Lumen gentium unter besonderer Berücksichtigung der Kollegialität, der Kirche als Sakrament und der Zugehörigkeit zur Kirche; und schließlich das mariologische Thema im Kapitel 8 von Lumen gentium, der Stellung des Geheimnisses Mariens in Christus und der Kirche. Konkret geht es dabei um die Frage der Mittlerschaft Mariens (Mittlerin aller Gnaden?, wie sich zum Beispiel die deutschen Bischöfen distanziert fragten).
Pater Lanzetta wählte für seine Darstellung drei zentrale Themen, um die große Frage der Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils zu erhellen. Das Verhältnis zwischen Schrift und Tradition in Dei Vebum; das Geheimnis der Kirche in Lumen gentium unter besonderer Berücksichtigung der Kollegialität, der Kirche als Sakrament und der Zugehörigkeit zur Kirche; und schließlich das mariologische Thema im Kapitel 8 von Lumen gentium, der Stellung des Geheimnisses Mariens in Christus und der Kirche. Konkret geht es dabei um die Frage der Mittlerschaft Mariens (Mittlerin aller Gnaden?, wie sich zum Beispiel die deutschen Bischöfen distanziert fragten).
Der Autor arbeitet an letzterem Beispiel konkret heraus, wie groß der Wunsch der treibenden Kräfte des Konzils war, ja nicht den Dialog mit den getrennten Brüdern zu belasten. Der pastorale Charakter, den Johannes XXIII. für das Konzil wollte, hinderte die Konzilsaula nicht daran, im wahrsten Sinn des Wortes ein munus docendi auszuüben. Durch das Bestreben, allem einen besonderen Nachdruck zu verleihen, bedingte das Konzil teilweise die Lehre und ihre Darlegung. Das alles könne auch fünfzig Jahre nach dem Konzil nicht gleichgültig lassen, sondern fordere Fragen heraus, die nach Antworten verlangen. Zahlreiche theologische Fragen wurden von Konzil nur angerissen oder absichtlich beiseite gelassen, um das große pastorale Ziel der ökumenischen Kirchenversammlung nicht in Frage zu stellen.
Pastoraler Charakter läßt „moderne“ Sprache schnell altern
Das Konzil ist zwar erst fünfzig Jahre alt, doch viele Formulierungen sind deshalb in einer so zeitbezogenen Sprache gefangen, daß sie bereits überholt wirken und einer Aktualisierung bedürften. Pater Lanzetta verweist etwa auf die Frage des Limbus, der damals ausgesondert und verworfen, in jüngster Zeit aber von der Internationalen Theologischen Kommission wieder aufgegriffen wurde. Aber auch die Frage zum Verhältnis von mystischem Leib Christi und der römisch-katholischen Kirche, die Frage nach der Kirche als „Arche des Heils“, nach dem Zölibat in Bezug auf die Ostkirchen oder eines angeblichen De facto-Diakonats, das es in Wirklichkeit gar nicht gibt. In verschiedenen Fällen ist der theologische Stand eben genau jener von 1962. Die Mehrzahl der Konzilsväter habe lediglich nach pastoral geeigneteren Formulierungen gesucht, um die Lehre der Kirche zum Ausdruck zu bringen, weshalb die aktiven Kräfte besondere Aufmerksamkeit verdienen, die in die eine oder andere Richtung lenkten.
Manfred Hauke: „Brillante Abhandlung“
Der deutsche Theologe Manfred Hauke von der Theologischen Fakultät Lugano steuerte das Vorwort zur Arbeit von Pater Lanzetta bei. Der Dogmatiker und Patrologe attestiert Lanzetta, „eine brillante Abhandlung des gewählten Themas“ vorgelegt zu haben. Da der Autor „die zeitgenössische Diskussion und die Quellen des Zweiten Vatikanums gut kennt“, leiste die Habilitationsschrift sowohl aus historischer Sicht als auch im Sinne einer systematischen Durchdringung einen neuen Beitrag.
Wird Zweites Vatikanum je der Einheit der Kirche dienen?
Am Ende seiner Einleitung fragt sich Pater Lanzetta, ob das Zweite Vatikanische Konzil je ein Konzil für die Einheit der Kirche sein wird können. Häufig habe der Wunsch nach ökumenischer Einheit, die zwar eine noble und exzellente Sache sei, die Einheit des Glaubens aus den Augen verlieren lassen, das Glauben mit der Kirche aller Zeiten. Aus diesem Grund wirft der Autor in seiner Arbeit zahlreiche Fragen auf, durchaus im Bewußtsein, daß diese derzeit wesentlich zahlreicher sind als die Antworten, die er geben kann. Fragen verlangen nach Antworten. Allein die Tatsache, daß sie gestellt, wenn auch vielleicht nicht alle beantwortet werden können, sei mit Blick auf das Zweite Vatikanische Konzil bereits ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Der Autor schreibt dazu, er hoffe zumindest die richtigen Fragen aufzuwerfen, die nicht nur die Fachleute zum Nachdenken anregen, sondern auch all die anderen, die aus verschiedenen Gründen meinen, alle Antworten bereits zu haben, ohne sich überhaupt die dazugehörenden Fragen gestellt zu haben. Man könne aber nicht so tun, als gäbe es diese Fragen nicht. Jedenfalls sicher nicht mehr nach der Lektüre von Pater Lanzettas Buch.
Der Verlag schreibt zum Buch: Eine gründliche Untersuchung über das Zweite Vatikanische Konzil. Der Autor analysiert aus verschiedenen Blickwinkeln, keinen ausgeschlossen, alle mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil verbundenen Themenbereiche. Das Buch ist das Ergebnis einer dreijährigen Forschungsarbeit, die alle „konziliaren“ Theorien und Denkrichtungen herausarbeitet. Eine außergewöhnliche Zusammenschau dieses Ereignisses, das die Geschichte der Kirche verändert hat. Die Hermeneutik der Kontinuität, jene der Diskontinuität, der Konzilsgeist, die tatsächlichen Reformen und die vermeintlichen Reformen, jene die sich nicht in den Konzilstexten finden. Der Autor verzichtet dabei nicht, eine mögliche Einheit der Kirche im Verständnis dieses kirchlichen Ereignisses aufzuzeigen. Das Buch enthält zudem eine umfassende Bibliographie, die alle Quellen zur Diskussion über das Konzil versammelt.
Serafino M. Lanzetta, Il Vaticano II, un concilio pastorale. Ermeneutica delle dottrine conciliari, Cantagalli, Siena 2014, S. 490, Euro 25,00.
Text: Ciesa e Postconcilio/Giuseppe Nardi
Bild: Cantagalli/Lettere43/Franziskaner der Immakulata

