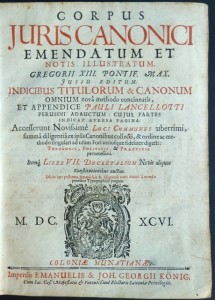 (Innsbruck) Vergangene Woche wurde bekannt, daß die Vorsitzende der kirchenrebellischen Vereins „Wir sind Kirche“ exkommuniziert wurde. Exkommunikationen sind proportional umgekehrt zur zunehmenden Verbreitung heterodoxer Lehren und zur Disziplinlosigkeit in der Kirche eine Seltenheit geworden. Der streitbare Priester Ariel Levi di Gualdo, ein jüdischer Konvertit, befaßt sich in seinem jüngsten Aufsatz mit dem Fall Martha Heizer. Mehr noch geht es ihm darum, daß die kirchliche Autorität das Instrument der Exkommunikation kaum nutzt und die Kirche unter dieser Abwesenheit der kirchlichen Autorität stöhnt.
(Innsbruck) Vergangene Woche wurde bekannt, daß die Vorsitzende der kirchenrebellischen Vereins „Wir sind Kirche“ exkommuniziert wurde. Exkommunikationen sind proportional umgekehrt zur zunehmenden Verbreitung heterodoxer Lehren und zur Disziplinlosigkeit in der Kirche eine Seltenheit geworden. Der streitbare Priester Ariel Levi di Gualdo, ein jüdischer Konvertit, befaßt sich in seinem jüngsten Aufsatz mit dem Fall Martha Heizer. Mehr noch geht es ihm darum, daß die kirchliche Autorität das Instrument der Exkommunikation kaum nutzt und die Kirche unter dieser Abwesenheit der kirchlichen Autorität stöhnt.
.
Die „Priesterin“ von „Wir sind Kirche“ hat sich exkommuniziert
von Ariel Levi di Gualdo
Die Fakten: Martha Heizer inszenierte zusammen mit ihrem Ehemann Gert Heizer seit drei Jahren in ihrem Haus in Absam unter Anwesenheit von Gläubigen eine regelrechte eucharistische Parodie. Nach einer gründlichen Untersuchung durch die Glaubenskongregation stellte der Bischof von Innsbruck, Msgr. Manfred Scheuer persönlich das Exkommunikationsdekret zu, das von den beiden Betroffenen zurückgewiesen wurde. Martha und Gert Heizer erklärten in den Medien, empört zu sein über das Vorgehen der „Amtskirche“ und vor allem, daß sie ihren Weg weitergehen werden.
Jeder Bischof kann exkommunizieren und sollte es im Notfall auch tun
Jenen, die mich um Aufklärung über die Exkommunizierung gebeten haben und darüber, was genau eine Exkommunikation bedeutet und wer sie verhängen kann, muß ich zunächst vorausschicken, daß es sich dabei nicht um ein päpstliches Vorrecht handelt, wie viele zu meinen scheinen. Alle residierenden Diözesanbischöfe, die über die Vollmacht zur Leitung ihrer Ortskirche verfügen, besitzen das Recht, die Exkommunikation über ihnen unterstehende Gläubige zu verhängen, und manchmal hätten sie geradezu die Pflicht, davon Gebrauch zu machen, wenn sie dies in diesen Zeiten auch nur sehr selten tun. Das Recht erstreckt sich unterschiedslos auf alle ihnen in ihrer jeweiligen Jurisdiktion anvertrauten Gläubigen ob Priester, Diakone, Ordensleute oder gläubige Laien gemäß den im Kirchenrecht festgelegten Bestimmungen.
Der Großteil der Exkommunikationen erfolgt latae sententiae wegen Tatstrafen, das heißt automatisch, weil die Betroffenen durch ihr Verhalten oder ihre verbrecherischen Handlungen, gleichgültig ob es sich dabei um einen Kleriker in sacris oder um einen Laien handelt, ipso facto exkommuniziert sind.
Versuchen wir die Sache anhand eines konkreten Beispiels zu erklären: Wenn ich als Priester beim Beichtdienst das sakramentale Siegel der Geheimhaltungspflicht breche und den Inhalt der Beichte eines Pönitenten, nämlich die von ihm gebeichteten Sünden öffentlich machen würde, wäre ich automatisch latae sententiae, im Sinne einer Tatstrafe exkommuniziert. Konkret wäre meine Exkommunikation mit einem der delicta graviora verbunden, dessen Nachlaß einzig dem Apostolischen Stuhl vorbehalten ist, während mir mein Diözesanbischof dafür keine Absolution erteilen und mir den Nachlaß gewähren könnte. Diese Form betrifft einige im Kirchenrecht festgelegte schwerwiegende Verbrechen. Den Nachlaß dafür kann mir nur die Apostolische Signatur erteilen, nachdem sie eine angemessene Buße auferlegt hat.
Die Exkommunikation latae sententiae bedeutet also, daß man sie sich selbst durch das eigene Handeln zuzieht. Die kirchliche Autorität beschränkt sich lediglich darauf, die Tat zur Kenntnis zu nehmen und dem Betroffenen, der exkommuniziert ist, diese Feststellung offiziell zuzustellen und die je notwendigen Sanktionen und Strafen zu verhängen. Im Falle eines Klerikers könnte das vom Interdikt, dem Verbot die Sakramente zu zelebrieren und zu spenden, bis zur Rückversetzung in den Laienstand in besonders schwerwiegenden Fällen reichen.
Vergleicht man das Strafrecht mit dem Kirchenrecht könnte man sagen, daß die Exkommunikation latae sententiae, der man ipso facto verfällt und der Exkommunikation, die hingegen wegen einer verbrecherischen Tat von der kirchlichen Autorität nach einer formalen Anzeige verhängt wird, der strafrechtlichen Verfolgung von Amtswegen und jener nach einer Anzeige Dritter entspricht.
Problematisches Nichthandeln der Bischöfe
Es gibt zudem eine Reihe weniger eklatanter, aber deshalb nicht weniger schwerwiegender Fälle, in denen es die Pflicht des Diözesanbischofs wäre, strenge kanonische Sanktionen zu verhängen, zum Beispiel, indem er gegen Kleriker einschreitet, die öffentliches Ärgernis geben, weil sie im Konkubinat leben, oder Unordnung und Verwirrung im Volk Gottes stiften durch ihre Schriften oder öffentlichen Aussagen voller Groll oder getränkt von unübersehbaren Schnitzern und Falschdarstellungen der Glaubenslehre, denn richtige Häresien setzen bereits ein bestimmtes Maß an Kultur und theologischer Intelligenz voraus, die bestimmten „sozialen Priestern“ wie dem berühmten Don Luigi Ciotti [bei dem sich Papst Franziskus einhängte und der seither mit höheren päpstlichen Weihen versehen gilt] selten eigen ist. Oder etwa der Genueser Priester Paolo Farinella, der so gerne in der linksradikalen und antikatholischen Zeitschrift Micromega publiziert. Das einzige Problem ist, daß sein Diözesanbischof Angelo Kardinal Bagnasco ist, jener gute Bischof, der im Mai 2013 beim Requiem für den verstorbenen Don Luigi Gallo, einen anderen „sozialen Priester“, vor politischen und polemischen Diskussionen zurückschreckte und deshalb nicht davor zurückschreckte, die Allerheiligste Eucharistie einem als Frau verkleideten Mann zu spenden, der als rabiater Verfechter des Homosexualismus bekannt ist, der sich ihm in Stöckelschuhen präsentierte und dem post communionem sogar erlaubt wurde, wahrscheinlich als eucharistische Danksagung, vom Ambo des Presbyteriums zu palavern, von dem den Christi fideles das Wort Gottes verkündet wird. Das alles während der Eucharistiefeier, der der Vorsitzende der italienischen Bischöfe als Ortsordinarius vorstand.
 Ist der Hirte heute Pelikan oder Vogelstrauß?
Ist der Hirte heute Pelikan oder Vogelstrauß?
Wenn in der alten Ikonographie des Aquinaten der gute Vater und Hirte durch den sich selbstlos aufopfernden, hingebungsvollen Pelikan dargestellt wurde, der sich mit dem Schnabel das Herz aufreißt, um seine Kinder zu nähren, müßten heute viele Väter und Hirten durch eine moderne Ikonographie als Vogelstrauß dargestellt werden, der mitnichten hingebungsvoll, sogar vor dem eigenen Schatten dermaßen erschrickt, daß der instinktiv den Kopf in den Sand steckt, dabei aber bestens sichtbar die delikateste und verletzlichste Seite seines Körpers exponiert läßt.
Um ehrlich zu sein, wundert mich noch heute, daß nicht ich bestraft wurde, wie man es mir übrigens mehrfach angedroht hat, obwohl ich keine kanonische Bestimmung verletzt hatte. „Schuldig“ gemacht hatte ich mich hingegen, in den Augen mancher, der Majestätsbeleidigung, dem obersten „Dogma“ bestimmter Prälaten, das heute weit höher steht als das Mysterium des fleischgewordenen Wortes Gottes, weil ich gestern sagte und heute bekräftige, daß der Vorsitzende der Bischofskonferenz falsch gehandelt hat und weiterhin falsch handelt, weil er einigen seiner Priester freien Lauf läßt, ideologischen Haß zu schüren und offenkundige Heterodoxien zu verbreiten.
Heizer hat sich selbst exkommuniziert
Was nun die „Priesterin“ von Wir sind Kirche betrifft, ist es letztlich nicht ganz richtig, zu sagen, der Papst habe sie und ihren ebenso progressiven Ehemann exkommuniziert. Komma 2 von Canon 1378 des Codex Iuris Canonici besagt nämlich: „Die Tatstrafe des Interdikts oder, falls es sich um einen Kleriker handelt, der Suspension, zieht sich zu, wer ohne Priesterweihe das eucharistische Opfer zu feiern versucht.“ Wer sich die entsprechenden Bestimmungen des Kirchenrechts genauer anschauen will, wird im Internet fündig.
Indem Frau Martha Heizer vorsätzlich und mit Beharrlichkeit wiederholt eine Straftat beging, hat sie sich selbst exkommuniziert. Der Bischof von Innsbruck hat lediglich dafür gesorgt, ihr mitzuteilen, daß sie sich aufgrund ihres Vergehens gegen den katholischen Glaubens ipso facto aus der Gemeinschaft der Gläubigen ausgeschlossen hat. Das heißt: Wir teilen dir mit, daß du dich selbst exkommuniziert hast und damit aus der Gemeinschaft der Kirche ausgeschieden bist und daß die Kirche deshalb gegen dich kanonische Maßnahmen ergreift.
Falsches Verständnis von Liebe und Barmherzigkeit – Bischöfe schweigen
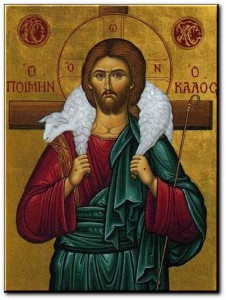 Anders liegt die Sache beim genannten Genueser Priester Paolo Farinella, der alles getan hat, um für mehrere Monate von seinem Bischof das Recht entzogen zu bekommen, zu predigen, öffentlich die Heilige Messe zu zelebrieren und die Beichte zu hören, jedenfalls solange, bis nicht geklärt ist, wie er sich künftig öffentlich zu verhalten gedenkt, da sein bisheriges Verhalten der sakramentalen Würde des Priestertums großen Schaden zugefügt hat. Eine solche überfällige Maßnahme wird jedoch gegen Farinella nicht ergriffen wegen der derzeit vorherrschenden Auffassung von Liebe und Barmherzigkeit. Zumindest solange es sich nicht um die Franziskaner der Immakulata und ihren Gründer, jenen „Schwerverbrecher“ und „notorischen Häretiker“ handelt, denn dann geht das Schlachtbeil unerbittlich nieder, obwohl viele Bischöfe und Kardinäle in ihren privaten Wohnzimmern diese kommissarische Zerstörung mißbilligen. Öffentlich aber schweigen alle aus Angst, irgendein Privileg, eine Präbende oder eine Beförderung auf einen besseren Stuhl zu verlieren?
Anders liegt die Sache beim genannten Genueser Priester Paolo Farinella, der alles getan hat, um für mehrere Monate von seinem Bischof das Recht entzogen zu bekommen, zu predigen, öffentlich die Heilige Messe zu zelebrieren und die Beichte zu hören, jedenfalls solange, bis nicht geklärt ist, wie er sich künftig öffentlich zu verhalten gedenkt, da sein bisheriges Verhalten der sakramentalen Würde des Priestertums großen Schaden zugefügt hat. Eine solche überfällige Maßnahme wird jedoch gegen Farinella nicht ergriffen wegen der derzeit vorherrschenden Auffassung von Liebe und Barmherzigkeit. Zumindest solange es sich nicht um die Franziskaner der Immakulata und ihren Gründer, jenen „Schwerverbrecher“ und „notorischen Häretiker“ handelt, denn dann geht das Schlachtbeil unerbittlich nieder, obwohl viele Bischöfe und Kardinäle in ihren privaten Wohnzimmern diese kommissarische Zerstörung mißbilligen. Öffentlich aber schweigen alle aus Angst, irgendein Privileg, eine Präbende oder eine Beförderung auf einen besseren Stuhl zu verlieren?
Aus diesem Grund wäre ein klares und einheitliches Verständnis des Kirchenrechts und des internen Lebens der Kirche wichtig sowie ein korrektes Verständnis der Barmherzigkeit, indem zu letzterer einzig auf einer theologischen Ebene vorgegangen wird. Denn wenn die apostolische Autorität und die christliche Gerechtigkeit fehlen, die auf der zentralen göttlichen Tugend der Liebe erbaut sind, wenn das Gute böse und das Böse gut wird, kann man weder von Barmherzigkeit noch von Vergebung sprechen, wennschon nur vom ewigen Verführer, der heute umso eifriger am Werk ist, den Affen Gottes zu spielen, wie ihn der Kirchenvater Hieronymus nannte: der Teufel, der seit jeher darauf abzielt, das Gute und Böse umzukehren, um eine andere, widergöttliche Wirklichkeit zu schaffen.
Und heute scheint ihm das, leider, meisterhaft zu gelingen.
Einleitung/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va/Pro Spe Salutis

