 (Paris) Vor genau 700 Jahren, am 18. März 1314, wurde in Paris Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt. Jacob von Molay war der dreiundzwanzigste und letzte Großmeister des Templerordens. Der Ritterorden der Pauperes commilitones Christi templique Salomonici Hierosalemitanis, der „Armen Kampfgefährten Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem“ war 1118 im Zuge der Kreuzzüge entstanden und vereinte erstmals die Ideale des Rittertums mit jenen des Mönchtums. Zum Motto erwählten sich die Templer den Psalmvers „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!“ (Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre).
(Paris) Vor genau 700 Jahren, am 18. März 1314, wurde in Paris Jacques de Molay auf dem Scheiterhaufen als Ketzer verbrannt. Jacob von Molay war der dreiundzwanzigste und letzte Großmeister des Templerordens. Der Ritterorden der Pauperes commilitones Christi templique Salomonici Hierosalemitanis, der „Armen Kampfgefährten Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem“ war 1118 im Zuge der Kreuzzüge entstanden und vereinte erstmals die Ideale des Rittertums mit jenen des Mönchtums. Zum Motto erwählten sich die Templer den Psalmvers „Non nobis Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam!“ (Nicht uns, o Herr, nicht uns, sondern Deinem Namen gib Ehre).
Die Mönchsritter waren eine der effizientesten, sagenumwobensten wenn auch bis heute umstrittensten Erscheinungen der Kirchengeschichte. Die Moslems regierten bereits seit Jahrhunderten über das Heilige Land. Als die christlichen Pilger nicht mehr ungehindert die Heiligen Stätten besuchen konnten und von Zerstörungen an den Heiligen Stätten erfuhren, rüsteten sie zur Befreiung jenes Gebiets, das bis ins frühe 7. Jahrhundert zum Oströmischen Reich gehört hatte. Ostrom war jedoch zu schwach, sich der andrängenden islamischen Heere zu erwehren. Initialzündung für die Kreuzzüge war ein Hilferuf Ostroms nach der Eroberung von Byzanz durch die Seldschuken. Ein Hilferuf, der im Westen nicht ungehört blieb. Zudem war die Bevölkerung des Heiligen Landes damals noch zu einem beträchtlichen Teil christlich.
Militärischer Hospitalorden verknüpfte Rittertum und Mönchstum
Der Schutz der Pilger war das erste und vorrangige Ziel des Ordens. Bereits vor den Tempelherren gab es Hospitalorden, die sich der Pilger annahmen. Ihre Schutzlosigkeit vor islamischen Angriffen ließ im Templerorden eine ganz neue Organisationsform entstehen, die selbst den eigenen militärischen Schutz übernahm. Eine Organisationsform, der dann andere Orden folgten, wie der ältere Johanniterorden (Malteser) und der Deutsche Orden. Der Orden gewann durch zahlreiche Stiftungen und durch eine ritterliche Ausrichtung durch die Sammlung der christlichen Elite Europas rasch an Bedeutung. Eigene militärische Aktionen führte er mit mehr oder weniger Fortüne durch.
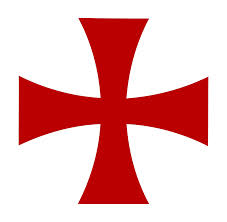 Von Europa bis ins Heilige Land errichtete er ein wohlorganisiertes Netz an Niederlassungen und Hospizen, um den christlichen Pilgern von ihrer Abreise bis zu den Heiligen Stätten Schutz und Versorgung zu gewährleisten. Dazu kamen Organisationstrukturen in Europa, für die Verwaltung der Ordensbesitzungen, mit denen maßgeblich die Kosten für das Hospiznetz und die Niederlassungen im Heiligen Land, einschließlich des stehenden Heeres bestritten werden mußten. Der Hauptsitz des Ordens befand sich in Paris.
Von Europa bis ins Heilige Land errichtete er ein wohlorganisiertes Netz an Niederlassungen und Hospizen, um den christlichen Pilgern von ihrer Abreise bis zu den Heiligen Stätten Schutz und Versorgung zu gewährleisten. Dazu kamen Organisationstrukturen in Europa, für die Verwaltung der Ordensbesitzungen, mit denen maßgeblich die Kosten für das Hospiznetz und die Niederlassungen im Heiligen Land, einschließlich des stehenden Heeres bestritten werden mußten. Der Hauptsitz des Ordens befand sich in Paris.
Schutz des Heilgen Landes und Reconquista
Neben dem Heiligen Land nahm der Orden auch an der Reconquista der Iberischen Halbinsel von den Moslems teil. Hauptländer des Templerordens waren das heutige Frankreich und England. Kernland war dabei der damalige Grenzraum zwischen französischen und dem römisch-deutschen Reich. Auch Jacob von Molay stammte aus dieser Gegend. Geboren wurde er um 1244 in der Freigrafschaft Burgund, die damals noch nicht zu Frankreich gehörte, sondern Reichsgebiet war. Das Kapitel der Kreuzritterstaaten brach nach 200 Jahren aus Kosten- und Nachschubmangel unter den Schlägen der islamischen Truppen zusammen. Die Templer hielten bis September 1302 ihren letzten Stützpunkt, eine kleine Insel vor der syrischen Küste.
Der Stern der Ritterorden im Heiligen Land ging Ende des 13. Jahrhunderts unter. Die Johanniter und die Deutschordensritter hatten inzwischen Territorialherrschaften entwickelt (Zypern, Rhodos, Preußen, Baltikum) und darin neue Aufgaben gefunden.
Philipp IV. und der drohende Staatsbankrott Frankreichs
 Das Ende des mächtigen Tempelordens wurde ihm letztlich zum Verhängnis. Frankreichs König Philipp IV. der Schöne (1285–1314) stand vor dem Staatsbankrott. Durch die Ausrufung eines Kreuzzuges bei gleichzeitiger Ausschaltung des Tempelordens, konnte er sich ihres Vermögens bedienen und den Staatshaushalt sanieren. Ein System des Raubs, das die sich festigenden Territorialstaaten im Laufe der Geschichte immer wieder anwenden sollten. Im Gegensatz zur Kirche war der Orden allerdings eine bewaffnete Streitmacht. So kampferprobt sie gegen die Moslems waren, so arglos waren sie jedoch gegen ihre Gegner zu Hause. Das Papsttum war geschwächt und geriet in immer direktere Abhängigkeit des französischen Königs. Seit 1309 lebten die Päpste für einige Jahrzehnte im Avignoner Exil.
Das Ende des mächtigen Tempelordens wurde ihm letztlich zum Verhängnis. Frankreichs König Philipp IV. der Schöne (1285–1314) stand vor dem Staatsbankrott. Durch die Ausrufung eines Kreuzzuges bei gleichzeitiger Ausschaltung des Tempelordens, konnte er sich ihres Vermögens bedienen und den Staatshaushalt sanieren. Ein System des Raubs, das die sich festigenden Territorialstaaten im Laufe der Geschichte immer wieder anwenden sollten. Im Gegensatz zur Kirche war der Orden allerdings eine bewaffnete Streitmacht. So kampferprobt sie gegen die Moslems waren, so arglos waren sie jedoch gegen ihre Gegner zu Hause. Das Papsttum war geschwächt und geriet in immer direktere Abhängigkeit des französischen Königs. Seit 1309 lebten die Päpste für einige Jahrzehnte im Avignoner Exil.
Schwacher Papst und Anklage wegen Ketzerei
König Philipp IV. war es gelungen, von Papst Clemens V. (1305–1314), einem persönlichen Freund, die Zustimmung zu einem Prozeß gegen die Templer zu erlangen. 1307 ließ Philipp IV. alle Templer Frankreichs festnehmen, die sich ohne Widerstand abführen ließen. Der Orden sollte wegen Ketzerei vor Gericht gestellt worden. Noch heute mutet es atemraubend an, die konstruierte Anklage gegen den Orden zu lesen. Die Geständnisse aufgrund derer die Verurteilung erfolgte, wurden durch Folter erpreßt. Großmeister Molay gestand Ende Oktober 1307 nach schwerer Folter. Am 24. Dezember desselben Jahres widerrief er jedoch sein Geständnis und beschwor seine Unschuld. Eine Position, die er nicht mehr verlassen sollte. Die Bemühungen Clemens V. den Orden in irgendeiner Form zu retten, mißlangen. Zu schwach, dem König zu widerstehen, berief er schließlich ein Konzil nach Vienne ein, nachdem 1310 Philipp IV. in Frankreich mit der demonstrativen, öffentlichen Verbrennung von Templern begonnen hatte. Der Papst ließ in seinem weltlichen Herrschaftsbereich keinen Templer hinrichten, was unterstreichen sollte, daß die Bedrängung des Ordens vom König von Frankreich ausging. Das Konzil verurteilte 1312 den Orden in einem aufsehenerregenden Prozeß. Im Ringen zwischen päpstlicher und königlicher Macht unterlag der Papst und ließ, um die eigene Autorität einigermaßen zu retten, den Orden „über die Klinge springen“. Dante Alighieri schrieb ihn dafür in seiner „Göttlichen Komödie“ in die Hölle.
Aufhebung des Ordens – Molays Schlußworte „vor Gott und der Welt“
 Mit der Bulle Vox in excelso hob Clemens V. den Orden am 22. März 1312 auf. Nach dem Konzil zogen viele Ordensritter mutig ihre erzwungenen Geständnisse zurück und beteuerten ihre Unschuld. So konnten sie als reulose Ketzer verbrannt werden. Am 18. März 1314 wurde auch über Großmeister Jacob von Molay das Urteil gesprochen. Am Ende des Prozesses stand von Molay auf und bekräftigte noch einmal mit lauter Stimme „vor Gott und der Welt“ seine Unschuld und seine ungebrochene Treue zum katholischen Glauben: „Auf der Schwelle des Todes, wo auch die leiseste Lüge schwer wiegt, gestehe ich im Angesicht des Himmels und der Erde, daß ich große Sünde gegen mich und die Meinigen begangen und mich des bitteren Todes schuldig gemacht habe, weil ich mich, um mein Leben zu retten und dem Übermaße an Martern zu entgehen, vor allem durch Schmeichelworte des Königs und des Papstes verlockt, gegen meinen Orden und mich erhoben habe. Jetzt aber, wiewohl ich weiß, welches Los meiner harrt, will ich keine Lüge zu den alten häufen und, indem ich erkläre, daß der Orden stets rechtgläubig und rein von Schandtaten war, verzichte ich freudig auf mein Leben.“ [1]Michael Hesemann: Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte, 2. unveränd. Aufl.,Augsburg 2008, S. 151 Noch am Abend desselben Tages wurde Jacob de Molay und der Ordensmeister der Normandie auf der àŽle de la Cité in Paris, der kleinen Insel in der Seine, auf der auch die Kathedrale Notre-Dame du Paris steht, verbrannt. Eine kleine Gedenktafel erinnert an den skandalösen Justizmord.
Mit der Bulle Vox in excelso hob Clemens V. den Orden am 22. März 1312 auf. Nach dem Konzil zogen viele Ordensritter mutig ihre erzwungenen Geständnisse zurück und beteuerten ihre Unschuld. So konnten sie als reulose Ketzer verbrannt werden. Am 18. März 1314 wurde auch über Großmeister Jacob von Molay das Urteil gesprochen. Am Ende des Prozesses stand von Molay auf und bekräftigte noch einmal mit lauter Stimme „vor Gott und der Welt“ seine Unschuld und seine ungebrochene Treue zum katholischen Glauben: „Auf der Schwelle des Todes, wo auch die leiseste Lüge schwer wiegt, gestehe ich im Angesicht des Himmels und der Erde, daß ich große Sünde gegen mich und die Meinigen begangen und mich des bitteren Todes schuldig gemacht habe, weil ich mich, um mein Leben zu retten und dem Übermaße an Martern zu entgehen, vor allem durch Schmeichelworte des Königs und des Papstes verlockt, gegen meinen Orden und mich erhoben habe. Jetzt aber, wiewohl ich weiß, welches Los meiner harrt, will ich keine Lüge zu den alten häufen und, indem ich erkläre, daß der Orden stets rechtgläubig und rein von Schandtaten war, verzichte ich freudig auf mein Leben.“ [1]Michael Hesemann: Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte, 2. unveränd. Aufl.,Augsburg 2008, S. 151 Noch am Abend desselben Tages wurde Jacob de Molay und der Ordensmeister der Normandie auf der àŽle de la Cité in Paris, der kleinen Insel in der Seine, auf der auch die Kathedrale Notre-Dame du Paris steht, verbrannt. Eine kleine Gedenktafel erinnert an den skandalösen Justizmord.
Der Makel und das ungeklärte Erbe der Templer
Andere Ordensmeister blieben bis zu ihrem Tod eingekerkert. Allein auf der Iberischen Halbinsel, wo der Orden bei der Reconquista treue Dienste geleistet hatte, erfolgten Freisprüche. In Aragon 1316 und in Portugal 1319 gründeten die Könige den Orden von Montesa und den Orden der Christusritter, in denen Tempelritter aus ganz Europa, soweit sie sich der Verfolgung entziehen konnten, Aufnahme fanden und auch in der Symbolik, so im roten Ordenskreuz das Erbe der Templer erkennen ließen. Beide Orden existieren heute nicht mehr.
Das Versagen der weltlichen und kirchlichen Autorität fand in der Hinrichtung Molays ihren sichtbaren Höhepunkt. Er steht bis heute als ungetilgter Makel in der Kirchengeschichte. Mit ein Grund, weshalb die Kirche die Wiederherstellung des Templerordens nie gestattete. Während der Malteserorden und der Deutsche Orden, um die bekanntesten zu nennen, ununterbrochen fortbestanden und deshalb auch heute in der Kirche ihren Platz haben, lehnt die Kirche eine Neu- oder Wiedergründung der Tempelherren ab. Völlig zu Unrecht versuchte die Freimaurerei das Erbe der Templer im antikirchlichen Sinn anzutreten. Ein Grund mehr, weshalb das Wort Templer in katholischen Kreisen lange negativ besetzt war. 2007 machte der Heilige Stuhl die Akten des Prozesses gegen die Templer zugänglich. Das Aktenstudium bestätigte die Annahme, daß es sich um einen Justizskandal größten Ausmaßes handelte.
Heute gibt es in der Katholischen Kirche eine Reihe von anerkannten Laienorganisationen, die sich auf die Tradition der Tempelritter berufen, ohne jedoch die direkte Nachfolge beanspruchen zu können. Daneben existieren allerdings auch eine Vielzahl nicht anerkannter Vereinigungen, die zum Teil sogar antikatholisch, masonisch oder sogar satanistisch ausgerichtet sind.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons
-
| ↑1 | Michael Hesemann: Die Dunkelmänner. Mythen, Lügen und Legenden um die Kirchengeschichte, 2. unveränd. Aufl.,Augsburg 2008, S. 151 |
|---|


Es handelt sich um Mohammedaner.
Die „Verurteilung“ des Ritter-Ordens der Templer anfangs des 14. Jahrhunderts
– inszeniert durch König Philip IV: von Frankreich -
wegen angebl. „Häresie“ und „Sodomie“ wurde im Jahre 2005 vom Vatican in der
„Documenta Vaticana“ als Intrige offengelegt…
Der im
„Chinon-Dokument“
gefundene Freispruch der Templer durch Papst Clemens V. vom 17. August 1308…
ist die Grundlage für folgende Rehabilitierung
des Ritter-Ordens der „Templer“ durch den Vatican…Auszug aus der
„Documenta Vaticana“ aus dem Jahre 2005:
-
„Trotz aller vom König Philipp IV. ersonnenen Behinderungen
konnte Clemens V. den arglistigen Anklagevorwurf der königlichen Anwälte aufdecken.
Die Anschuldigungen der Ketzerei und Sodomie bestanden
aus Intrigen durch vom König in dem Orden eingeschleusten Spionen.Nicht zuletzt handelt es sich um den Kampf Philipps IV. Gegen die Autorität des Papstes. Nach Monaten kräftezehrender Kämpfe begriff Papst Clemens V., dass er die Kirche nur retten konnte, wenn er in der Sache der Templer nachgab.
Fiel der Orden auch durch die Bulle „Vox in excelso“ des Papstes im Jahre 1312 der Auflösung definitiv anheim,
so konnte Clemens V. doch wenigstens die Unschuld der Tempelritter behaupten, die so viel für das Wohl der Kirche getan hatten“
-