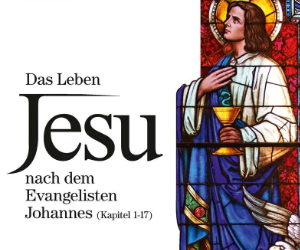(Rom) Auf der katholischen Nachrichtenseite „La Nuova Bussola Quotidiana“ (NBQ) findet eine intensive Diskussion führender katholischer Denker über die Lage der Katholischen Kirche statt. Den Anstoß dazu gab ein Brief des Rechtsphilosophen Mario Palmaro an den Chefredakteur von NBQ (siehe Das Problem ist das Schweigen der Kirche – Mario Palmaro und der Rauch Satans). Daraus entwickelte sich ein ganze Kette von Stellungnahmen für und wider die aktuelle Situation und das neue Pontifikat. Mario Palmaro ist der international akzentuierteste Kritiker des bisherigen Vorgehens von Papst Franziskus. Wegen des gemeinsam mit Alessandro Gnocchi verfaßten Aufsatzes Christus ist keine Option unter vielen, schon gar nicht für seinen Stellvertreter auf Erden – Warum uns dieser Papst nicht gefällt haben beide Autoren eine Reihe von persönlichen Nachteilen zu tragen. Papst Franziskus rief den schwer erkrankten Palmaro an (siehe Papstkritiker Mario Palmaro erhält Anruf von Papst Franziskus – „Es ist wichtig, Kritik zu bekommen“). Der jüngste Beitrag in der NBQ-Debatte stammt von der Historikerin Cristina Siccardi. Von ihr stammt unter anderen der Beitrag Hilarius von Poitiers – Ein Christ, der vor den Mächtigen der Welt keinen Kniefall machte. „Der moderne Mensch (einschließlich viele Kirchenmänner) ist es nicht mehr gewöhnt, mit dem eigenen Kopf zu denken. Er zieht es vor, sich träge den Illusionen menschlicher Instinkte und Gefühle hinzugeben, ohne die Gebote Gottes zu beachten“, so Siccardi. Hier der vollständige Debattenbeitrag.
(Rom) Auf der katholischen Nachrichtenseite „La Nuova Bussola Quotidiana“ (NBQ) findet eine intensive Diskussion führender katholischer Denker über die Lage der Katholischen Kirche statt. Den Anstoß dazu gab ein Brief des Rechtsphilosophen Mario Palmaro an den Chefredakteur von NBQ (siehe Das Problem ist das Schweigen der Kirche – Mario Palmaro und der Rauch Satans). Daraus entwickelte sich ein ganze Kette von Stellungnahmen für und wider die aktuelle Situation und das neue Pontifikat. Mario Palmaro ist der international akzentuierteste Kritiker des bisherigen Vorgehens von Papst Franziskus. Wegen des gemeinsam mit Alessandro Gnocchi verfaßten Aufsatzes Christus ist keine Option unter vielen, schon gar nicht für seinen Stellvertreter auf Erden – Warum uns dieser Papst nicht gefällt haben beide Autoren eine Reihe von persönlichen Nachteilen zu tragen. Papst Franziskus rief den schwer erkrankten Palmaro an (siehe Papstkritiker Mario Palmaro erhält Anruf von Papst Franziskus – „Es ist wichtig, Kritik zu bekommen“). Der jüngste Beitrag in der NBQ-Debatte stammt von der Historikerin Cristina Siccardi. Von ihr stammt unter anderen der Beitrag Hilarius von Poitiers – Ein Christ, der vor den Mächtigen der Welt keinen Kniefall machte. „Der moderne Mensch (einschließlich viele Kirchenmänner) ist es nicht mehr gewöhnt, mit dem eigenen Kopf zu denken. Er zieht es vor, sich träge den Illusionen menschlicher Instinkte und Gefühle hinzugeben, ohne die Gebote Gottes zu beachten“, so Siccardi. Hier der vollständige Debattenbeitrag.
.
Sie zerstören die Familie, dazu kann man nicht schweigen
von Cristina Siccardi
Mit Nachdruck danke ich für die begonnene Debatte. Bereits bei ruhigem Seegang ist ein lethargisches Verhalten nicht besonders gesund, um so weniger mitten in einem Sturm, wie jenem, durch den die Kirche gerade segelt. Vor den verängstigten Augen der Gläubigen vollzieht sich ein grausames Gemetzel sowohl gegen das Naturrecht als auch gegen die christlichen Grundsätze, auf denen Europa erbaut wurde. Und die Kirche ist in ihrer ganzen hierarchischen Ausgestaltung vom Papst bis zum Dorfpfarrer gerufen, ihre Einhaltung durch einen besseren irdischen Lebenswandel anzumahnen, um der Herrlichkeit Gottes die Ehre zu erweisen und um die Seelen zu retten. Die Gläubigen können nicht einfach sich selbst überlassen werden. Das hieße, sie dieser verkommenen Gesellschaft zum Fraß vorzuwerfen, wie Professor Mario Palmaro es mit seinen trefflichen Überlegungen in „Der Rauch Satans in der Kirche“ ausgezeichnet dargelegt hat, ein Rauch, den Paul VI. bereits vor 44 Jahren sichtete – zum großen Ärgernis klerikaler Spießer. Was wird aus unseren Kindern und unseren Enkelkindern werden? Die Verantwortung ist erschreckend groß… wir liefern sie kranken, korrupten und perversen Ungeheuern aus, die vom Laster und der Sünde geleitet und angetrieben werden.
2000 Vergebungsbitte für die Sünden der Kirche – Was müßte dann heute für die Unterlassungen der Kirche geschehen?
Am 12. März 2000, dem ersten Sonntag der Fastenzeit, zelebrierte Johannes Paul II. die Heilige Messe zusammen mit den Kardinälen und bat Gott um „Verzeihung für die vergangenen und gegenwärtigen Sünden der Kinder der Kirche“. Eine Initiative, die viele Diskussionen auslöste. Was aber wird man erst zu den Unterlassungen von heute sagen? Man kann nicht zaudern vor dem Abtreibungsgenozid, vor der Zerstörung der Familie bis hinab zu ihren Wurzeln, vor den neuen europäischen Schulrichtlinien zur ideologischen Indoktrination der Kinder, die zu unschuldigen Opfern diabolischer und infernalischer Lehren werden. Gott der Richter existiert weiterhin, auch wenn die zeitgenössische Kultur ihn sich selbstbetrügend abgeschafft hat.
Die Intelligenz in Lebensgefahr
1969 erschien in Paris ein Buch, das geradezu perfekt in die philosophische Gegenwart paßt: „L’intelligence en péril de mort“ (Die Intelligenz in Todesgefahr) von Marcel de Corte (1905–1994). In diesem Buch behandelte der Autor die schlimmsten und gefährlichsten Mißverständnisse unserer Zeit. Die menschliche Intelligenz, die Selbstmord begeht (auf der Ebene der Qualität seines natürlichen und geistlichen Lebens, aber auch auf demographischer Ebene), wurde vom menschlichen Wissen verstoßen, das sich von mathematischen Gewißheiten, erbarmungslosen Analysen und unersättlicher Gier nach sofortigem Genuß nährt. Ein Verfall, der auf Treibsand baut. In seiner Diagnose nennt de Corte die Krankheit beim Namen und zerstreut die Nebel des Trugbildes. Die modernen Lehren, die der Macht der Medien hörig sind, stehen in der Gesellschaft teuflischer Gedanken, die das Individuum der Verzweiflung seiner Schamlosigkeit überlassen.
Der moderne Mensch (einschließlich viele Kirchenmänner) ist es nicht mehr gewöhnt, mit dem eigenen Kopf zu denken. Er zieht es vor, sich träge den Illusionen menschlicher Instinkte und Gefühle hinzugeben, ohne die Gebote Gottes näher zu beachten. Nur die ewiggültige und unveränderliche Wahrheit (in der es die Moderne nicht gibt, da diese nur auf einen kurzen irdischen Zeitraum fixiert ist) kann uns wirklich sagen, was ein Mann und eine Frau wirklich sind, woher sie kommen und wofür sie bestimmt sind. Dafür müssen wir jedoch vom Wunsch nach dem Übernatürlichen und der Sehnsucht nach der Stille und der Betrachtung beseelt sein (in diesem Zusammenhang muß an den klarsichtigen Philosophen und Theologen Cornelio Fabro erinnert werden). Haltungen, die dem „modernen“ Menschen geradezu ein quälender Greuel zu sein scheinen.
Der Widerspruch, der zur heutigen Entwicklung führte
Ein anderes Buch könnte gut tun, um nicht in trügerischen, sondern realistischen Maßstäben zu denken. Guido Vignelli schrieb dazu: „Die kirchlichen Hierarchie verurteilt die Individuen (Mütter oder Ärzte), die Abtreibung praktizieren, spricht aber die Abgeordneten frei, die sie legalisieren und die Minister, die deren Umsetzung institutionell organisieren. Die Geschichte aber zeigt, daß die Säkularisierung des individuellen Lebens und der Familie durch die Säkularisierung des sozialen Lebens vorbereitet und begünstigt wird! Es stellt sich daher die Frage, wie und warum wir zu diesem Widerspruch gekommen sind, der den Verfall und die Erstarrung des sozialen Einsatzes der Kirche begünstigt hat“. Der Sammelband ist in spanischer und französischer Sprache erschienen und wird demnächst auch in italienischer Ausgabe erscheinen [1]Eine deutsche Ausgabe ist nach aktuellem Wissensstand derzeit leider noch nicht geplant. : „Iglesia y polà¬tica: cambiar de paradigma“ (Madrid 2013), „Eglise et politique: changer de paradigme“ (Paris 2013). Der Band versammelt die Aufsätze von zwölf Autoren, Universitätsprofessoren der Politik- und Rechtswissenschaften (Giovanni Turco, Miguel Ayuso, Danilo Castellano, Juan Fernando Segovia, Julio Alvear, Gilles Dumont), der Geschichte (Christophe Réveillard, John Rao), der Philosophie (Sylvain Luquet, José Miguel Gambra) und nicht zuletzt der Theologie (Bernard Dumont, Pater Ignacio Barreiro). Die Texte unterscheiden sich grundlegend von denen jener, die sich einem Pragmatismus um jeden Preis verschworen haben, der selbst das Unvereinbare zu vereinbaren versucht im vergeblichen Versuch, den Mittelweg immer als idealen Weg präsentieren zu wollen. Es genügt auf die vergangenen Jahrzehnte zu schauen, um zu sehen, wohin uns dieser „goldene Mittelweg geführt hat“ von Verantwortungsträgern und Politiker, die den Kompromiß auch bei den nicht verhandelbaren Werten über alles lieben.
Der Papst hat immer recht? Das Beispiel von Kardinal Billot
Eine geradezu brutale Simplifizierung ist es, zu sagen: „Der Papst hat immer recht“. Ein Beispiel: Der französische Jesuit und herausragende Katholik, Louis Kardinal Billot, der vor einem radikalen Laizismus der Staaten warnte, kritisierte scharf die Haltung von Pius XI. zur Action française, die 1926 vom Heiligen Stuhl verurteilt wurde. Eine Verurteilung, die von Pius XII. 1939 als falsch erkannt und zurückgenommen wurde. Die Action française veröffentlichte nach der Verurteilung einen kritischen Artikel und Kardinal Billot übermittelte eine Grußbotschaft, in der er dem Artikel zustimmte. Der Kirchenfürst wurde dafür am 13. September 1927 in den Vatikan zitiert und vom Papst in Audienz empfangen. Wenige Minuten nachdem er eingetreten war, verließ Billot den Audienzsaal ohne purpurnen Pileolus, ohne Kardinalsring und ohne Brustkreuz. Er hatte ohne zu zögern auf seine Kardinalswürde verzichtet, weil er so empört war über die harte Position des Papstes und des Staatssekretariats gegen die Action française. Der bekannte Thomist, den der Heilige Pius X. zum Kardinal erhoben und der maßgeblich an dessen Enzyklika Pascendi Dominici Gregis mitgewirkt hatte, starb als einfacher Priester des Jesuitenordens 1931 in der mittelitalienischen Kleinstadt Ariccia, wo er bis zu seinem Tod im Ordensnoviziat wirkte. Er sollte der einzige Kardinal sein, der im 20. Jahrhundert seine ihm bereits verliehene Würde ablegte und darauf verzichtete.
Schließlich sollte nicht vergessen werden, daß die Moral nicht allein eine Frage der Ergebnisse und der Eignung der Mittel zu ihrer Erreichung ist. Die Moral ist an erster Stelle eine Auswahl der Ziele: die Ethik gehört essentiell, wie der Heilige Thomas von Aquin feststellt, zur Ordnung des zweckbezogenen Handelns. Der Gebrauch der angemessenen Mittel, um die Ziele zu erreichen, ist diesen nachgeordnet.
Kein Pragmatismus und klerikaler Machiavellismus
„Die Moral leitet sich vom Dogma ab“ hat die Kirche immer gelehrt, das heißt, daß die Ethik ihren Ursprung und ihren Grund in der objektiven Realität findet und daher nicht dem Relativismus des Subjekts und der Zeit anvertraut werden kann. Daraus folgt, daß die Strategien der Kirche, wie jene einer jeden Person und einer jeden Gesellschaft, gut sind, wenn sie zum Wahren und Guten führen, falsch sind, wenn sie zum Falschen und Schlechten führen. Der Pragmatismus, der klerikale Machiavellismus (oder wenn wir wollen, der klerikale Weberismus, der so intensiv in der amerikanischen Kultur unter dem Deckmantel der sogenannten „Ethik der Verantwortung“ gepflegt wird) in Kirchenangelegenheiten führt zwangsläufig dazu, der Kirche zu schaden und schließlich zu scheitern, weil die Kirche dem König, Christus gehört, der während seiner Lehrzeit auf Erden gute und richtige (heilige) Methoden gebrauchte, die einem guten und richtigen (heiligen) Ziel dienten.
Im übrigen (wie bereits ausgezeichnet von Palmaro dargelegt) ist es nicht zu fassen, daß einige auch im katholischen Bereich Aussagen und Teile des Denkens vergangener Autoren isolieren, um sie so in die philosophischen, theologischen Theorien unserer Zeit zu integrieren und diesen dienstbar zu machen. Dieser Trick nennt sich Kryptohistorismus und bedeutet konkret, daß man diesen Autoren der Vergangenheit gegenwärtige antithetische Lehren unterschiebt.
Und auch kein Kryptohistorismus
Der heilige Ignatius zum Beispiel ist kein Produkt der Moderne und wird es auch nie sein, jener Moderne, die aus der antichristlichen und gnostisierenden Aufklärung und deren Nachfolger hervorgegangen ist. Der heilige Gründer des Jesuitenordens war ein eindeutiger Verfechter der Gegenreformation zu einer Zeit, als der Subjektivismus (die freie protestantische Erkenntnis) auf dem Widerspruch gegen die überlieferte Tradition der Kirche beharrte, die diese durch die Jahrhunderte bewahrt und verteidigt hatte und weiterhin bewahrte, um sie den nächsten Generationen weiterzugeben.
Daher richten wir Gläubige des 21. Jahrhunderts unsere flehentliche Bitte an die kirchliche Autorität, nicht die subjektiven Meinungen zu verteidigen (die nichts anderes zustande bringen, als Verwirrung über Verwirrung zu stiften, weil sie nicht der göttlichen Ordnung entsprechen), sondern unerschrocken die Wahrheit Christi zu bewahren und verteidigen, wie sie ihr von unserem Herrn anvertraut und von ihr durch zwei Jahrtausende bewahrt und verteidigt wurde und zwar nur durch die Heilige Kirche und niemanden sonst. Auf dieselbe Weise ist auch die Seelsorge (nach Methode und Mittel) gerufen, denselben Weg zu gehen zum einzigen Zweck ihrer Existenz, nämlich den Menschen zu retten, vollständig, seine Seele und seinen Körper. Getrennte Wege zwischen Lehre und Pastoral sind undenkbar. Daher kann es auch keine pragmatische Pastoral, aber eine traditionelle Lehre geben. Ein Widerspruch, der zum Scheitern verurteilt ist.
Newman: Katholische Religion von Gott gestiftet zur Rettung der Menschen – andere Religionen nur Imitationen
In seiner Predigt vom 2. Februar 1849 lud der selige John Henry Newman in der Kapelle des Oratoriums des Heiligen Philipp Neri von Birmingham, das von ihm im Jahr zuvor gegründet worden war, die Anwesenden ein, unter denen sich auch Anglikaner befanden, die von der Neugierde angezogen wurden: „den Weg des Todes zu verlassen, um gerettet zu werden. Das verlangt nichts Großes, nichts Heroisches oder Heiliges. Es verlangt allein die Überzeugung, und diese fehlt uns nicht, daß die katholische Religion von Gott gestiftet wurde zur Rettung der Menschen, und daß die anderen Religionen nichts anderes als Imitationen sind […] Ich lade Euch nur dazu ein, zu bedenken, in erster Linie, daß Ihr Seelen habt, die zu retten sind, und in zweiter Linie für Euch zu prüfen ob, da Gott eine Religion gestiftet hat, um Euch zu retten, diese Religion eine andere sein kann, als der Glaube, den wir verkünden.“
Text: NBQ/Giuseppe Nardi
Bild: Concilio e Post-Concilio
-
| ↑1 | Eine deutsche Ausgabe ist nach aktuellem Wissensstand derzeit leider noch nicht geplant. |
|---|