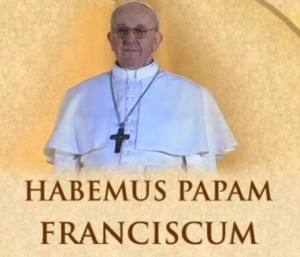 (Rom) Er reduziert das Gewicht des Interviews, das er Eugenio Scalfari gab, er korrigiert sein Urteil über das Zweite Vatikanische Konzil und er distanziert sich von den progressiven Strömungen in der Kirche, die ihm bisher Rosen streuten und ihn mit Applaus überhäuften. Die Massenmedien schweigen zu diesem Kurswechsel. So es denn einer ist. „Auch der Papst übt Selbstkritik und korrigiert drei Fehler“, schrieb der Vatikanist Sandro Magister.
(Rom) Er reduziert das Gewicht des Interviews, das er Eugenio Scalfari gab, er korrigiert sein Urteil über das Zweite Vatikanische Konzil und er distanziert sich von den progressiven Strömungen in der Kirche, die ihm bisher Rosen streuten und ihn mit Applaus überhäuften. Die Massenmedien schweigen zu diesem Kurswechsel. So es denn einer ist. „Auch der Papst übt Selbstkritik und korrigiert drei Fehler“, schrieb der Vatikanist Sandro Magister.
Papst Franziskus hat die Kirche seit seiner Wahl einer Reihe von Wechselbädern ausgesetzt. Man könnte von einer Kneippkur mit Warm- und Kaltwasser und Zwischenaufenthalten in der Sauna oder einer Infrarotkabine sprechen. Der wohltuende Faktor oder gar ein Genesungsprozeß dieser Kur muß sich erst noch zeigen.
Ein Wechselbad erfolgte auch in den vergangenen Tagen. Die kalte Dusche bekamen diesmal die zersetzenden Kirchenauflöser am progressiven Rand ab. Deren Hardliner hielten sich zwar immer auch auf Distanz zu Papst Franziskus, weil ihnen das Papsttum grundsätzlich suspekt ist, dennoch stimmten auch sie lauthals in die Jubelchöre für den argentinischen Papst ein und versuchen ihn zu vereinnahmen. Die gemäßigteren Progressiven, die sich scharenweise im hauptamtlichen Funktionärswesen der Kirche tummeln, verehren den neuen Papst aufrichtig. Was immer auf Laissez-faire-Christentum hinweist, ist ihnen willkommen.
Nun hat Papst Franziskus aber innerhalb weniger Tage sein öffentlichen Erscheinungsbild korrigiert. Und das gleich an drei Stellen. Ein Erscheinungsbild an dem er maßgeblich mitgestrickt hatte. Doch die große Öffentlichkeit hat noch kaum Notiz davon genommen.
Korrektur 1: Das Scalfari-Interview wurde deklassiert – spät aber doch
Die erste Korrektur betrifft das Interview, das der Papst dem Atheisten Eugenio Scalfari gewährte und das am 1. Oktober in der Tageszeitung La Repubblica veröffentlicht wurde. Darüber wurde bereits geschrieben (siehe eigenen Bericht Umstrittenes Papst-Interview von Internetseite des Vatikans gelöscht), ebenso über die weiterhin offenen Fragen rund um dieses Interview. Das Interview sorgte für erhebliches Erstaunen und auch Mißbilligung. Was nichts daran änderte, daß sich katholische „Normalisten“ fanden, selbst das Nichtverteidigbare zu verteidigen. Seit gestern weiß man, daß die Antworten des Papstes von Eugenio Scalfari formuliert wurden (siehe eigenen Bericht Hintergründe zum Papst-Interview – Scalfari: „Die Antworten des Papstes habe ich selbst formuliert“). Das erklärt auch, warum die Antworten eine so starke Übereinstimmung mit dem Denken Scalfaris aufweisen und damit mehr laizistisch-atheistische als katholische Züge aufweisen. Etwa der Satz: „Jeder hat eine eigene Vorstellung von Gut und Böse und muss wählen, dem Guten zu folgen und das Böse zu bekämpfen, so wie er sie wahrnimmt.“ Allerdings genehmigte der Papst die ihm von Scalfari zugeschickte Fassung für die Veröffentlichung. Man könnte von mangelndem Verantwortungsbewußtsein sprechen.
Diese ausdrückliche Zustimmung, nachdem Scalfari das Interview vor der Drucklegung dem Papst übermittelt hatte und Franziskus damit genau wußte, was veröffentlicht wird, erklärt wahrscheinlich, warum das Interview von den Medienleuten des Vatikans sofort weiterverbreitet, ja sogar in den Rang des ordentlichen Lehramtes erhoben wurde. Maßgeblicher Akteur dieser „Aufwertung“ war Vatikansprecher Pater Federico Lombardi, der davon sprach, daß das Interview „getreu das Denken“ des Papstes wiedergibt und „in seinem Gesamtsinn authentisch ist“. Kryptische Formulierungen, die seit einigen Monaten die Wortmeldungen Lombardis durchziehen. Hinzu kam, daß der Osservatore Romano nur wenige Stunden nach der Repubblica das Interview vollinhaltlich übernahm. Ebenso die offizielle Internetseite des Heiligen Stuhls, wo es auf gleicher Ebene, unter die offiziellen Reden und Predigten des Papstes eingereiht wurde.
Jemand wird sich dabei schon etwas gedacht haben. Zwangsläufig mußte der Eindruck entstehen, daß Papst Franziskus absichtlich das Gespräch als eine Art neuer Form seines Lehramtes wählte. Offensichtlich mit dem Ziel, damit weit mehr Menschen zu erreichen als durch ein klassisches Dokument (siehe eigenen Bericht Das Interview als neue Form päpstlicher Enzykliken? – Größere Reichweite bei geringerer Verbindlichkeit?).
Was folgte war erhebliche Kritik von glaubenstreuer katholischer Seite an Form und Inhalt. Papst Franziskus muß sich letztlich selbst bewußt geworden sein, wie risikobeladen diese Form der Wortmeldungen ist. „Die Hauptgefahr liegt darin, daß das Lehramt der Kirche auf die Ebene einer Meinung unter vielen herabsinkt und auch nur mehr als solche wahrgenommen wird“, so Sandro Magister.
Am 15. November wurde das Interview schließlich von der Internetseite des Heiligen Stuhls gelöscht. Durch die Entfernung, habe man die Bedeutung des Textes auf die richtige Ebene bringen wollen, so Vatikansprecher Lombardi: „Es gab einige Mißverständnisse und Diskussionen über seinen Rang“.
Korrektur 2: Wechsel von der „Schule von Bologna“ zur Hermeneutik Benedikts XVI.
Nicht nur ans Scalfari-Interview wurde Hand angelegt. Auch das abgewogenere und ausgefeiltere Interview, das Papst Franziskus der Jesuitenzeitschrift Civiltà Cattolica gab und das am 19. September von insgesamt 16 Jesuitenzeitschriften in elf Sprachen gleichzeitig veröffentlicht wurde, „wurde in den vergangenen Tagen in die Werkstatt zurückgerufen“, so Magister.
Hier betrifft die Korrektur das Zweite Vatikanische Konzil und seine Interpretation und damit das Schlüsselthema, an dem sich die Kirche entzweit und das in den vergangenen 50 Jahren einen beispiellosen Niedergang der Kirche verursachte.
Bekannt wurde der Korrekturvorgang durch einen handgeschriebenen Brief von Papst Franziskus an Kurienerzbischof Agostino Marchetto anläßlich einer Buchvorstellung am 12. November auf dem Kapitol. Franziskus wünschte ausdrücklich, daß der Brief öffentlich vorgelesen wird (siehe eigenen Bericht „Schule von Bologna“ von „ihrem“ Papst verraten? – Papst Franziskus lobt „besten Hermeneutiker des Konzils“).
Der Papst bezeichnete Erzbischof Marchetto als „besten Hermeneuten“ des Konzils. Die Aussage ist außergewöhnlich. Im vergangenen halben Jahrhundert gab es keine vergleichbare Äußerung eines Papstes. Sie verleiht Marchettos Konzilsinterpretation umso mehr ein Gütesiegel ersten Ranges. Marchetto ist einer der schärfsten und unerbittlichsten Kritiker der progressiven, von Giuseppe Alberigo und Giuseppe Dossetti gegründeten und heute von Alberto Melloni geleiteten Schule von Bologna, die weitgehend und weltweit das Interpretationsmonopol für das Konzil in Händen hält. Auch im deutschen Sprachraum dominiert innerkirchlich die Konzilslesart der Schule von Bologna.
Die Hermeneutik Marchettos entspricht jener von Papst Benedikt XVI. und lehnt eine Lesart des „Bruchs“ und des „Neubeginns“ ab, der eine „Erneuerung in der Kontinuität“ entgegengesetzt wird. Die Kirchengeschichte bildet eine Einheit und kann nur als Einheit verstanden werden. Deshalb kann das Zweite Vatikanum nur im Licht der gesamten kirchlichen Tradition gelesen und ausgelegt werden. Was der immerwährenden Tradition widerspricht, kann keine Gültigkeit haben, so die grob zusammengefaßte Interpretationslinie. Das öffentliche Lob für den Kurienerzbischof wird in Rom allgemein als Zeichen verstanden, daß Papst Franziskus signalisieren wollte, daß er eben diese Interpretation des Konzils teilt.
Liest man aber im Civilità Cattolica-Interview, was er zum Konzil gesagt hat, dann gewinnt man einen ganz anderen Eindruck. „Ja, da gibt es Linien einer Hermeneutik der Kontinuität und der Diskontinuität“, sagte der Papst. „Aber eines ist klar“, das Konzil war ein „Dienst am Volk“, die in einem „neuen Lesen des Evangeliums im Licht der zeitgenössischen Kultur“ besteht. In den wenigen Zeilen, die er dem Konzil widmet, bewertet er das Konzil auf eine Weise, die genau jener der Schule von Bologna entspricht, einschließlich der Liturgiereform, die er miteinbezog.
Die schnelle Abhandlung des Konzils mit dieser knappen Beurteilung erschien vielen sofort als so oberflächlich, daß sogar der Interviewer des Papstes, der Schriftleiter der Civiltà Cattolica, Pater Antonio Spadaro sein Erstaunen einbekannte, als er diese Stelle vom Tonbandmitschnitt niederschrieb.
Die Aussage des Papstes fand jedoch breite Zustimmung. Die Monopolstellung der Schule von Bologna hätte kaum deutlicher zum Ausdruck kommen können. Am 14. November etwa dankte der ehemalige Kommunist und heutige Linksdemokrat, Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano dem Papst, daß er „den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils vibrieren“ lasse als „ein neues Lesen des Evangeliums im Licht der zeitgenössischen Kultur“. Der Staatspräsident zitierte damit wörtlich, was der Papst im Civiltà Cattolica-Interview gesagt hatte.
Applaus für diese Konzils-Interpretation des Papstes kam auch von Andrea Grillo, dem führenden italienischen Liturgiker, der am Päpstlichen Athenäum Sant’Anselmo unterrichtet. Laut Grillo habe Papst Franziskus damit „die wirkliche und definitive Hermeneutik des Konzils eingeleitet“, nachdem er „sofort das Gezänk um Kontinuität und Diskontinuität in die zweite Reihe verwies“, das so lange „jede effiziente Hermeneutik des Zweiten Vatikanums gelähmt“ habe. Eine kategorische Absage an die Bemühungen Benedikts XVI., das progressive Interpretationsmonopol aufzubrechen und eine Form des Triumphalismus über den deutschen Papst, den die Progressiven erst bejubelten, als er einen unhistorischen Schritt setzte und zurücktrat.
Magister macht darauf aufmerksam, daß es in der Tat kein Geheimnis ist, daß „Dienst am Volk“ und ein „neues Lesen des Evangeliums“ für seine „Aktualisierung im Heute“ Chiffren der progressiven Konzilsinterpretation sind, vor allem der Schule von Bologna. Melloni, der heutige Leiter der Schule äußerte mehrfach seine Begeisterung über die Wahl und das Pontifikat Jorge Mario Bergoglios.
Auch zu diesem Punkt scheinen, wie bereits zur Veröffentlichung des Scalfari-Interviews, einige gewichtige Stimmen im Umfeld des Papstes diesen aufmerksam gemacht zu haben, daß eine solche einseitige Auslegung zumindest „ungenau“, wenn nicht sogar „falsch“ ist, wie Sandro Magister anmerkt.
Es dürfte Kurienerzbischof Marchetto als Konzilsexperte selbst gewesen sein, der den Papst darauf aufmerksam machte. Seit einiger Zeit scheint beide ein vertrauliches Verhältnis und gegenseitige Wertschätzung zu verbinden. Und wie es in Rom heißt, hat Papst Franziskus die Kritik seines Freundes an den Konzils-Aussagen nicht nur angehört, sondern sich auch zu eigen gemacht. Soweit, daß er ihm nicht nur am 12. November öffentlich dankte, sondern ebenso öffentlich erklärte, daß Marchettos Konzilsintepretation die richtige sei und nicht die von ihm selbst im Civiltà Cattolica‑Interview geäußerte. Wörtlich dankte Papst Franziskus dem Kurienerzbischof dafür, daß er ihm dabei half „einen Fehler oder Ungenauigkeit meinerseits zu korrigieren“. Ein „Korrigieren“, das die gesamte Interpretation des Konzils betrifft.
„Daraus wäre zu schließen, daß sich Papst Franziskus künftig anders über das Konzil äußern wird als im Civiltà Cattolica-Interview. Auf eine Weise, die deutlich näher bei jener Benedikts XVI. sein müßte, zur großen Enttäuschung der Schule von Bologna“, so Magister. Man wird sehen.
Korrektur 3: Verurteilung des dominanten progressiven Denkens
Die dritte Korrektur liegt auf der Linie der beiden ersten. Magister spricht von einem Abschütteln des „progressiven Stempels“, der dem Papst in den ersten Monaten seines Pontifikats verpaßt wurde.
Vor einem Monat, am 17. Oktober schien er diesem „progressiven Stempel“ ganz zu entsprechen, als er in seiner morgendlichen Kurzpredigt im Gästehaus Santa Marta die Christen kritisierte, die den Glauben in eine „moralistische Ideologie“ verwandeln (siehe eigenen Bericht „Denzinger-Katholik“ und „ideologische Christen“? Neue Schubladen, aber die Probleme bleiben).
Einen Monat später, am 18. November klang der Papst plötzlich ganz anders. In seiner Predigt sprach er über den Aufstand der Makkabäer gegen die herrschenden Mächte ihrer Zeit. Der Papst nützte die Gelegenheit, um dem „halbwüchsigen Progressismus“, auch dem katholischen, eine ordentliche Kopfwäsche zu verabreichen. Den Progressiven warf er vor, sich bereitwillig der „hegemonialen Uniformität“ eines „Einheitsdenkens als Ausdruck der Weltlichkeit“ zu unterwerfen.
Es sei nicht wahr, sagte Papst Franziskus, daß „es bei jeder Entscheidung richtig sei, dennoch vorwärts zu gehen, anstatt den eigenen Traditionen treu zu bleiben“. Da nach dieser Logik alles verhandelbar sei, kommt man soweit, daß die Werte dermaßen ihre Sinnes beraubt werden, daß sie nur mehr „nominale, aber nicht mehr reale Werte“ sind. Mehr noch, man geht soweit, daß man sogar „über das Wesentliche des eigenen Seins: die Treue zum Herrn“ verhandelt. Das aber ist „Apostasie“, Abfall vom Glauben, wie Papst Franziskus betonte.
Das Einheitsdenken, das die Welt beherrscht, legalisiert auch „die Todesurteile“, auch die „Menschenopfer“, sagte der Papst. „Denkt Ihr, daß heute keine Menschenopfer dargebracht werden? Es werden sogar sehr viele dargebracht! Und es gibt Gesetze, die sie schützen.“
In diesem dramatischen Ruf des Papstes, sind unschwer die Millionen Menschenleben zu erkennen, die durch Abtreibung und Euthanasie hingemordet werden. Trotz der Dramatik dieser Worte, konnte sich der Papst noch immer nicht durchringen, das Morden an Menschen, begangen von anderen Menschen und geschützt durch menschengemachte Gesetze beim Namen zu nennen.
In seiner Klage über das Vordringen „dieses weltlichen Geistes, der zum Glaubensabfall führt“ zitierte der Papst einen „prophetischen“ Roman des frühen 20. Jahrhunderts, der zur Lieblingslektüre des Papstes gehört. Es handelt sich um den Roman Der Herr der Welt von Robert H. Benson. Benson war anglikanischer Pastor und Sohn eines Erzbischofs von Canterbury, der sich zum katholischen Glauben bekehrte.
Abgesehen von den katholischen Medien hat die Weltpresse diese Predigt genauso ignoriert, wie die beiden anderen Korrekturen an seinem Pontifikat. Alle drei widersprechen offensichtlich dem progressiven, wenn nicht sogar revolutionären Bild, das man sich in den Redaktionen zurechtgelegt hat und mit dem man die Massen infiziert hat.
An der morgendlichen Messe, in der Papst Franziskus die progressiven Katholiken und den menschenverachtenden Fortschrittswahn verurteilte, nahm erstmals auch der neue Staatssekretär Kurienerzbischof Pietro Parolin teil. Seit vergangenem Samstag ist er im Vatikan, der Montag war sein erster regulärer Arbeitstag.
Die vergangenen Monate bedeuteten Wechselbäder. Sie zeigten einen andersseinwollenden Papst, einen Anti-Ratzinger, einen Martini-Papst, einen Papst in der Gesten-Falle, einen anti-traditionalistischen Papst, einen progressiven Papst, einen antiprogressiven Papst, und manche würden sagen, zuletzt sogar einen traditionalistischen Papst, wenn man an die Grußbotschaft vom 26. Oktober an die Zweite Internationale Wallfahrt der Tradition nach Rom denkt; die Glückwünsche vom 28.. Oktober zum 25jährigen Bestehen der Priesterbruderschaft St. Petrus (wenn auch nur an den französischen Distrikt); den Telefonanruf vom 1. November an einen seiner härtesten Kritiker, den traditionsverbundenen Rechtsphilosophen Mario Palmaro, bei dem er sich für die Kritik bedankte.
Bleibt die Frage, wie diese unterschiedlichen Signale zu interpretieren sind. Die Hermeneutik des Zweiten Vatikanischen Konzils stellt eine ebenso entscheidende wie umstrittene Frage dar. Papst Franziskus persönlich scheint sich hingegen jeder Hermeneutik zu entziehen. Vielleicht auch das ein Ausdruck einer charakterlichen Verfaßtheit, die nach ständigem Anderssein verlangt (Lucrecia Rego de Planas) und unter einer „pastoralen“ Prämisse (Alberto Melloni) auf jeden zugehen will, ob progressiv oder traditionalistisch, ob Hermeuntiker der Kontinuität oder der Diskontinuität, ob Gläubiger oder Atheist. Oder – wie manche kritisieren – allen gefallen möchte. Die Frage bleibt weiterhin unentschieden, oder wie in diesen Tagen ein Leser schrieb: „Aus diesem Papst wird man nicht schlau.“ Zumindest noch nicht.
Text: Setttimo Cielo/Giuseppe Nardi
Bild: vatican.va

