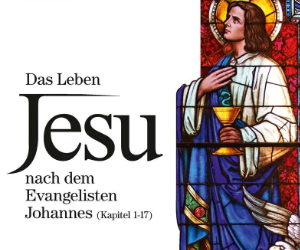(Rom) Benedikt XVI. ordnete im Rahmen seiner liturgischen Erneuerung an, im Hochgebet in den Landessprachen nicht mehr die nachkonziliare Übersetzung „für alle“ zu verwenden, sondern in wörtlicher Übersetzung gemäß lateinischem Original des Römischen Kanon die Worte „für viele/für die Vielen“. Der Papst traf diese Entscheidung trotz erheblicher Widerstände mehrerer Bischofskonferenzen, darunter auch der deutschen und der italienischen. Während einige Bischofskonferenzen die Rückkehr des pro multis in die muttersprachliche Übersetzung des Missale bereits umgesetzt haben, so die englischsprachigen Länder und Ungarn, mußte Benedikt XVI. die Bischöfe des deutschen Sprachraums fast sechs Jahre nach der entsprechenden Anweisung der Liturgiekongregation vom 17. Oktober 2006 an alle Bischofskonferenzen mit einem Schreiben ermahnen und noch einmal ausdrücklich dazu auffordern.
(Rom) Benedikt XVI. ordnete im Rahmen seiner liturgischen Erneuerung an, im Hochgebet in den Landessprachen nicht mehr die nachkonziliare Übersetzung „für alle“ zu verwenden, sondern in wörtlicher Übersetzung gemäß lateinischem Original des Römischen Kanon die Worte „für viele/für die Vielen“. Der Papst traf diese Entscheidung trotz erheblicher Widerstände mehrerer Bischofskonferenzen, darunter auch der deutschen und der italienischen. Während einige Bischofskonferenzen die Rückkehr des pro multis in die muttersprachliche Übersetzung des Missale bereits umgesetzt haben, so die englischsprachigen Länder und Ungarn, mußte Benedikt XVI. die Bischöfe des deutschen Sprachraums fast sechs Jahre nach der entsprechenden Anweisung der Liturgiekongregation vom 17. Oktober 2006 an alle Bischofskonferenzen mit einem Schreiben ermahnen und noch einmal ausdrücklich dazu auffordern.
Trotz Widerstände lenkt der deutsche Sprachraum ein – Italien letzter Hort des Widerstandes
Italien scheint unerwarteterweise der letzte Hort des Widerstandes zu sein. Dort traten nun aber zwei mehr dem progressiven Lager zugerechnete Bibel- und Liturgiewissenschaftler an die Öffentlichkeit, um die Position des Papstes zu stützen, wie der Vatikanist Sandro Magister berichtet.
Im Zuge der nachkonziliaren Liturgiereform wurde das pro multis in den meisten landessprachlichen Übersetzungen des Missale stillschweigend und mit einem theologischen Gewaltakt mit „für alle“ übersetzt. Mehrfache Ermahnungen durch die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung zeitigten keine Erfolge.
Erst mit dem Pontifikat Benedikts XVI. kam Bewegung in die Frage
Erst das Pontifikat Benedikts XVI. brachte Bewegung in die Sache. Mehrere Bischofskonferenzen korrigierten bei Neuausgaben des Missale durch wortgetreue Übersetzungen des Römischen Kanons. Seit Advent 2011 heißt es in den USA „for many“, ebenso folgten die spanischsprachigen Länder, während in Frankreich „pour la multitude“ gebraucht wird. Im deutschen Sprachraum ist die wortgetreue Übersetzung „für viele“ nach dem päpstlichen Rüffel in Vorbereitung. Die deutsche Bischofskonferenz hat, trotz Widerständen, den Weg vom „für alle“ zum „für viele“ bereits eingeschlagen. In Österreich ist ein entsprechender Beschluß noch ausständig. Letztlich wird die Korrektur jedoch für den ganzen deutschen Sprachraum und damit auch für die Deutschschweiz, Liechtenstein, Südtirol und Luxemburg gelten, wie es Benedikt XVI. in seinem Schreiben gefordert hat.
Italien: Nur 11 Bischöfe für „für viele“ – 171 für Beibehaltung von „für alle“
Der Widerstandskreis wird kleiner und es scheint nur mehr Italien das nachkonziliare liturgische Experiment zu verteidigen. Ausgerechnet im Land, in dem der Papst als Bischof von Rom auch Primas ist, beharrt man nach wie vor auf ein „per tutti“. Erst im November 2010 stimmte eine erdrückende Mehrheit der italienischen Bischöfe für die Beibehaltung der theologisch gewagten Übersetzung. Von 187 abstimmenden Bischöfen sprachen sich lediglich 11 für die Übersetzung „per molti“ aus. Vier weitere erklärten, die französische Formulierung zu bevorzugen. Abgesehen von einer weißen Stimme, votierten damit 171 italienische Bischöfe für das „für alle“. Hauptargument war, daß eine Änderung die Gläubigen verunsichern würde und Glaubenszweifel fördern könnte.
Papst Benedikt XVI. betonte in seinem Schreiben an die deutschen Bischöfe, daß er sich dieser Gefahr durchaus bewußt sei. Deshalb forderte er dazu auf, den Gläubigen die Korrektur und deren theologische und eschatologische Notwendigkeit zu erklären. Der Papst ermahnte damit die Bischofskonferenzen, sich nicht hinter noch so berechtigt erscheinenden Argumenten oder vermeintlichen Widerständen von Gläubigen zu verstecken, sondern die Gläubigen vorzubereiten und zu unterweisen. Auch in jenen Ländern, in denen die Beendigung des nachkonziliaren Experiments, wenn nicht freiwillig durch die Bischöfe, sondern auf Anordnung des Heiligen Stuhls umgesetzt wird.
Päpstliches Mahnschreiben an deutsche Bischöfe löste in Italien lebhafte Debatte aus
Seit Sommerbeginn herrscht in Italien eine lebhafte Debatte rund um das pro multis. Ausgelöst wurde sie durch den päpstliche Mahnbrief an die deutschen Bischöfe. Von wissenschaftlicher Seite fehlt es dabei nicht an Kritik an Benedikt XVI., doch in der Substanz, wird von der akademischen Fachwelt die päpstliche Entscheidung geteilt und findet immer mehr Unterstützung.
Namhafte Wortführer der jüngsten Zeit sind Don Francesco Pieri, Priester der Erzdiözese Bologna und Dozent für Liturgie, Griechisch und Kirchengeschichte der Antike, und Don Silvio Barbaglia, Priester der Diözese Novara und Dozent für Altes und Neues Testament.
Zwei Kritiker näherten sich durch Studien der Position Benedikts XVI. an
Von Don Pieri erscheint demnächst ein Buch zum Thema. Seine Hauptthesen veröffentlichte er bereits in der jüngsten Ausgabe der wohl progressivsten kirchlichen Zeitschrift Italiens Il Regno in Bologna. Darin widerspricht er zwar des Breiten Papst Benedikt XVI. in dessen Ausführungen im Schreiben an die deutschen Bischöfe und im zweiten Band von „Jesus von Nazareth“. Laut Pieri sei keine wissenschaftliche Einhelligkeit mehr darüber gegeben, daß der Semitismus „viele“ auch „allen“ entspreche. Trotz dieser Kritik zieht Pieri am Ende verblüffend ähnliche Schlußfolgerungen wie Papst Benedikt XVI. Er macht sich die Exegese des hebräischen Wortes „rabbim“ von Albert Vanhoye zu eigen, den Benedikt XVI. zum Kardinal kreierte und der es mit „eine große Zahl“ übersetzte, ohne näher darauf einzugehen, wie viele genau damit gemeint seien. So kommt Pieri zum Schluß, daß die französische Übersetzung „pour la multitude“, italienisch „per la moltitudine“ die treffendste landessprachliche Übersetzung für Italien wäre.
Don Barbaglia kam zu ähnlichen Schlüssen. Seine Ausführungen veröffentlichte er in der Zeitschrift Fides et Ratio des Religionswissenschaftlichen Instituts Romano Guardini von Taranto. Eingangs gibt er zu, seine Arbeit mit der Absicht begonnen zu haben, den Nachweis zu erbringen, daß die Übersetzung „für alle“ die beste sei und sich daher der Papst im Unrecht befinde. Durch die Vertiefung in das Thema sei seine ursprüngliche Position, dem Papst widersprechen zu wollen, jedoch immer weniger haltbar geworden. Schließlich sei sein „Vorurteil“, denn als solches habe sich seine Meinung entpuppt, ins Gegenteil gekippt. Das „per tutti“ sollte auch seiner Meinung nach durch „moltitudini“ ersetzt werden.
Übersetzung für Italien „per molti“ oder „per la moltitudine“
Letztlich sprechen sich sowohl Pieri als Barbaglia dafür aus, daß die neue landessprachliche Übersetzung der Wandlungsworte in italienischer Sprache „per voi e per una moltitudine“ lauten sollte. Obwohl beide Theologen in verschiedenen Fragen gegensätzliche Positionen zu jenen Benedikts XVI. vertreten, näherten sie sich durch ihre Studien in der Frage der Wandlungsworte deutlich der päpstlichen Position an.
Es bleibt die Frage warum trotz der Sprachverwandtschaft des Italienischen zum Latein pro multis mit „multitudine“ (lat. multitudo) übersetzt werden sollte, und nicht mit dem naheliegenden „per molti“. Dennoch ist festzustellen, daß auch in Italien, verspätet aber doch, Bewegung in die Pro-multis-Frage kommt und auch der letzte Widerstand gegen die Korrektur eines liturgischen Experiments durch Papst Benedikt XVI. zusammenbricht.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Invenimus Messiam