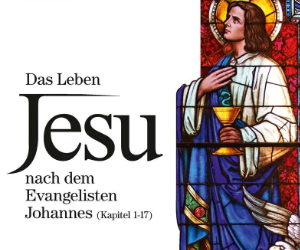(Vatikan) In einem Interview mit dem Osservatore Romano berichtete Msgr. Guido Marini, der Päpstliche Zeremonienmeister über die liturgischen Neuerungen bei Heiligsprechungen. Bei den Heiligsprechungen am kommenden Sonntag von Anna Schäffer, Giacomo Berthieu, Pedro Calungsod, Caterina Tekakwitha, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Monte Carmelo Sallés y Barangueras und Marianna Cope werden die Änderungen erstmals angewandt, „um die größere Bedeutung einer Heiligsprechung gegenüber einer Seligsprechung zu unterstreichen“, so Msgr. Marini.
(Vatikan) In einem Interview mit dem Osservatore Romano berichtete Msgr. Guido Marini, der Päpstliche Zeremonienmeister über die liturgischen Neuerungen bei Heiligsprechungen. Bei den Heiligsprechungen am kommenden Sonntag von Anna Schäffer, Giacomo Berthieu, Pedro Calungsod, Caterina Tekakwitha, Giovanni Battista Piamarta, Maria del Monte Carmelo Sallés y Barangueras und Marianna Cope werden die Änderungen erstmals angewandt, „um die größere Bedeutung einer Heiligsprechung gegenüber einer Seligsprechung zu unterstreichen“, so Msgr. Marini.
Msgr. Guido Marini sprach mit Osservatore Romano über Veränderungen
Die Heiligsprechung wird im Gegensatz zur bisherigen Praxis nicht mehr während der Eucharistiefeier stattfinden, sondern bereits davor. Dieses Vorziehen wurde bereits im Rahmen anderer liturgischer Feiern umgesetzt, „man denke an das Resurrexit am Ostersonntag, oder an die Kreierung der neuen Kardinäle beim Konsistorium am vergangenen 18. Februar oder die Segnung und Übergabe der Pallien an die Metropolitanerzbischöfe am jüngsten Hochfest der Apostel Petrus und Paulus“.
Grund dafür ist, so der Leiter des Amtes für die päpstlichen Liturgien, „zu vermeiden, daß in der Eucharistiefeier Elemente vorhanden sind, die nicht im eigentlichen Sinn dazugehören, und damit ihre Einheit erhalten bleibt, wie es die Konzilskonstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum concilium wünscht“. Damit werde keine überlieferte Tradition verändert, sondern lediglich eine erst in jüngster Zeit entstandene Praxis.
Eucharistiefeier freihalten von Elementen, die nicht im eigentlichen Sinn dazugehören
Die Heiligsprechung sei in erster Linie ein kanonischer Vorgang, in dem das munus docendi und das munus regendi beteiligt sind, während das munus sanctificandi erst in einem zweiten Moment hinzutritt durch die kultische Handlung nach der Heiligsprechung.
„Die Erneuerung des Heiligsprechungsritus ist Teil des von Benedikt XVI. 2005 begonnenen Weges“, so Msgr. Marini.
Damals gab die Kongregation für die Heilig- und Seligsprechungsprozesse am 29. September nach eingehendem Studium theologischer Aspekte und pastoraler Notwendigkeiten und nach Zustimmung durch Benedikt XVI. bekannt, daß die Heiligsprechungen weiterhin durch den Papst, die Seligsprechungen aber künftig durch einen von ihm ernannten Vertreter, meist durch den Präfekten der Heilig- und Seligsprechungskongregation, und in den jeweiligen Diözesen stattfinden werden.
Päpstliche Autorität soll stärker hervortreten
Die Heiligsprechung „ist ein endgültiges Urteil, mit dem der Papst feststellt, daß ein bereits zu den Seligen gerechneter Diener Gottes in den Heiligenkalender aufgenommen wird und durch die Weltkirche mit dem entsprechenden Kultus verehrt wird. Es handelt sich daher um einen universalen, sichtbaren Kult. Die dabei vom Papst ausgeübte Autorität wird nun durch einige rituelle Elemente noch deutlicher sichtbar.“
Zu den Neuerungen gehört „vor allem die dreifache Petitio, während der sich der Kardinalpräfekt der Kongregration für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse sich an den Heiligen Vater wendet mit dem Ersuchen, die Heiligsprechung der sieben Seligen vorzunehmen“.
Zudem wird die alte Tradition wiederaufgegriffen, „indem der Papst mit Nachdruck die Hilfe des Herrn bei der Vollendung dieses wichtigen Aktes erbittet. Vor allem als Antwort auf die zweite Petitio wird er den Heiligen Geist anrufen und nach dieser Anrufung wird der Hymnus Veni creator angestimmt.“
Jahrhundertealte Traditionen werden in erneuerter Form wieder aufgenommen
Erstmals wird auch wieder der Gesang des Te Deum, wie er bei Heiligsprechungen bis 1969 üblich war, die Prozession, Ausstellung und Verehrung der Reliquien der neuen Heiligen begleiten. „Die Prozession wird kurz vor dem Heiligen Vater Halt machen, damit er die Reliquien verehren kann“, so Msgr. Marini.
Der erneuert Ritus wird vor allem ein vereinfachter Ritus sein durch eine „harmonische Kontinuität einer jahrhundertealten Tradition“, so der Zermonienmeister. „Auf diese Weise wird es möglich, die Pracht der noblen Einfachkeit zu verwirklichen“.
Die Heiligenlitanei wird die Eingangsprozession begleiten, wie es unter Papst Pius XII. üblich war, und damit gegenüber der bisherigen Praxis vorgezogen.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatikanmünze Johannes XXIII. (1962)