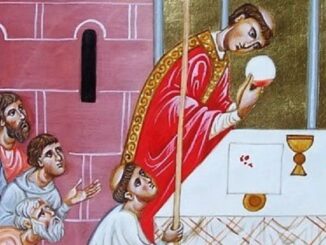Von Guillermo Villa Trueba*
Fragen sind faszinierende kleine Geschöpfe – sie kommen in allen Größen und Schattierungen daher.
- Es gibt ganz einfache, solche, die beinahe jedes Kind beantworten könnte:
Wie alt bist du? Magst du Erdbeereis? Welcher Dinosaurier ist dein Lieblingsdino? - Dann gibt es die mit Zähnen und Klauen: Fragen, die Verstand, Ernsthaftigkeit und Nachdenklichkeit verlangen:
Wie lautet die Diagnose des Patienten? Wie läßt sich die Rentabilität des Unternehmens steigern? Sollte man ein bestimmtes Gesetz reformieren? - Und schließlich gibt es eine dritte Art, die „ehrwürdigen Fragen“, vor denen man ehrfurchtsvoll den Hut zieht, sich nachdenklich am Kopf kratzt und lieber eine Zeitlang schweigt, um sie innerlich zu erwägen.
Eine solche Frage war es, die mir unlängst ein lieber Priesterfreund stellte – ein umtriebiger, kluger und scharfsinniger Costaricaner:
„Don Guillermo, Sie sind viel in der Welt herumgekommen und kennen die Lage unserer Kirche an vielen Orten. Sagen Sie mir: Welche konkreten Bedürfnisse sehen Sie? Welche Ratschläge würden Sie einem Pfarrer geben, der seine Pfarrei verbessern möchte?“
Er sprach es so beiläufig aus, als frage er, wie wohl morgen das Wetter werde – und blieb danach völlig gelassen (so sind Priester eben!).
Natürlich darf man eine solche Frage nicht hastig „verrauchen“ wie eine billige Selbstgedrehte; sie verlangt, daß man sie genießt wie eine gute Zigarre – mit Zeit, Bedacht und Sorgfalt. Zudem läuft man, wenn man sich auf derart heikles Terrain begibt, leicht Gefahr, sich in Nebenschauplätze zu verirren – etwa in die Debatte, ob der Zugang zur tridentinischen Messe erweitert oder der verpflichtende priesterliche Zölibat abgeschafft werden solle. Doch dem gewöhnlichen Pfarrer steht es weder zu, ehrgeizige liturgische Reformen zu ergreifen noch jahrhundertealte kirchliche Disziplinen zu ändern.
Seine hohe und edle Aufgabe ist es, die ihm anvertraute Herde zu den grünen Auen des Heils zu führen – im Auftrag Christi, des Guten Hirten schlechthin.
Nach einigen Tagen des Nachsinnens erlaube ich mir daher, diesem geschätzten Freund – und jedem Priester, der es hören möchte – fünf bescheidene Ratschläge zu unterbreiten. Ich tue dies still und leise, auf seine Bitte hin, und vor allem im Geiste des canon 212 des Codex Iuris Canonici, der den Laien nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht auferlegt, ihre Meinung über das Wohl der Kirche gegenüber ihren Hirten und Mitchristen zu äußern.
Ich teile diese Gedanken in der Überzeugung, daß die Mühe nicht vergeblich war, wenn auch nur einer davon für einen Priester fruchtbar ist.
1. Die eschatologischen Themen wieder in die Predigt aufnehmen – die letzten Dinge verkünden
Die feurigen Predigten über Sünde, Hölle, teuflische Versuchung, Fegefeuer und Jüngstes Gericht – jene Themen, die jahrhundertelang die Herzen der Gläubigen entflammten – sind weithin von den Kanzeln verschwunden. An ihre Stelle traten motivierende Ansprachen über Selbstverwirklichung und soziales Engagement.
Wenn in den letzten Jahrzehnten protestantische Sekten in vielen Regionen Hispanoamerikas und Spaniens großen Zulauf erhalten haben, dann liegt das nicht zuletzt daran, daß ihre (selbsterklärten) „Pastoren“ noch den Mut haben, über jene letzten Dinge zu sprechen, denen viele katholische Priester aus Furcht vor Anstoß ausweichen.
Dabei gilt: Die Treue zur kirchlichen Lehre darf keine gelegentliche Ausnahme sein, sondern muß der ständige Grundton jeder Predigt bleiben. Und doch ist die Rede über die „letzten Dinge“ – oder, wie Pater Castellani sagen würde, die „eschatologischen“ – selbst bei rechtgläubigen Priestern selten geworden.
Wir dürfen nicht vergessen: Die Kirche ist kein Selbsthilfeverein und keine NGO. Sie ist die Braut Christi – ihre zentrale Sendung ist die salus animarum, das Heil der Seelen. Nur sie vermag Antwort zu geben auf die tiefsten Fragen des menschlichen Herzens.
Wie der heilige Augustinus sagte: „Du hast uns auf Dich hin geschaffen, o Herr, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.“
Mit weniger Feinfühligkeit ausgedrückt: Unser Herz wird weder im sozialen Aktivismus noch in der vielgepriesenen „universellen Brüderlichkeit“ Frieden finden – sondern allein in Ihm.
2. Mit Mut und ohne falsche Rücksicht predigen – das Gute vom Bösen unterscheiden
Man darf keine Angst haben, zu lehren, zu fordern und – wenn nötig – zu tadeln. Es wäre ein schwerer Irrtum anzunehmen, die Mehrheit der Gläubigen kenne den Katechismus in- und auswendig. Viele haben nie von den „strengeren“ Lehren der Kirche gehört.
Doch Christus ruft uns – Kleriker wie Laien – dazu auf, alles hinter uns zu lassen, das Kreuz auf uns zu nehmen und Ihm zu folgen. Mit Mut.
In einer Welt, in der die Einflüsse des Zeitgeistes die Unterscheidung zwischen Tugend und Sünde beinahe ausgelöscht haben, braucht das Gewissen unserer Zeit dringend Orientierung. Wer von uns hat sich nicht schon von falschem Mitleid leiten lassen – aus Angst, jemandem weh zu tun oder als „intolerant“ zu gelten?
Darum müssen unsere Hirten wieder vom Ambo oder der Kanzel aus klar und liebevoll, aber ohne Beschönigung lehren, was die Kirche wirklich sagt – und was Christus von uns erwartet.
3. Die Eucharistie ins Zentrum stellen – die reale Gegenwart betonen und zur Gewissensprüfung anregen
Ein auffälliges Phänomen in vielen Pfarreien, besonders in den USA: Bei der Kommunion treten fast alle Gläubigen an den Altar – wie eine einzige Menge – während die Beichtstühle leer bleiben. In etlichen Gemeinden gibt es nur ein oder zwei Beichtzeiten pro Woche – oft zu unpassenden Stunden.
Gegen dieses Übel, das längst auch Spanien und Lateinamerika erfaßt hat, hilft nur eines: die Verkündigung der wahren Gegenwart Christi in der Eucharistie. Denn sollten wir nicht den höchsten Respekt vor dem lebendigen Gott haben, der in Leib, Blut, Seele und Gottheit wirklich gegenwärtig ist?
Der Priester hat dafür zu sorgen, daß ausreichend Beichtgelegenheiten bestehen, und die Gläubigen zu lehren, daß der Empfang der Kommunion im Zustand schwerer Sünde ihre eigene Seele gefährdet. Denn – so mahnt der heilige Paulus – wer unwürdig ißt und trinkt, „ißt und trinkt sich das Gericht“. So einfach – und so ernst – ist es.
4. Der Liturgie ihre Ehrfurcht zurückgeben – Schluß mit Lässigkeit und Improvisation
Das pastorale Problem unserer Zeit ist nicht mehr eine „gesetzliche Starrheit“ vergangener Tage, sondern der Mangel an Ehrfurcht. Dieser reicht von schlichter Nachlässigkeit bis zu den gröbsten liturgischen Mißbräuchen.
Man braucht nicht einmal die extremen Fälle – Regenbogenfahnen auf dem Altar oder Priester im Clownskostüm – zu bemühen. Schon das Paraphrasieren des Meßbuchs, das Überlassen der Predigt an Laien, das Ansprechen Gottes als „Mutter“ oder das Verweigern der Mundkommunion sind Verstöße, die vielerorts zur Gewohnheit geworden sind.
Wenn aber junge Menschen – oder Neuankömmlinge im Glauben – in der Liturgie keine Würde und keine heilige Ernsthaftigkeit erkennen, wie sollen sie dann glauben, daß sie sich hier wirklich in der Gegenwart des Herrn des Himmels und der Erde befinden?
Die einfachste Lösung steckt in einem englischen Sprichwort: „Say the black, do the red.“ Das bedeutet: Sprich mit Andacht die in Schwarz gedruckten Texte und führe gewissenhaft die in Rot bezeichneten Handlungen aus. Mehr braucht es nicht, um eine ehrfürchtige Feier sicherzustellen.
Wir Gläubigen – besonders die jungen – wollen keine „kreativen“ Einfälle mehr. Wir sehnen uns nach der Schönheit und Ernsthaftigkeit der überlieferten Liturgie, deren wir um einer vermeintlichen Modernität willen beraubt wurden. Denn die Art, wie wir Gott verehren, ist kein Nebending: Lex orandi, lex credendi, lex vivendi.
5. Die feierliche Musik und das Latein wiederbeleben – im Geist des Konzils von 1963
In „Der Geist der Liturgie“ schreibt der Papst aus Bayern, die katholische Liturgie sei stets eine „kosmische Liturgie“, da wir in der Messe eintreten in eine Feier, die uns vorausgeht und uns mit Engeln und den Heiligen aller Zeiten vereint.
Darum sollen wir die Liturgie nicht mit subjektiven Ausdrucksformen menschlichen Willens überfluten, sondern uns in die Tradition einfügen. Nur so entkommen wir der Vereinzelung und finden Gemeinschaft in der Communio sanctorum.
Musik und Sprache sind die beiden großen Träger dieser sakralen Kontinuität. Warum wurden Latein und die Kirchenmusik über Jahrhunderte in so hohem Ansehen gehalten? Weil sie das Heilige vom Alltäglichen klar unterscheiden und uns spüren lassen, dass wir uns auf höherem Boden bewegen – im Gottesdienst.
Sie bewahren zudem die Einheit des Glaubens und schaffen eine universale Verständigung: Gläubige verschiedener Sprachen können gemeinsam beten und singen.
Daher betonte das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution Sacrosanctum Concilium den Vorrang der Kirchenmusik – insbesondere des Gregorianischen Chorals und der Polyphonie (Nr. 112–116) – sowie die Bedeutung des Lateins (Nr. 36 und 54), das die Gläubigen so weit beherrschen sollen, daß sie die ihnen zukommenden Teile der Messe gemeinsam singen oder sprechen können.
Ist es wirklich vermessen, das Agnus Dei in jener Sprache anzustimmen, in der es einst die heilige Teresa von Ávila und der heilige Johannes Bosco sangen? Oder zu wünschen, daß die Musik der Messe sich unüberhörbar vom seichten Getöse der Welt unterscheidet? Ich weigere mich zu glauben, daß das zu viel verlangt ist.
Schlußwort
Ich weiß, diese Worte mögen manchen hart vorkommen. Doch angesichts der Netze aus Entmutigung und Gleichgültigkeit, die Luzifer und seine Legionen über uns spannen, ruft Christus seine Priester dazu auf, Menschenfischer zu sein.
Menschenfischer – fehlbar, müde, manchmal irrend –, die aber vom lebendigen Gott überreichlich unterstützt werden.
Unser Herr verlangt keine Genialität, sondern Demut. Es genügt, unsere Sünden zu erkennen und mit zerknirschtem Herzen die Gnade zu empfangen. Ein guter Priester muß kein brillanter Latinist oder glänzender Redner sein, und nicht jede Predigt muß die Höhen des Thomas von Aquin erreichen.
Denn – wie Juan Manuel de Prada in „Tausend Augen birgt die Nacht“ seinen Helden Fernando Navales sinnieren läßt:
„Nicht alle können Genies sein, und vielleicht ist das gut so, denn Genialität – oder das, was die Welt dafür hält – entspringt nicht immer dem Guten. Wohl aber kann jeder das Gute wählen, wenn er es wirklich will.“
Beten wir also für unsere Priester – daß auch sie das Gute wählen.
*Guillermo Villa Trueba, studierte Rechtswissenschaften an der Universidad Panamericana (Mexiko) und der University of Notre Dame (USA) sowie Politikwissenschaften an der Universidad de Sevilla (Spanien); die Promotion zum Doktor der Rechte erfolgte an der Universidad Internacional Menéndez Pelayo / Fundación José Ortega y Gasset (Madrid); er publiziert zu rechtshistorischen Themen und ist Autor von Religion en Libertad, einem der bedeutendsten katholisches Online-Magazine der spanischsprachigen Welt.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: MiL