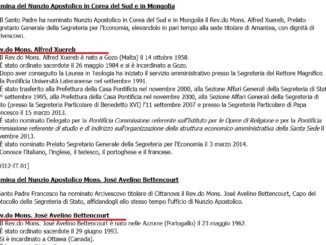Von Wladimir Rosanski*
Im Kontext des entschiedenen Widerstands gegen die Politik von Premierminister Paschinjan wurde Bischof Mkrtitsch der Eparchie Aragazotn gemeinsam mit sechs Diözesanpriestern festgenommen. Seit Juni befindet sich bereits Erzbischof Bagrat Galstanjan in Haft – er war der erste Kirchenvertreter, der offen gegen die armenische Regierung Stellung bezog. Die Anwälte der Armenischen Apostolischen Kirche sprechen von einem schwerwiegenden Rechtsbruch.
In Armenien verschärft sich der offene Konflikt zwischen der Regierung und der Armenischen Apostolischen Kirche. Jüngster Ausdruck dieser Eskalation ist die Verhaftung des Bischofs Mkrtitsch (Proschjan) der Eparchie Aragazotn gemeinsam mit sechs Priestern seiner Diözese. Dies erfolgte nach Hausdurchsuchungen in ihren jeweiligen Wohnsitzen, wie der Direktor der Anwaltsvereinigung Armeniens, Ara Sograbjan, mitteilte. Der Aufenthaltsort des Bischofs ist derzeit unbekannt, da Polizei und Staatsanwaltschaft jede Auskunft verweigern, was nach Ansicht der Anwälte eine gravierende Verletzung fundamentaler Rechte darstellt. Sograbjan verweist dabei auf Artikel 451 des Strafgesetzbuches, der sich mit dem Tatbestand „Verschwindenlassen infolge von Gewaltanwendung“ befaßt.
Nach armenischem Recht liegt ein solcher Tatbestand vor, wenn der Freiheitsentzug einer Person – sei sie legal oder illegal – geleugnet oder in irgendeiner Weise verschleiert wird, etwa durch die Unterdrückung von Informationen über ihren Status oder ihren Aufenthaltsort. Dies gilt sowohl für Handlungen durch Organe der Strafverfolgung als auch durch andere staatliche oder im Auftrag des Staats handelnde Institutionen. Wird einer Person dadurch der Zugang zu Rechtsschutz verwehrt, drohen den Verantwortlichen Haftstrafen zwischen drei und sieben Jahren. Dieses Gesetz sei nicht nur im Fall von Bischof Mkrtitsch, sondern ebenso gegenüber den Priestern Paren, Manuk, Ayk, Gewond, Mkrtitsch und Ayk Kotscharjan verletzt worden. Auch Gläubige und Mitarbeiter der Eparchie Aragazotn sollen betroffen sein.
Der Rat zur Verteidigung der Armenischen Apostolischen Kirche, der in den vergangenen Monaten von kirchennahen Regierungskritikern ins Leben gerufen wurde, veröffentlichte eine Stellungnahme, in der er die anhaltende „systematische Verfolgung unserer Priester“ durch staatliche Stellen scharf verurteilt. Neben Bischof Mkrtitsch wurde insbesondere auch die Festnahme des Vorstehers des Klosters Sagmosawank, Pater Paren Arakeljan, hervorgehoben. Der Rat forderte die Strafverfolgungsbehörden eindringlich auf, ihre Aufgaben mit „rechtsstaatlichem Gewissen“ zu erfüllen und den Erwartungen der armenischen Gesellschaft zu entsprechen – anstatt politischen Weisungen oder persönlichen Interessen zu folgen.
Die Sprecherin der Ermittlungsbehörde, Kima Awdaljan, wies die Vorwürfe zurück. Sie erklärte, im Zuge der Vorermittlungen wegen mutmaßlichen Amtsmißbrauchs und versuchter Beeinflussung öffentlicher Versammlungen seien „notwendige Maßnahmen zur Beweissicherung“ getroffen worden. Die Ergebnisse würden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Diese vagen Ausführungen bestätigen jedoch eher die bereits seit langem gegen den armenischen Klerus erhobenen Anschuldigungen, wonach Teile der Geistlichkeit sich an „konspirativen Aktivitäten“ zur Gefährdung der Staatssicherheit und zur Destabilisierung der bestehenden Ordnung“ beteiligt hätten.
Erst vor drei Wochen war das Urteil gegen Erzbischof Mikael Adschpachjan der Eparchie Schirak gesprochen worden. Er war seit dem 28. Juli in Untersuchungshaft und wurde wegen „öffentlichen Aufrufs zum Staatsstreich in Armenien“ zu zweieinhalb Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Während seiner Haft war ihm jeglicher Kontakt zur Außenwelt verwehrt worden.
Bereits am 26. Juni hatte die Staatsanwaltschaft die Verhaftung von 17 Personen bekanntgegeben – allesamt Mitglieder und Führungspersönlichkeiten der Bewegung Heiliger Kampf. Ihnen wird die Beteiligung an „terroristischen Handlungen zur Vorbereitung eines Umsturzes“ vorgeworfen. Hauptangeklagter ist Erzbischof Bagrat Galstanjan, der als erster innerhalb der Kirche öffentlich gegen die Regierung auftrat. Mit ihm wurden mehrere Priester, der ehemalige Abgeordnete des Nationalparlaments Dawid Galstjan, Oberst der Reserve Migran Machsudjan sowie der Politiker Igor Sarkisjan festgenommen. Letzterer ist Mitglied der Armenischen Revolutionären Föderation (Daschnakzutjun), einer der ältesten politischen Bewegungen des Landes, gegründet Ende des 19. Jahrhunderts zur Befreiung der Armenier von der osmanischen Herrschaft.
Das gespannte Verhältnis zwischen Kirche und Staat ist ein wiederkehrendes Merkmal der armenischen Geschichte – abhängig von Epoche und politischer Konstellation. Die jüngste Welle von Festnahmen trägt zweifellos zur weiteren Polarisierung innerhalb der armenischen Gesellschaft bei.
Hintergrund des Konflikts ist die Niederlage Armeniens im Bergkarabach-Krieg (2020) und die vollständige Preisgabe dieses historisch und ethnisch armenischen Gebiets, das im Jahr 2023 ohne Widerstand von aserbaidschanischen Truppen besetzt wurde. (Siehe auch „Die Armenier fühlen sich von der internationalen Gemeinschaft betrogen und vergessen“.)
Die Armenische Apostolische Kirche, als Bewahrerin der nationalen Identität, sieht darin einen Verrat an der armenischen Geschichte und am Leid der Karabach-Armenier. Der widerstandslose Rückzug, der von Ministerpräsident Nikol Paschinjan angeordnet worden war, wurde als Kapitulation wahrgenommen, da Paschinjan alle Entscheidungen ohne Einbeziehung der Kirche oder breiter gesellschaftlicher Kräfte traf.
König Trdat III. erklärte im Jahr 301 das Christentum zur offiziellen Religion seines Reiches, weshalb Armenien als erster christlicher Staat der Erde gilt.
*Wladimir Rosanski, Analyst für armenische Regierungspolitik, Staats‑Kirche-Verhältnis, Außenpolitik und die Beziehungen zu Rußland; Rosanski schreibt u. a. für AsiaNews und Armenian Club & News.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: AsiaNews