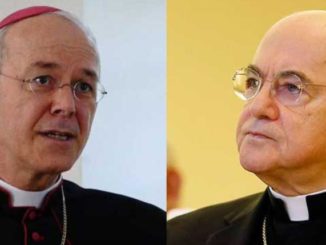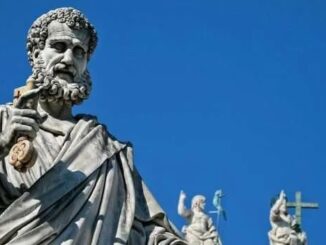Der Theologe Leonardo Lugaresi analysiert die Ansprache von Papst Leo XIV. vom 19. Juni an die Italienische Bischofskonferenz, deren Vorsitzender er formal ist. Diese Ansprache, obwohl an Italiens Bischöfe gerichtet, wurde vom Heiligen Stuhl bisher auch auf englisch und – man staune – auch auf deutsch veröffentlicht. Ein Grund mehr, sie etwas näher zu betrachten. Dem Hinweis, daß es „mindestens drei Dinge gibt, die Jesus selbst für die Gemeinschaft seiner Jünger gewollt, gedacht und ausdrücklich angeordnet hat“, wäre – auch wenn Prof. Lugaresi ihn bewußt wegläßt – zumindest viertens der Primat des Petrus hinzuzufügen (Mt 16,18–19). Der Autor, kein Vertreter der Tradition im engeren Sinn, ist der Ansicht, daß Papst Leo XIV. damit beginnt, „die Dinge wieder ins rechte Lot zu bringen“. Die Hoffnung ist jedenfalls, daß dem so sein wird. Nun aber das Wort an Prof. Leonardo Lugaresi:
Apostolische Kollegialität und „synodale Mentalität“
Von Leonardo Lugaresi*
Ich schlage vor, diesen beiden strategischen Passagen der wichtigen Rede besondere Aufmerksamkeit zu schenken, die Papst Leo XIV. am 17. Juni an die italienischen Bischöfe richtete, die zu diesem Anlass im Petersdom versammelt waren.
Die erste inhaltliche Aussage, die der Papst treffen wollte – nach den einleitenden Grüßen und Danksagungen, in denen übrigens erneut jenes traditionelle Merkmal hervorsticht, das ich bereits als charakteristisch für seinen „Stil“ bezeichnen würde – nämlich seine glückliche Neigung, das Wort des gegenwärtigen Pontifex immer wieder mit dem seiner Vorgänger zu verbinden, lautet wie folgt:
„Bei der Ausübung meines Dienstes zusammen mit euch, liebe Brüder, möchte ich mich von den Prinzipien der Kollegialität inspirieren lassen, wie sie im Zweiten Vatikanischen Konzil ausgearbeitet wurden. Insbesondere die Konstitution Lumen gentium unterstreicht, dass Jesus, der Herr, die Apostel eingesetzt hat »nach Art eines Kollegiums oder eines festen Kreises, an dessen Spitze er den aus ihrer Mitte erwählten Petrus stellte« (Nr. 19). Und ihr seid aufgerufen, euer Dienstamt auf diese Weise zu leben: Kollegialität unter euch und Kollegialität mit dem Nachfolger Petri.“
Am Ende seiner Rede, nachdem er den Bischöfen die pastoralen Prioritäten genannt hatte, die ihre Mission leiten sollen („Verkündigung des Evangeliums, Frieden, Menschenwürde, Dialog“), richtete Leo drei Ermahnungen an sie, von denen sich die erste auf die Einheit bezog:
„Zuerst: Geht voran in der Einheit, besonders im Hinblick auf den Synodalen Prozess. Der heilige Augustinus schreibt: »Damit der Leib des Herrn wohlgefügt und in Frieden sei, spricht Jesus durch den Mund des Apostels zur Kirche: Das Auge kann nicht zur Hand sagen: Ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen: Ich brauche euch nicht. Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn der ganze Leib Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn?« (Kommentar zu Psalm 130 ‚6). Bleibt vereint und leistet den Provokationen des Heiligen Geistes keinen Widerstand! Synodalität soll zu einer geistigen Haltung werden, im Herzen, in den Entscheidungsprozessen und in der Handlungsweise.“
Die Platzierung dieser beiden Hinweise – bewusst am Anfang und am Ende der Rede – und die daraus hervorgehende Verbindung von Kollegialität und Synodalität scheinen mir eine starke und bedeutende Botschaft vermitteln zu wollen.
Kollegialität war ein Schlüsselwort des Zweiten Vatikanischen Konzils. Zusammen mit dem Begriff des „Volkes Gottes“ bildete sie, wie Papst Leo XIV. durch das Zitat aus Lumen gentium unterstreicht, einen Eckpfeiler der vom Konzil entwickelten Ekklesiologie. Unter den Gründen für die Einberufung des Konzils war auch der Wunsch, ein Gleichgewicht in der Kirche wiederherzustellen, das seit dem Ersten Vatikanischen Konzil ins Wanken geraten war. Dieses hatte fast ein Jahrhundert zuvor den Höhepunkt der Reflexion über die päpstliche Autorität erreicht, aber die damit eng verbundene Frage des Bischofsamtes nicht in vergleichbarem Maße vertieft.
Die neunzig Jahre zwischen den beiden Konzilien – vom Pontifikat Pius IX. bis zu dem Johannes’ XXIII. – waren durch ein stetiges, mitunter stürmisches Anwachsen der Rolle des Papstes im kirchlichen Leben geprägt gewesen, während gleichzeitig die Bedeutung der Bischöfe zunehmend zurückgedrängt wurde. Die Wiederentdeckung der kirchlichen Dimension der apostolischen Kollegialität – selbstverständlich cum Petro et sub Petro – gehörte daher zu den am stärksten eingebrachten Anliegen während der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Das dritte Kapitel der dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen gentium greift diese Forderung in seinem Abschnitt über das Bischofsamt (Nr. 18–27) auf und behandelt dieses ausdrücklich im Horizont der Kollegialität. In den unmittelbar auf das Konzil folgenden Jahren stand das Thema weiterhin im Vordergrund. Aus dieser Zeit stammen auch zwei zentrale Institutionen, die eigens zur Umsetzung dieses Anliegens geschaffen wurden: die 1965 als ständige Einrichtung gegründete Bischofssynode und die 1966 auf die gesamte Kirche ausgeweiteten nationalen Bischofskonferenzen, die in einigen Ländern bereits bestanden.
Man könnte darüber diskutieren, inwieweit die Theologie jener nunmehr fernen Jahre und die daraus hervorgegangenen institutionellen Neuerungen tatsächlich zur Entfaltung einer richtig verstandenen apostolischen Kollegialität beigetragen haben – oder ob sie nicht manchmal eher zur Einengung der Rolle einzelner Bischöfe geführt haben. So wird etwa kritisiert, dass das übermäßige Anwachsen der Bischofskonferenzen und deren kirchlicher Bürokratie genau dazu geführt habe.
Doch eines steht fest – so paradox es auch klingen mag: Sechzig Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils wird über Kollegialität kaum noch gesprochen. Das Wort selbst scheint fast völlig aus dem kirchlichen Sprachgebrauch verschwunden zu sein, gänzlich absorbiert und ersetzt durch das allgegenwärtige und unaussprechlich vage Schlagwort „Synodalität“ – ein regelrechtes Mantra, das in jeder klerikalen Rede, gelegen oder ungelegen, ständig wiederholt wird, ohne jedoch jemals hinreichend klar definiert zu sein. Es bleibt so vage, dass darunter sogar Phänomene wie der deutsche Synodale Weg fallen, die im Grunde im Widerspruch zur bischöflichen Kollegialität stehen, weil sie die Autorität der Bischöfe in einer Art (pseudo)demokratischer Versammlungsstruktur auflösen, die Fragen von Glauben und Moral per Mehrheitsentscheid behandelt.
Das Paradoxon zeigt sich auch in einem weiteren Punkt: Nie zuvor wurde so viel über Synodalität gesprochen – bisweilen scheint es sogar, als wolle man diesen Begriff zum konstitutiven Prinzip der Kirche selbst erklären, als würden wir im Credo eine „eine, heilige, katholische und synodale Kirche“ bekennen –, und gleichzeitig war die Konzentration der Kirchenleitung auf die Person des Papstes nie stärker. Als wäre das petrinische Amt ein autokratisches Machtinstrument und die Bischöfe lediglich ausführende Beamte – wie untergeordnete Offiziere in einer Armee oder Filialleiter in einem multinationalen Konzern.
Dass Papst Leo XIV. in einem solchen Kontext die italienischen Bischöfe zu sich ruft und als erstes zu ihnen sagt, er wolle sein Amt nach den „Prinzipien der Kollegialität“ ausüben, erscheint mir daher höchst bedeutsam. Man achte auf die verwendeten Worte: Die Kollegialität ist in Leos Verständnis ein Prinzip – oder, wenn man so will, ein Ensemble von Prinzipien. Ein Prinzip: also nicht bloß eine Eigenschaft unter anderen, sondern ein grundlegendes Element, auf dem das ganze System beruht.
Doch damit nicht genug: Damit die Aussage nicht abstrakt bleibt und somit wirkungslos, konkretisiert der Papst diesen Begriff mit einem prägnanten Zitat aus Lumen gentium:
„Der Herr Jesus setzte die Apostel ‚nach Art eines Kollegiums oder eines festen Kreises ein, zu dessen Haupt er Petrus wählte, aus ihrer Mitte‘.“
Kollegialität ist nicht fakultativ, denn es ist Jesus selbst, der sie gewollt hat.
Hier liegt wirklich der Kern der Sache: Was ist das Verhältnis zwischen Jesus Christus und der Struktur der Kirche? Was in der institutionellen Verfassung der Kirche geht auf den ausdrücklichen Willen des Herrn zurück – und was ist vielmehr Ergebnis historischer Entwicklungen kirchlicher Strukturen (die freilich ebenfalls, zumindest in ihren großen Linien, vom Heiligen Geist inspiriert sind – so unser katholischer Glaube)?
Die meisten heutigen Gelehrten, selbst viele Professoren an katholischen Einrichtungen (leider!), würden auf eine solche Frage mit Sarkasmus reagieren. Sie sind überzeugt, dass das Christentum – oder besser: die „Christentümer“, wie man in gewissen Kreisen zu sagen pflegt – nichts mit Jesus von Nazareth zu tun habe, sondern ein Produkt späterer historischer Entwicklungen sei. Wenn alles in der Kirche historisch bedingt ist, dann, so ihr Schluss, ist auch alles historisch veränderbar.
Wir einfachen Katholiken hingegen glauben – gestützt auf das Neue Testament –, dass es mindestens drei Dinge gibt, die Jesus selbst für die Gemeinschaft seiner Jünger gewollt, gedacht und ausdrücklich angeordnet hat. Drei Dinge, die so sehr seine sind, dass sie durch den Willen des Menschen niemals angetastet werden dürfen, unabhängig von Zeit, Ort, Umständen und Veränderungen der übrigen kirchlichen Strukturen:
Das eucharistische Opfer („Tut dies zu meinem Gedächtnis“ – vgl. 1 Kor 11,23–25),
Der Missionsauftrag (vgl. Mt 28,19–20 und Apg 1,8),
Das Apostelkollegium (Mk 3,14–19).
Durch das Zitat aus Lumen gentium verankert Leo XIV. sich selbst, seine Funktion als Oberhaupt der Universalkirche, in der Tradition der apostolischen Kollegialität – und fordert die Bischöfe auf, nach demselben Prinzip zu handeln: „In diesem Sinne seid ihr berufen, euer Amt auszuüben: Kollegialität untereinander und Kollegialität mit dem Nachfolger Petri.“
Von hier aus spannt sich der gesamte Bogen seiner Rede bis zu ihrem nicht weniger bedeutsamen Schluss: Die Ausübung der petrinischen und apostolischen Autorität im Geiste der Kollegialität eröffnet das rechte Verständnis von Synodalität – macht sie gewissermaßen zu ihrer chrêsis, ihrem richtigen Gebrauch, gereinigt von allen Missverständnissen und Fehlinterpretationen.
„Geht voran in der Einheit, besonders im Hinblick auf den synodalen Weg“, sagt der Papst – und macht damit klar, dass die Synodalität ein Mittel ist, kein Ziel. Das zu erstrebende Gut ist die Einheit in Christus, synodal ist der Weg, der dorthin führt.
Wie schon bei anderen Gelegenheiten führt Leo den Begriff der Synodalität auf seine etymologische Wurzel zurück: das „gemeinsame Gehen“. Doch in einer Konzeption, die deutlich macht, dass das Ziel des Weges keineswegs gleichgültig oder nebensächlich ist, sondern entscheidend und unterscheidend. (Im Gegensatz zu einem gewissen heutigen Predigtstil, der das „Miteinander“ absolut setzt, als sei es ein Selbstzweck – nach dem Motto: „Hauptsache gemeinsam, ganz gleich wohin, ohne jemanden auszuschließen!“)
Aus der von Leo XIV. so klar hervorgehobenen Verbindung von Kollegialität und Synodalität ergibt sich folgerichtig die abschließende Ermahnung: „Die Synodalität soll zur Mentalität werden – im Herzen, in den Entscheidungsprozessen und in der Art des Handelns.“
Man könnte es folgendermaßen zusammenfassen:
Die apostolische Kollegialität ist ein Prinzip der Kirche, verwurzelt im Willen Jesu Christi, der sie auf das Kollegium der Apostel unter der Führung Petri gegründet hat – und als solches muss sie stets neu entdeckt und ins Zentrum gestellt werden.
Die Synodalität hingegen ist eine Mentalität, die jedem Glied der Kirche eigen sein soll und jedes Handeln inspirieren muss – nicht das hypothetische Fundament einer „neuen Kirche“, deren „Prozess“ erst „eingeleitet“ werden müsse.
Wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich sagen:
Das nennt man, die Dinge wieder ins rechte Lot bringen.
*Leonardo Lugaresi, promovierte 1977 an der Universität Bologna in Kirchengeschichte mit einer Arbeit über Origenes; Forschungstätigkeit an der École Pratique des Hautes Études in Paris; Lehrtätigkeit an den Universitäten Bologna, Pisa, Urbino und Chieti; Gründungsmitglied der Vereinigung PATRES. Studien zur antiken Kultur und dem Christentum der frühen Jahrhunderte.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va (Screenshot)