
Von Roberto de Mattei*
Die Anziehungskraft, die einige politische und religiöse Kreise im Westen durch das Moskauer Patriarchat empfinden, geht einher mit einer tiefgreifenden Unkenntnis seiner Geschichte. Wir wollen versuchen, diese Lücke zu schließen.
Der grundlegende Ausgangspunkt ist das siebzehnte ökumenische Konzil der Kirche, das 1439 unter Papst Eugen IV. in Florenz stattfand.1 An der großen Versammlung nahm unter der Leitung von Kaiser Johannes VIII. Paläologus und Patriarch Joseph II. mit seinem Klerus eine große Gruppe von etwa 700 Personen aus Konstantinopel teil. Mit dabei war auch der griechische Mönch Isidor (1385–1463), Metropolit von Kiew und der ganzen Rus (Rußland). Der Metropolit von Kiew, der nicht den Titel eines Patriarchen trug, wurde von Konstantinopel ernannt, und die Stadt Moskau, die bis zum 15. Jahrhundert keine bedeutende Rolle in der russischen Religionsgeschichte spielte, hing von ihm ab.
In Florenz fand ein großes Ereignis statt: Am 6. Juli 1439 wurde das Dekret Laetentur Coeli et exultet terra [Die Himmel mögen erfreut werden und die Erde juble] unterzeichnet, das das Große Schisma2 beendete, das 1054 die katholische Kirche von Rom von der selbsternannten „orthodoxen“ Kirche von Konstantinopel getrennt hatte. Die päpstliche Bulle endete mit folgender feierlichen dogmatischen Definition, die vom byzantinischen Kaiser, dem Patriarchen von Konstantinopel und den griechischen Vätern unterzeichnet wurde:
„Ebenso definieren wir, daß der heilige Apostolische Stuhl und der Römische Papst den Primat auf der ganzen Welt hat und daß der Römische Papst selbst der Nachfolger des seligen Petrus, des Fürsten der Apostel, der wahre Stellvertreter Christi, das Haupt der ganzen Kirche, Vater und Arzt aller Christen ist, und daß unser Herr Jesus Christus ihm in der Person des seligen Petrus die ganze Vollmacht übertragen hat, die universale Kirche zu weiden, zu regieren und zu leiten, wie es auch in den Akten der ökumenischen Konzilien und in den heiligen Canones bezeugt ist.„3
Es handelte sich um eine echte Rückkehr zu den Quellen. In der Tat gehen die Ursprünge der Rus auf die Taufe des heiligen Wladimir im Jahr 988 zurück, als Konstantinopel noch mit Rom vereint war und der Kiewer Staat Teil einer einzigen Res publica christiana unter der Führung des Papstes war. Johannes Paul II. sagte am 5. Mai 1988, daß „die Taufe des heiligen Wladimir und der Kiewer Rus vor eintausend Jahren heute zu Recht als ein unermeßliches Geschenk Gottes an alle Ostslawen, angefangen beim ukrainischen und beim weißrussischen Volk, betrachtet wird. Selbst nach der Abspaltung der Kirche von Konstantinopel betrachteten diese beiden Völker Rom als die alleinige Mutter der gesamten christlichen Familie. Genau aus diesem Grund wich Isidor, Metropolit von Kiew und der gesamten Rus, nicht von den authentischsten Traditionen seiner Kirche ab, als er 1439 auf dem ökumenischen Konzil von Florenz das Dekret über die Union zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche unterzeichnete.“ 4
Am 18. Dezember 1439 zeichnete Eugen IV. das Engagement des Kiewer Erzbischofs Isidor für die Einheit mit Rom mit dem Kardinalspurpur aus. Nach Abschluß des Konzils schickte der Papst Isidor als seinen Legaten nach Rußland zurück, um das Dekret von Florenz umzusetzen.5 In Kiew6 und seinen neun Suffraganbistümern stieß Isidor auf keine Schwierigkeiten, wohl aber in Moskau, wo die Union von Fürst Wassili II. (Basilius) (1415–1462) stark angefeindet wurde. Bei seiner ersten Messe in der Himmelfahrtskathedrale im Kreml am 19. März 1441 nannte Isidor während der liturgischen Gebete ausdrücklich den Papst und verlas das Unionsdekret, wobei er ein großes katholisches Kreuz an der Spitze der Prozession trug. Außerdem übergab er Wassili ein Schreiben, in dem Eugen IV. ihn bat, die Ausbreitung des Katholizität in den russischen Gebieten zu unterstützen. Der Fürst von Moskau lehnte jedoch die Beschlüsse des Konzils von Florenz ab und ließ den Metropoliten verhaften. Isidor konnte entkommen und nach Rom fliehen, während Wassili den Bischof von Rjasan und Murom, Jonas [zu dessen Diözese Moskau gehörte], ohne Zustimmung des Patriarchen von Konstantinopel zum neuen Metropoliten von Rußland erhob und sich damit vom Patriarchat von Konstantinopel, das in die Einheit mit Rom zurückgekehrt war, lossagte. Diese politische Entscheidung war der erste Schritt zur Autokephalie [nationalkirchliche Eigenständigkeit] der russischen Kirche, die auch noch heute unabhängig von der griechischen Kirche ist.
Isidor kehrte nach Rom zurück und unternahm zwei Missionen nach Konstantinopel, die erste 1444 auf Geheiß von Eugen IV., die zweite im Auftrag von Nikolaus V. im Dezember 1452, am Vorabend des Zusammenbruchs der Stadt. Am 28. Mai 1453 wurde Konstantinopel von den Türken angegriffen, das Byzantinische Reich löste sich auf und die Hagia Sophia, die größte Kirche des Ostens, wurde in eine Moschee umgewandelt. Dies war nicht nur das Ende des Reiches, sondern auch das Ende jenes Patriarchats von Konstantinopel, das sein Schicksal mit dem des Byzantinischen Reiches verbinden wollte.
In den Tagen der Belagerung gelang es Isidor von Kiew erneut auf wundersame Weise, sich zu retten und nach Rom zurückzukehren. Papst Calixtus III. verlieh ihm 1456 das Erzbistum von Nikosia und Pius II. 1458 das lateinische Patriarchat von Konstantinopel. Trotz dieser Ämter, zu denen 1461 noch das des Dekans des heiligen Kardinalskollegiums hinzukam, lebte er in den letzten Jahren seines Lebens in finanziellen Schwierigkeiten: Alle seine Besitztümer waren für die Verteidigung Konstantinopels verwendet worden, dessen Fall ihn sehr schmerzte. Dieser Verfechter des Glaubens und Verteidiger des Vaterlandes starb am 27. April 1463 in Rom und wurde im Petersdom beigesetzt, nicht weit vom Grab des Apostelfürsten entfernt, für dessen Primat er sich vehement eingesetzt hatte. Der schreckliche Eindruck, den die Katastrophe von Byzanz bei ihm hinterlassen hatte, ist in einer Epistula lugubris et molesta (beschwerlicher Trauerbrief, in: Patrologia Graeca, XLIX, Sp. 944 ff) festgehalten.
Nach dem Fall von Konstantinopel wollte sich Moskau zum Erben von dessen politischer und religiöser Rolle aufschwingen. Die Heirat des Großfürsten von Moskau Iwan III. im Jahr 1472 mit Prinzessin Sophia, der Nichte des letzten oströmischen Kaisers Konstantin XI. Paläologus, der 1453 auf den Mauern Konstantinopels gefallen war, schien diese Entscheidung zu besiegeln.
Es war in den Jahren der Revolte Martin Luthers, als das Verständnis von Moskau als dem „Dritten Rom“ vorgebracht wurde. Das Manifest dieser Ideologie war der Brief (1523) des Mönchs Philotheus aus dem Kloster Pskow an den Großfürsten von Moskau Wassili III. (Basilius Iwanowitsch). In diesem kurzen theologisch-politischen Traktat interpretiert Philotheus die russische Geschichte als Plan der Vorsehung nach dem „Fall“ sowohl des ersten als auch des zweiten Roms. Das erste, das alte Rom, habe sich zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert vom rechten Glauben abgewandt und seine Vorrechte eingebüßt; das zweite, Konstantinopel, sei als gerechte Vergeltung für das Festhalten an der Union mit Rom in die Hände der Türken gefallen. Ihre historische Rolle sollte von Moskau übernommen werden. Der russische Mönch drückte es so aus: „Die Kirche des alten Roms ist durch die gotteslästerliche Häresie des Apollinaris gefallen. Die Kirchentore des Zweiten Rom, der Stadt Konstantins, zerbrachen die Hagarenkel [Muslime] mit Äxten und Beilen“, während der Großfürst von Moskau als „rechtgläubig“ bezeichnet wurde, „der auf der ganzen Erde den Christen der einzige Zar und Zaumhalter der heiligen, göttlichen Altäre der heiligen ökumenischen, apostolischen Kirche ist. (…) Das ist das russische Zarentum. Denn zwei Roms sind gefallen, das dritte steht, ein viertes aber wird nicht sein.“
Von da an entwickelte sich in Rußland ein heftiger theologischer und politischer Haß gegen die römische Kirche und die abendländische Christenheit. Mit Iwan IV. dem Schrecklichen (1530–1584) wurde das orthodoxe Christentum zu einer Art Nationalreligion. Rußland präsentierte sich als das Heiligtum des wahren Glaubens, und der Moskauer Kreml war die Festung, die den Gründungsmythos des Dritten Roms verkörperte. Unter seinem Nachfolger Fjodor I. (1557–1598) wurde 1589 das Patriarchat von Moskau errichtet, mit dem Rußland den Weg zur religiösen Autokephalie einschlug.7 Die Konstituierung des Moskauer Patriarchats war sowohl der Ankunfts- als auch der Ausgangspunkt einer Apostasie, die nicht weniger schwerwiegend war als die von Martin Luther.
(Fortsetzung folgt)
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017, und Das Zweite Vatikanische Konzil. Eine bislang ungeschriebene Geschichte, 2. erw. Ausgabe, Bobingen 2011.
Bücher von Prof. Roberto de Mattei in deutscher Übersetzung und die Bücher von Martin Mosebach können Sie bei unserer Partnerbuchhandlung beziehen.
Übersetzung/Anmerkungen: Giuseppe Nardi
Bild: Corrispondenza Romana
1 Das siebzehnte ökumenische Konzil tagte insgesamt von 1431 bis 1445. Es wurde ursprünglich in Basel vor dem Hintergrund der Hussitenkriege und der Türkengefahr einberufen, tagte ab 1438 in Ferrara, schließlich wegen der Pest ab 1439 in Florenz, und endete in Rom.
2 Auch Morgendländisches Schisma oder Griechisches Schisma genannt.
3 Bulla unionis graecorum, 6. Juli 1439, auf der Internetseite des Heiligen Stuhls: „Item diffinimus sanctam apostolicam sedem et Romanum pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum et verum Christi vicarium totiusque ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur“.
4 Ansprache von Johannes Paul II. an die Teilnehmer eines Symposiums über die slawisch-byzantinische Christenheit, 5. Mai 1988.
5 Der Metropolit von Kiew und ganz Rußland hatte Kiew verlassen müssen, weil es 1240 von den Mongolen erobert und zerstört wurde. Seit 1251 lebte er meist in Nowgorod am Ilmensee (Nordwestrußland) und Wladimir (östlich von Moskau), wohin der Großfürst der Kiewer Rus seinen Sitz verlegte. 1299 wurde der Sitz des Kiewer Metropoliten offiziell nach Wladimir, dann ab 1326 nach Moskau übertragen, das der Großfürst kurz darauf zu seiner Residenz machte. Als Isidor nach Moskau zurückkehrte, war der Großfürst noch den Mongolen tributpflichtig, von denen er sich erst 1480 vollständig befreien konnte. Der mit Rom unierte Patriarch von Konstantinopel ernannte nach der Absetzung von Isidor von Kiew einen neuen unierten Metropoliten von Kiew und der ganzen Rus. Da der Großfürst von Moskau aber eigenmächtig einen eigenen, nicht-unierten Metropoliten ernannt hatte, teilte der Papst – durch die Union von Ost- und Westkirche legitimiert – die Metropolie Kiew entlang der Grenze zwischen Litauen-Polen und dem Großfürstentum Moskau. Dadurch gab es den unierten Metropoliten von Kiew und der ganzen Rus wieder mit Sitz in Kiew für die Gebiete der Rus, die unter katholischer Herrschaft standen, während die neuerrichtete Metropolie für das Moskauer Reich nicht besetzt werden konnte. Dort gab es dafür den russisch-orthodoxen Metropoliten in Moskau, der seinerseits den Anspruch erhob, der legitime Nachfolger der alten Metropoliten von Kiew und der ganzen Rus zu sein.
6 Die katholischen Litauer hatten Kiew und das Gebiet der westlichen Diözesen, die dem Metropoliten unterstanden, also den westlichen Teil der Rus, in der ersten Hälfte des 14. Jhdts. von den Mongolen befreit. Kiew selbst gehörte von 1362 bis 1654 zu Litauen bzw. Litauen-Polen. In diesem Gebiet konnte die Union von 1439 durchgesetzt werden, wenn auch nicht ohne Widerstand jenes Teils des ostkirchlichen Klerus und der Gläubigen, die sich an Moskau hielten.
7 Einen ausgezeichneten Einblick bietet Giovanni Codevilla: Chiesa e Impero in Russia. Dalla Rus’ di Kiev alla Federazione russa (Kirche und Reich in Rußland. Von der Kiewer Rus zur Russischen Föderation), Jaca Book, Mailand 2012.
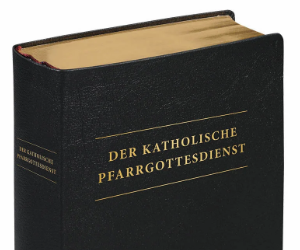




Ich empfehle dem Autor dringend sich die wahre Geschichte des Moskauer Patriarchats und der russisch-orthodoxen Kirche befassen, die der berühmtesten Kreml-Kritiker der Sowjetunion dem Oppostionellen Solschenizyn aus seiner Perspektive verfasst hat, sich seine Sicht zu diesem Thema durchzulesen. Er war selbst ein tiefgläubiger orthodoxer CHrist. Und auch er war der Meinung, dass das russisch orthodoxe Christentum in einer tiefen Krise sich zum Zeitpunkt der Oktoberrevolution im Jahre der 1917 war.
Seine Version unterschiedet sich gravierend von der Version des Autors auf dieser Seite.
Etwa bis Mitte des 17. Jahrhunderts war das russisch orthodoxe Christentum des Moskauer Patriarchats aber auf dem richtigen theologischen Weg. Dann beschlossen die Staatsmänner neue Reformen. Von da an ging es mit der russisch orthodoxen Kirche steil bergab. Übrigens diese Reformen von damals wurden auch im Kiewer Patriarchat 1 zu 1 umgesetzt und diese sind bis heute noch im Kiewer Patriarchat in Kraft (das sich von Moskau längst abgespalten und unabhängig gemacht hat).
Das ist tatsächlich auch für Historiker ein wertvoller Artikel, zeigt er doch was das eigentliche Problem in der Orthodoxie ist. Der Herrscher des Landes ist faktisch das Oberhaupt der jeweiligen Kirche und gilt als unfehlbar, selbst wenn er nicht einmal getauft ist, wie Selenskij. aus der Sicht der Russisch-Orthodoxen Kirche war daher der Auftritt von Volodomir Selenskij in der Kathedrale von Kiew ein Sakrileg sondergleichen und hat zu jener Verhärtung und Verbitterung innerhalb der russischen Orthodoxie geführt, die wir nun auf den Schlachtfeldern in der Ost-Okraine täglich erleben.
Im Lichte von Fatima sollte daher die Katholische Kirche nicht mehr die Überwindung des Kommunismus – er ist immer noch in zumindest fünf Ländern Staatsdoktrin (VR China, Nordkorea, Vietnam, Laos, Kuba) – sondern in der Überwindung des orthodoxen Irrtums des Caesaropapismus, der schon im Bilderstreit (Eikonoklasmos) verheerend war und immer wieder Länder dazu geneigt hat, sich eigene staatstreue autokephale Kirche zu schaffen, wie eben auch die Ukraine, Russland, Belarus, Rumänien. Diese zerfasern leider allzuhäufig in sektenähnliche Strukturen, worin sich Fundamentalismus und Fanatismus ausbreiten und den Gedanken an Heilige Kriege oder zu Bürgerkriegen führen, wie teilweise auch im Libanon geschehen ist.
Historisch ist ohne den Caesaropapismus, der gerade im Russischen Zarenreich einen Höhepunkt gehabt hat auch ein Grund dafür, dass sich die orthodoxen Christen später doch recht einfach der kommunistischen Partei unterworfen haben – der Staatslenker muß ja in irgendeiner Weise von Gott an diesem Platz stehen, das hat ja Gott zugelassen und wenn es sogar ein Jude oder Muslim ist.