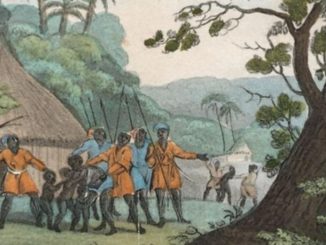(Washington) Derzeit sind viele Blicke auf José Hector Gómez, Erzbischof von Los Angeles und Vorsitzender der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten, gerichtet. Er gehört zum Kreis der kirchlichen Hierarchen, denen Santa Marta die Kardinalswürde vorenthält. Papst Franziskus verschenkt seine Gunst nach einer peniblen Sympathieskala. In neun Tagen beginnt die Herbstvollversammlung der Bischofskonferenz und wird, so der derzeitige Stand, im Tauziehen mit Rom ihre Niederlage offenkundig machen. Vor wenigen Tagen hielt Erzbischof Gómez eine bemerkenswerte Ansprache zu einem anderen Phänomen, das von den USA ausgehend auch Europa erfaßt hat. Die sogenannte Woke-Bewegung.
Am 4. November wandte sich Erzbischof Gómez in einer bemerkenswerten Videobotschaft an die Teilnehmer der Tagung „Católicos y Vida Pública“ (Katholiken und öffentliches Leben) in Madrid. Der Erzbischof äußerte „Überlegungen zur Kirche und zu den neuen Religionen in den USA“.
Die Washington Post berichtete auffallend negativ darüber und attackierte den Vorsitzenden der US-Bischofskonferenz. Nach der New York Times ist die Washington Post traditionell die wichtigste Tageszeitung des linksliberalen Establishments. Seit 2013 befindet sie sich im Besitz von Amazon-Eigner Jeff Bezos. Ein Grund mehr, den „Überlegungen“ von Erzbischof Gómez Aufmerksamkeit zu schenken.
„Sie haben mich gebeten, ein ernstes, sensibles und kompliziertes Thema anzusprechen: das Aufkommen neuer Ideologien und säkularer Bewegungen, die einen sozialen Wandel in den Vereinigten Staaten anstreben, und die Auswirkungen, die das für die Kirche hat.“
Es müsse allen klar sein, so der Erzbischof, daß „das, womit die Kirche in den Vereinigten Staaten konfrontiert ist, auch – in unterschiedlichem Ausmaß und auf unterschiedliche Weise“ – in Spanien „und in Ländern in ganz Europa geschieht“.
Seine Ausführungen gliederte Msgr. Gómez in drei Teile: den „breiten Kontext der weltweiten Bewegung der Säkularisierung und Entchristlichung und die Auswirkungen der Pandemie“, die „geistliche Interpretation der neuen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit und Identitätspolitik in den USA“ sowie einen Vorschlag für Prioritäten aus dem Evangelium, „mit denen die Kirche dieser Realität begegnen kann“.
1. Säkularisierung und Entchristlichung
Trotz bestimmter „einzigartiger Bedingungen“ in den USA lassen sich „seit langem“ ähnliche Muster „einer aggressiven Säkularisierung“ auch in Teilen Europas beobachten. Mit seltener Präzision beschreibt Erzbischof Gómez die globalistischen Eliten, die mit immer größerem Nachdruck Einfluß auf das Leben einzelner Staaten und möglichst global suchen.
„In unseren Ländern hat sich eine bestimmte Art von elitären Führern herausgebildet, die wenig Interesse an Religion und keine wirkliche Bindung zu den Nationen, in denen sie leben, oder zu den lokalen Traditionen oder Kulturen haben.“
„Diese Gruppe, die in den Unternehmen, Regierungen, Universitäten und Medien das Sagen hat und auch in den kulturellen und beruflichen Einrichtungen zu finden ist, will so etwas wie eine globale Zivilisation schaffen, die auf einer Konsumwirtschaft basiert und von Wissenschaft, Technologie, humanitären Werten und technokratischen Vorstellungen bezüglich der Organisation der Gesellschaft bestimmt wird.
In dieser elitären Weltanschauung gibt es keinen Bedarf an überholten Glaubenssystemen und Religionen. Aus ihrer Sicht ist die Religion, insbesondere das Christentum, nur ein Hindernis für die Art von Gesellschaft, die sie aufzubauen hoffen.“
Die Kirche wisse aus ihrer Erfahrung, daß Säkularisierung in der Praxis „Entchristlichung“ bedeute.
„Seit einigen Jahren wird in Europa und in den Vereinigten Staaten bewußt versucht, die christlichen Wurzeln der Gesellschaft auszulöschen und jeden noch vorhandenen christlichen Einfluß zu unterdrücken.“
Stichwörter dafür seien „Cancel Culture“ und „Politische Korrektheit“.
„Wir stellen fest, daß das, was ausgelöscht und korrigiert wird, die Perspektiven sind, die in den christlichen Überzeugungen über das Leben und die Person des Menschen, über Ehe, Familie und vieles mehr verwurzelt sind.“
In der Gesellschaft schrumpfe der „Raum“, den die Kirche und die christlichen Gläubigen einnehmen können.
„Kirchliche Einrichtungen und Unternehmen in christlichem Besitz werden zunehmend angegriffen und schikaniert. Das Gleiche gilt für Christen, die im Bildungswesen, im Gesundheitswesen, in der Regierung und in anderen Bereichen arbeiten. Bestimmte christliche Überzeugungen bedrohen angeblich die Freiheiten und sogar die Sicherheit anderer Gruppen in unserer Gesellschaft.“
Um den „Kontext zu vervollständigen“, sei noch eine weitere Tatsache zu berücksichtigen.
„Wir alle kennen die dramatischen sozialen Veränderungen, die mit dem Auftreten des Coronavirus in unserer Gesellschaft eingetreten sind, und die Art und Weise, wie die Behörden auf die Pandemie reagiert haben.
Ich denke, die Geschichte wird zurückblickend feststellen, daß diese Pandemie unsere Gesellschaft nicht so sehr verändert hat, sondern vielmehr Trends und Muster beschleunigt hat, die sich bereits etabliert hatten.
Soziale Veränderungen, die vielleicht Jahrzehnte gebraucht hätten, um sich zu entfalten, beschleunigen sich nun im Zuge dieser Krankheit und der Reaktion unserer Gesellschaften darauf.“
Aus diesen Entwicklungen, die sich beschleunigt haben, schließt Erzbischof Gómez:
„Die neuen sozialen Bewegungen und Ideologien, von denen wir heute sprechen, wurden viele Jahre lang an unseren Universitäten und Kultureinrichtungen herangezüchtet und vorbereitet.
Doch mit der durch die Pandemie ausgelösten Spannung und Angst und als Folge der sozialen Isolation, aber auch wegen der Ermordung eines unbewaffneten Afroamerikaners durch einen angelsächsischen Polizisten und der darauf folgenden Proteste in unseren Städten, wurden diese Bewegungen in unserer Gesellschaft voll entfesselt.
Dieser Kontext ist wichtig, um die Situation zu verstehen, in der wir in den Vereinigten Staaten leben.“
Der Fokus habe sich auf die „tief verwurzelten“, großen sozialen Unterschiede in der US-Gesellschaft gelegt.
2. Amerikas neue politische Religionen
Die daraus entstandenen „neuen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit“ seien „Pseudo-Religionen“.
„Mein Argument ist folgendes. Ich denke, die beste Art und Weise, wie die Kirche die neuen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit verstehen kann, ist, sie als Pseudo-Religionen und sogar als Ersatz für und Konkurrenten von traditionellen christlichen Überzeugungen zu sehen.“
Mit dem Aufkommen des Säkularismus „haben politische Glaubenssysteme, die auf sozialer Gerechtigkeit und persönlicher Identität beruhen, den Platz eingenommen, der einst von christlicher Überzeugung und Praxis besetzt war“.
„Wie auch immer wir diese Bewegungen nennen – ‚soziale Gerechtigkeit‘, ‚Woke Culture‘, ‚Identitätspolitik‘, ‚Intersektionalität‘, ‚Nachfolgeideologie‘ – sie behaupten, das zu bieten, was die Religion nicht bietet. Sie geben den Menschen eine Erklärung für Ereignisse und Zustände in der Welt. Sie bieten einen Sinn, ein Lebensziel und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Außerdem erzählen diese neuen Bewegungen wie das Christentum ihre eigene ‚Heilsgeschichte‘.“
Um zu erklären, was er meint, führte Erzbischof Gómez seine Überlegungen anhand der sogenannten „Woke“-Bewegung aus.
„Die christliche Geschichte, in ihrer einfachsten Form, kann mehr oder weniger so beschrieben werden: Wir sind nach dem Bilde Gottes geschaffen und dazu berufen, ein Leben des Segens zu führen, in Einheit mit Ihm und mit unserem Nächsten.
Das menschliche Leben hat ein von Gott gegebenes ‚Telos‘ [Ziel], d. h. eine Absicht und eine Richtung. Aufgrund unserer Sünde sind wir von Gott und voneinander entfremdet und leben im Schatten des Todes.
Durch Gottes Barmherzigkeit und Seine Liebe zu jedem von uns wurden wir durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus gerettet.
Jesus versöhnt uns mit Gott und unseren Nächsten; er gibt uns die Gnade, in sein Bild verwandelt zu werden, und ruft uns auf, Ihm im Glauben zu folgen, Gott und unsere Nächsten zu lieben und am Aufbau Seines Reiches mitzuwirken.
All dies in der zuversichtlichen Hoffnung, daß wir das ewige Leben mit Ihm in der kommenden Welt erlangen werden.
Das ist die christliche Geschichte. Und mehr denn je müssen die Kirche und jeder Katholik diese Geschichte kennen und sie in ihrer ganzen Schönheit und Wahrheit verkünden.“
Dies müsse umso mehr getan werden, weil sich derzeit ein „antagonistisches Narrativ“ ausbreite:
„Wir müssen das tun, weil es derzeit eine andere Geschichte gibt. Ein antagonistisches Narrativ der ‚Rettung‘, das wir in den Medien und in unseren Institutionen hören und das von den neuen Bewegungen für soziale Gerechtigkeit kommt.“
Die der christlichen Geschichte entgegengesetzte Geschichte der „Woke“-Bewegung könne wie folgt wiedergegeben werden:
„Wir wissen vielleicht nicht, woher wir kommen, aber wir sind uns bewußt, daß wir gemeinsame Interessen mit denen haben, die unsere Hautfarbe oder unsere Stellung in der Gesellschaft teilen.
Und wir sind uns schmerzlich bewußt, daß unsere Gruppe leidet und entfremdet wird und das ohne unser Verschulden geschieht. Der Grund für unsere Unzufriedenheit ist, daß wir Opfer der Unterdrückung durch andere Gruppen in der Gesellschaft sind.Wir erreichen Befreiung und Erlösung durch unseren ständigen Kampf gegen unsere Unterdrücker, indem wir einen Kampf um politische und kulturelle Macht im Namen der Schaffung einer gerechten Gesellschaft führen.“
Das sei „ein mächtiger und attraktiver Diskurs für Millionen von Menschen, sowohl in der amerikanischen Gesellschaft als auch in den Gesellschaften des Westens“.
„In der Tat fördern und lehren viele der führenden amerikanischen Organisationen, Universitäten und sogar öffentliche Schulen aktiv diese Sichtweise.“
Der Erzbischof führt es nicht näher aus, meint jedoch die Rassenunruhen nach dem Tod von George Floyd, der Rassismus und Antirassismus und als neue Form einen rassistischen Antirassismus zur Folge hatte, wie ihn Black Lives Matter (BLM) und die „Woke“-Bewegung vertritt. Vor allem auf letzteren spielt Msgr. Gómez an.
Die Stärke dieser Geschichte liege „in der Einfachheit ihrer Erklärungen: Die Welt ist in Unschuldige und Opfer, Verbündete und Feinde unterteilt“.
Sie sei auch deshalb so ansprechend, weil sie „auf reale menschliche Bedürfnisse und Leiden“ einzugehen scheint wie „Diskriminierung“ und „Ausschluß“ von den Möglichkeiten der Gesellschaft.
Es sei daher nicht zu vergessen, daß „viele“ jener, die sich diesen „neuen Bewegungen und Glaubenssystemen“ anschließen, „durch edle Absichten motiviert“ seien.
Im Prinzip bestehe darin Übereinstimmung mit ihnen:
„Aber wir können eine gerechte Gesellschaft nur auf der Grundlage der Wahrheit über Gott und über die menschliche Natur aufbauen.“
Papst Benedikt XVI. habe davor gewarnt, „daß die Verdunkelung Gottes zur Verfinsterung der menschlichen Person führt“.
„Wenn wir Gott vergessen, sehen wir nicht mehr das Bild Gottes in unserem Nächsten.“
„Das genau ist das Problem, das wir haben.“
„Die kritischen Theorien und Ideologien von heute sind zutiefst atheistisch. Sie leugnen die Seele sowie die spirituelle und transzendente Dimension der menschlichen Natur oder sind der Meinung, daß dies für das menschliche Glück irrelevant ist.Sie reduzieren das Menschsein auf physische Eigenschaften wie die Hautfarbe, das Geschlecht bzw. die Vorstellungen von Geschlecht oder die gesellschaftliche Stellung.“
Bei der Suche nach den Wurzeln dieses Denkens stoße man auf den Marxismus und Irrlehren, die es in der Geschichte der Kirche bereits gab.
„Wir können erkennen, daß dies einige Elemente der Befreiungstheologie sind, die in einer marxistischen kulturellen Vision verwurzelt sind. Sie sind auch verschiedenen Irrlehren und falschen Evangelien sehr ähnlich, die wir in der Geschichte der Kirche finden:
▪ Wie die Manichäer sehen diese Bewegungen die Welt als einen Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten.
▪ Und wie die Gnostiker lehnen sie die Schöpfung und den Körper ab, weil sie glauben, daß der Mensch aus sich machen kann, was er will.
▪ Diese Bewegungen sind auch pelagianisch und glauben, daß die Erlösung durch unsere eigenen menschlichen Bemühungen erreicht werden kann, unabhängig von Gott.
▪ Schließlich sind diese Bewegungen utopisch, denn sie scheinen zu glauben, dass wir durch politische Macht eine Art ‚Himmel auf Erden‘, eine perfekte Gesellschaft, schaffen können.“
Der Vorsitzende der US-Bischofskonferenz sagt es nicht explizit, läßt es aber deutlich anklingen, daß die Verabsolutierung dieser Irrlehren unerbittliche Gegensätze zwischen den Menschen schafft und in ihrer Radikalisierung die Vernichtung der Gegenseite anstrebt. Gegensätze und Radikalisierungen, wie sie das Christentum nicht kennt.
„Nochmals, liebe Freunde, was ich sagen will, ist Folgendes: Ich glaube, daß es für die Kirche wichtig ist, diese neuen Bewegungen zu verstehen und sich ihnen nicht in sozialer oder politischer Hinsicht zu nähern, sondern als gefährliche Substitute für die wahre Religion.“
„Indem sie Gott leugnen, haben diese neuen Bewegungen die Wahrheit über die menschliche Person verloren. Dies erklärt ihren Extremismus und ihre harte, kompromißlose und unversöhnliche Haltung.“
„Aus der Sicht des Evangeliums können diese Bewegungen, da sie die menschliche Person leugnen, auch wenn sie noch so gut gemeint sein mögen, kein echtes menschliches Wohlergehen fördern.
Wie wir in meinem Land beobachten können, führen diese streng säkularen Bewegungen zu neuen Formen der sozialen Spaltung, Diskriminierung, Intoleranz und Ungerechtigkeit.“
3. Was zu tun ist
Wie sollte die Kirche auf diese neuen Phänomene reagieren, wie auf sie zugehen oder eingehen?
„Meine Antwort ist einfach. Wir müssen Jesus Christus verkünden. Verkünden Sie ihn mutig und kreativ. Wir müssen unsere Heilsgeschichte erzählen. Dies ist der Auftrag der Kirche für alle Zeiten und für alle kulturellen Momente.
Wir sollten uns von diesen neuen Religionen der sozialen Gerechtigkeit und der politischen Identität nicht einschüchtern lassen. Das Evangelium ist die stärkste Kraft für soziale Veränderungen, die die Welt je gesehen hat. Und die Kirche ist von Anfang an ‚antirassistisch‘ gewesen. Alle sind von der Heilsbotschaft erfaßt.“
Und weiter:
„Jesus Christus ist gekommen, um die neue Schöpfung zu verkünden, Er ist gekommen, um den neuen Mann und die neue Frau zu verkünden, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, Kinder Gottes zu werden, um nach dem Bild ihres Schöpfers erneuert zu werden.
Jesus hat uns gelehrt, Gott zu kennen und zu lieben, während unser Vater Seine Kirche berufen hat, diese gute Nachricht bis an die Enden der Erde zu tragen und die eine Familie Gottes zu versammeln, die alle Menschen der Welt, alle Rassen, alle Stämme und alle Völker umfaßt.
Das war die Bedeutung von Pfingsten, als Männer und Frauen aus allen Nationen der Erde das Evangelium in ihrer eigenen Muttersprache hörten. Das ist es, was der heilige Paulus meinte, als er sagte, daß es in Christus weder Juden noch Griechen, weder Männer noch Frauen, weder Sklaven noch Freie gibt.“
In der Kirche habe man „nicht immer nach diesen schönen Grundsätzen gelebt, und wir haben auch nicht immer den uns von Christus anvertrauten Auftrag voll erfüllt“.
„Aber die Welt braucht keine neue säkulare Religion, die das Christentum ersetzt. Sie braucht vielmehr Sie und mich, um bessere Zeugen, bessere Christen zu sein. Beginnen wir damit, zu vergeben, zu lieben, uns für andere aufzuopfern und geistige Gifte wie Groll und Neid zu vertreiben.
„Ich persönlich lasse mich von den Heiligen und den Menschen inspirieren, die in der Geschichte meines Landes ein Leben der Heiligkeit geführt haben.
Ich denke dabei besonders an die Dienerin Gottes Dorothy Day. Für mich ist sie ein wichtiges Zeugnis dafür, wie Katholiken durch radikale Selbstlosigkeit und Liebe zu den Armen auf der Grundlage der Seligpreisungen, der Bergpredigt und der Werke der Barmherzigkeit auf eine Veränderung der sozialen Ordnung hinwirken können.
Sie war zutiefst davon überzeugt, daß wir uns selbst ändern müssen, bevor wir die Herzen anderer ändern können.
Sie sagte einmal: ‚Ich sehe nur zu deutlich, wie schlecht die Menschen sind. Ich wünschte, ich würde es nicht so sehen. Es sind meine eigenen Sünden, die mir diese Klarheit geben‘.“
Diese Einstellung brauche es in einer Zeit, „in der unsere Gesellschaft so polarisiert und gespalten ist“.
„Mich inspiriert auch das Zeugnis des ehrwürdigen Pater Augustus Tolton. Das ist eine beeindruckende und wahrhaft amerikanische Geschichte. Er wurde in die Sklaverei hineingeboren, entkam mit seiner Mutter in die Freiheit und wurde der erste afroamerikanische geweihte Priester in meinem Land. Pater Tolton sagte einmal: ‚Die katholische Kirche beklagt eine doppelte Sklaverei: die des Geistes und die des Körpers. Sie strebt danach, uns von beidem zu befreien‘. Wir brauchen diese Art von Vertrauen in die Kraft des Evangeliums.“
Es gebe schwere Bedrohungen, die nicht zu unterschätzen seien:
„In diesen Zeiten besteht die Gefahr, daß wir in einen neuen ‚Tribalismus‘ abgleiten, in ein vorchristliches Menschenbild, das die Menschheit in Gruppen und Fraktionen aufteilt, die miteinander konkurrieren.
Wir müssen das Evangelium als den wahren Weg zur Befreiung von aller geistigen und materiellen Knechtschaft und Ungerechtigkeit leben und verkünden.
In unserer Verkündigung, in unserem praktischen Leben und vor allem in unserer Nächstenliebe müssen wir Gottes wunderbaren Plan für unser gemeinsames Menschsein bezeugen, d. h. unseren gemeinsamen Ursprung und unsere gemeinsame Bestimmung in Gott.
Schließlich glaube ich, dass die Kirche in dieser Zeit eine Stimme für das individuelle Gewissen und die Toleranz sein muß.
Wir müssen mehr Bescheidenheit und Realismus in Bezug auf den menschlichen Zustand fördern und uns bewußt machen, daß unsere gemeinsame Menschlichkeit auch die Anerkennung unserer gemeinsamen Schwächen beinhaltet.
Die Wahrheit ist, daß wir alle Sünder sind, wir sind alle Menschen, die das Richtige tun wollen, es aber oft nicht tun.“
„Wahre Religion zielt nicht darauf ab, Menschen zu verletzen oder zu demütigen oder ihren Lebensunterhalt oder Ruhm zu ruinieren. Wahre Religion bietet selbst den schlimmsten Sündern die Möglichkeit, Erlösung zu finden.“
Gottes Hand lenke weiterhin „unser Leben und das Schicksal der Völker“. In den USA und in Mexiko bereite man sich auf den 490. Jahrestag der Erscheinung der Gottesmutter von Guadalupe vor, die zum geistigen Gründungsereignis für den amerikanischen Doppelkontinent wurde
„Maria sagte auf dem Tepeyac: ‚Bin ich denn nicht hier, deine Mutter? Bist du denn nicht in meinem Schatten, unter meinem Schutz?‘
Wir sehen Anzeichen für ein religiöses Erwachen in unserem Land, unter den politischen Kontroversen, den Pandemiewolken und der Ungewißheit der Zukunft. Ich bin überzeugt, daß wir im nächsten Jahrzehnt ein geistliches Erwachen und ein Wachstum des Glaubens erleben werden, wenn wir uns auf den 500. Jahrestag der Erscheinung vorbereiten.“„Möge Gott Sie alle segnen und möge die allerseligste Maria von Guadalupe für uns alle eintreten!
Erzbischof Gómez thematisierte nicht die Querverbindungen zwischen der „bestimmten Art von elitären Führern“, die sich herausgebildet hat und die „wenig Interesse an Religion und keine wirkliche Bindung zu den Nationen, in denen sie leben, oder zu den lokalen Traditionen oder Kulturen haben“, und den neuen sozialen Bewegungen mit ihrem radikalen Diskriminierungsdiskurs. Der gleich an den Beginn seiner Ausführungen gesetzte Hinweis auf die „bestimmte Art von elitären Führern“ signalisiert jedoch, daß er sich der Verbindungen und Wechselwirkungen durchaus bewußt ist.
Text/Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Debate TV (Screenshot)