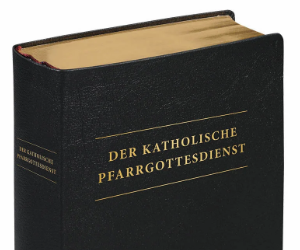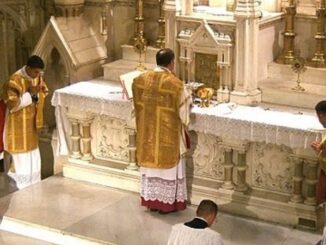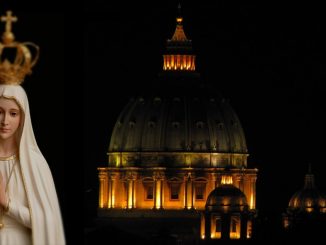(Rom) Die Mächtigen und ihr Spiel auf dem Schachbrett. So ließe sich beschreiben, was derzeit hinter den Kulissen vorbereitet wird. Unklar ist noch, ob als direktes Ziel oder als Plan B. In beiden Fällen hätte Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte seine Schuldigkeit getan. Auf dem Apenningebiet liegen seit drei Jahren die Augen jener, die wirklichen Einfluß haben – und Santa Marta spinnt die Fäden. Das hat auf den ersten Blick nichts mit religiösen Fragen zu tun und doch sehr viel. Wer verstehen will, was geschieht, muß gelegentlich den Vorhang zur Seite schieben.
Wegen des Brexit gilt der Süden der EU als offene ökonomische Flanke. Er umfaßt auch die Außengrenze, die durch die illegale Masseneinwanderung aus Afrika und Asien seit 2015 ein Dauerbrenner ist. Italien ist nach dem Ausscheiden Großbritanniens das drittgrößte EU-Mitglied nach der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich. Alle Aufmerksamkeit konzentriert sich daher auf die Frage, wer Italien regiert bzw. dort an die Macht gelangt. Im Frühjahr 2018 zeichnete sich diesbezüglich ein Supergau ab.
Das EU-kritische Zwischenspiel
Während Brüssel, Berlin und Paris noch hofften, den Brexit doch noch abzuwenden, gelangten in Österreich und Italien Parteien an die Macht, die beim EU-Establishment und den Globalisten auf der roten Liste stehen. In Österreich war es die FPÖ und in Italien die Lega. Beide als Juniorpartner. Die Lage in Rom war aber wegen der Bedeutung des Landes und dem Seniorpartner noch wesentlich delikater als in Wien. Die FPÖ durfte an der Seite der ÖVP mitregieren, die in Brüssel als verläßlich gilt. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist zudem Mitglied im European Council on Foreign Relations (ECFR) von George Soros, was den Globalisten als sichere Garantie gilt. In Italien hingegen kam es im Juni 2018 zu einem Novum. Erstmals in der Geschichte des Landes wurde eine Regierung gebildet, die ausschließlich aus EU-Kritikern bestand. Anders als in Österreich galt der Seniorpartner, die Fünfsternebewegung (M5S) als besonders unzuverlässig, da hyperpopulistisch und in ihrer Programmatik kaum faßbar.
Auf Weisung aus Santa Marta wurden Kirchenvertreter zu lautstarken und teils radikalen Regierungskritikern. Als der damalige Innenminister und Lega-Vorsitzende Matteo Salvini durch Italien reiste, wurden an kirchlichen Gebäuden, sogar an Klöstern Transparente mit Parolen gegen ihn entrollt, um seine Politik der Grenzsicherung durch Unterbrechung der „Mittelmeerroute“ für die Schlepperbanden zu kritisieren. Einen solchen Grad der Politisierung gab es seit den frühen 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts nicht mehr, allerdings damals vor einem ganz anderen Hintergrund, als eine gewaltsame kommunistische Machtübernahme nicht ausgeschlossen werden konnte.
Wundersame Flurbereinigung
Doch auf wundersame Weise fügte sich alles innerhalb weniger Monate, und dies just rund um die Wahlen zum EU-Parlament, die im Mai 2019 stattfanden. Nach nur neun Monaten katapultierte eine undurchsichtige Intrige, deren Kern eine gestellte Falle war, die FPÖ aus der Regierung und führte zugleich Bundeskanzler Kurz zum Höhenflug. Wenige Wochen später geschah dasselbe, wenn auch auf anderem Weg, mit der Lega in Italien. Hinter den Kulissen war die Fünfsternebewegung in Brüssel „eingekauft“ worden, wie es der damalige Noch-Europaminister, der Lega-Vertreter Lorenzo Fontana, nannte.
Die Fünfsternebewegung sicherte Ursula von der Leyen die notwendigen Stimmen für ihre Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin. Damit sei klar gewesen, was es geschlagen hatte, so Fontana Ende August 2019. Die Regierung in Rom platzte, die Lega flog aus der Regierung und wurde durch die Linksdemokraten (PD) ersetzt, einen Zusammenschluß der Mehrheit der ehemaligen Kommunistischen Partei Italiens (PCI) mit dem linken Flügel der einstigen Christdemokraten (DC). Kurzum: Die geeichten Vertreter des EU-Establishments kehrten wieder an die Schalthebel zurück, von denen sie erst 14 Monate zuvor verdrängt worden waren. Der parteilose Giuseppe Conte, 2018 von der Fünfsternebewegung nominiert, blieb im Amt – mit Unterstützung des Vatikans.
Dieser hatte gegenüber der Person des Ministerpräsidenten bereits zuvor Sympathien erkennen lassen, zeigt sich seit dem Rauswurf der Lega der neuen Regierung gegenüber aber demonstrativ freundlich. Brüssel steht in Contes Schuld, was die Entwicklung bei den jüngsten Verhandlungen zum Corona-Superhaushalt der EU mit seinen gigantischen Transferleistungen erklärt. Dennoch: Conte steht im eigenen Land im Kreuzfeuer.

Conte wegen des Coronavirus in der Kritik
Kritiker der Corona-Radikalmaßnahmen erreichten auf dem Klageweg, Einsicht in die Unterlagen zu erwirken, die Anfang März zum „Lockdown“ geführt hatten. Italien hatte als erster Staat des Westens das ganze Land mit einer Ausgangssperre belegt und in die Quarantäne geschickt. Die Wirtschaft und das öffentliche Leben kamen zum Stillstand. Der Reihe nach folgten wie Dominosteine alle anderen westeuropäischen Staaten mit Ausnahme Schwedens. Die Frage, die seither im Raum steht, lautet: Auf welcher Grundlage erfolgte dieser radikale Schnitt?
Die Regierung erklärte die Entscheidungsfindung zum Staatsgeheimnis, doch die Kritiker ließen nicht locker und gingen den Instanzenweg der Verwaltungsgerichtsbarkeit. Als sich abzeichnete, daß das oberste Verwaltungsgericht, der Staatsrat, die Forderung nach Akteneinsicht unterstützen wird – die Verhandlung ist für September angesetzt –, trat die Regierung Conte vor wenigen Tagen die Flucht nach vorne an und gewährte teilweise Akteneinsicht. Daraus geht hervor, daß die amtlich zuständigen Experten Anfang März nur punktuelle Absperrungen in Norditalien empfohlen hatten, konkret von zwei Gemeinden, in denen das Coronavirus gehäuft aufgetreten war. Die Regierung schickte stattdessen ganz Italien in die Quarantäne und wurde international richtungsweisend.
Handelte es sich dabei um einen Geistesblitz der Regierung, die aus Nicht-Experten besteht? Wer flüsterte die Eingebung, wenn es nicht die offiziell beauftragten Experten waren? Die Frage bleibt weiterhin unbeantwortet. Der Schaden ist enorm.
Schlechte Umfragewerte
Vor allem zeigen alle Umfragen seit dem Sturz der Lega im Sommer 2019 eine Mehrheit für das von ihr angeführte rechte Parteienbündnis. Der Höhenflug der Lega wurde zwar gestoppt, selbst Anhänger werfen ihrem Vorsitzenden Matteo Salvini vor, im Zuge der Regierungskrise nicht immer klug agiert zu haben. Sie wird aber mit 25–28 Prozent weiterhin als stärkste Partei gehandelt. Ihre Verluste in der Umfragegunst wurden seither durch die andere Rechtspartei des Bündnisses, die Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni, aufgefangen, die inzwischen bei 15–18 Prozent liegt. Der dem EU-Establishment am nächsten stehenden Forza Italia von Silvio Berlusconi werden nur mehr 5–8 Prozent zugetraut.
Die derzeitige Linksregierung weiß also seit dem ersten Tag ihrer Amtszeit, daß sie eigentlich über keine Mehrheit verfügt und nur regieren kann, weil es keine Wahlen gibt. Diese kommen aber bestimmt. Die sinkenden Umfragewerte für die Regierung Conte, die aktuell nur mehr bei 30 Prozent der Italiener Zustimmung findet (Umfrage Tecné) führen zu Gedankenspielen im Hintergrund. Die machtverwöhnten Linksdemokraten drängt es zudem zurück in den Palazzo Chigi, den Amtssitz des Ministerpräsidenten. Laut Umfragen haben sie die Fünfsternebewegung mit 20 zu 15 Prozent längst und konstant überrundet. Selbst die Fratelli d’Italia, die Nachfolgepartei der rechtsnationalen Alleanza Nazionale (AN), liegen inzwischen um eine Nasenlänge vor der Fünfsternebewegung, die sich als Sternschnuppe erweist, die ebenso schnell zu verlöschen scheint, wie sie am Firmament aufgetaucht ist.
Am 20. September finden in sieben von 20 italienischen Regionen Landtagswahlen statt. Fest steht schon jetzt, daß die Fünfsternebewegung ein Debakel erleben wird. Je nachdem wie gut oder schlecht das derzeitige Linksbündnis abschneiden wird, könnte bereits über Contes Schicksal als Ministerpräsident entscheiden.
Die Alternative – mit Zustimmung von Santa Marta
Seit einigen Wochen wird an einer Alternative zu Conte gebastelt, und diese soll Mario Draghi heißen. Der Globalist Draghi, der von 2011 bis 2019 Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) war, wurde am vergangenen 10. Juli von Papst Franziskus zum ordentlichen Mitglied der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften ernannt. Die Ernennung sorgte unter Beobachtern für Aufmerksamkeit.

Die Akademie wird als Kanzler von Kurienbischof Marcelo Sanchez Sorondo, dem politischen Arm von Papst Franziskus, geleitet, jenem Mann, der die Welt unter Franziskus in einem „magischen Moment“ sieht, weil erstmals Vatikan und UNO dieselbe Agenda verfolgen, der die kirchliche Soziallehre im kommunistischen China am besten verwirklicht sieht, Abtreibungsgegner für „Fanatiker“ hält und Abtreibung für eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Er strickt seit Beginn des Pontifikats die Fäden für den politischen Paradigmenwechsel, den Franziskus betreibt. Zu Mitgliedern der Akademie waren vor Draghi bereits der UNO-Chefökonom und Neomalthusianer Jeffrey Sachs und der „Papst“ des angeblich menschengemachten Klimawandels, Hans Joachim Schellnhuber, ernannt worden. Beide sind, wie auch Draghi, Aushängeschilder der globalistischen Agenda.
„Was aber könnte den argentinischen Verteidiger der Letzten, der Unterdrückten und der Armen mit dem Vertreter der Mächtigen, der Finanzoligarchie und der globalistischen Plutokratie verbinden? Was hat der Papst der Armen mit jemand zu schaffen, der in Europa für eine sozioökonomische Schlächterei verantwortlich ist? Was hat der Stellvertreter Christi mit einem führenden Vertreter des Einheitsdenkens, der Ideologie der politischen Korrektheit und des neuen Humanismus zu tun?“
Diese Fragen stellte jüngst die unabhängige katholische Internetzeitung La Nuova Bussola Quotidiana. Franziskus und Draghi sind sich bisher erst zweimal begegnet. Das erste Zusammentreffen fand am 19. Oktober 2013 statt, als der Papst dem EZB-Chef und dessen Familie eine Privataudienz gewährte. Die zweite folgte am 6. Mai 2016, als Franziskus der Karlspreis verliehen wurde, was nicht in Aachen geschah, sondern außergewöhnlich im Apostolischen Palast im Vatikan. Draghi saß bei diesem Anlaß unter den höchsten Repräsentanten der EU aus Politik und Wirtschaft, darunter Angela Merkel, Jean-Claude Juncker (damals EU-Kommissionspräsident), Martin Schulz (damals Präsident des EU-Parlaments) und Donald Tusk (damals Präsident des Europäischen Rats). Mit Ausnahme von Merkel ist keiner mehr im Amt, doch alle wurden von Gleichgesinnten ersetzt. Die Rede, die Papst Franziskus damals hielt, um sich für die Verleihung zu bedanken, war ein Plädoyer des Globalismus, ein Bekenntnis zu Zielen der Mächtigen, eine Bestätigung der UNO-Agenda. Wörtlich sagte Franziskus damals, wiedergegeben nach der offiziellen vatikanischen Übersetzung:
„Ich träume von einem neuen europäischen Humanismus.“
Der Traum vom „neuen Humanismus“ war der rote Faden, der sich durch die ganze Ansprache zog. Wer immer dem Papst die Rede geschrieben hatte, vergaß allerdings etwas bzw. jemand zu erwähnen, der in Santa Marta bei solchen Anlässen eine immer geringere Rolle spielt: Jesus Christus. Im Umfeld des derzeit regierenden Papstes scheinen viele der Meinung zu sein, daß der „neue Humanismus“ ohne den Gottessohn verwirklicht werden könne, dieser vielmehr hinderlich sei bei der Verwirklichung der drei Ziele sei, die Franziskus bei der Karlspreisverleihung damit verknüpfte:
„Fähigkeit zur Integration, Fähigkeit zum Dialog und Fähigkeit, etwas hervorzubringen.“
Darum noch einmal die Frage: Was verbindet Papst Bergoglio und den Globalisten Draghi?
Antonio Spadaro und die Civiltà Cattolica
Wer diese Frage sehr gut informierten Personen stellt, erhält einen Namen zur Antwort: Antonio Spadaro, Jesuit wie Franziskus und Schriftleiter der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica. Draghi selbst ist Absolvent des renommierten römischen Jesuiteninstituts „Massimiliano Massimo“, an dem er die gesamte Zeit vom Kindergarten bis zum Abitur verbrachte.
Nach seiner Promotion in Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) in den USA im Geist von Keynes und Lehrstellen an verschiedenen italienischen Universitäten, wurde er 1984, 37 Jahre alt, zum italienischen Exekutivdirektor der Weltbank ernannt. 1991 wurde er Generaldirektor des italienischen Finanzministeriums. In dieser Zeit führte er die größte Privatisierungswelle der Geschichte in Kontinentaleuropa durch. Das war die Eintrittskarte Italiens in die EU-Währungsunion, für die das Land – was alle wußten – nicht die Voraussetzungen erfüllte, doch bestimmte Interessengruppen waren als gigantische Nutznießer durch die Privatisierungen zufriedengestellt worden. Wäre damals mit Romano Prodi nicht schon ein Italiener EU-Kommissionspräsident gewesen, wäre Draghi und nicht Horst Köhler, der nachmalige deutsche Bundespräsident, dafür 2000 mit dem Posten des geschäftsführenden Direktors des Internationalen Währungsfonds (IWF) belohnt worden. Draghi erhielt stattdessen den Vorsitz im Wirtschafts- und Finanzausschuß der EU. Draghis Aufstieg setzte sich an weit mächtigerer Stelle fort: 2002 wurde er Managing Director und Vizepräsident der weltweit größten Investmentbank Goldman Sachs International, eines jener Unternehmen im Gotha der Finanz, die Entscheidungsträger auf die höchsten Posten in Politik und Wirtschaft aus dem eigenen Mitarbeiterstab entsendet. So war es auch mit Draghi, der 2005 Gouverneur der italienischen Notenbank Banca d’Italia wurde. Von dort wechselte er 2011 schließlich an die Spitze der EZB. Eine Biographie, die zweifellos zeigt, daß er zu den Mächtigen gehört und als solcher zu einem engmaschigen Netzwerk, das darauf besteht, seinen Einfluß zu bewahren.

Die Fäden zwischen Santa Marta und Draghi reichen weiter zurück. Am 2. November 2019 veröffentlichte La Civiltà Cattolica eine Lobeshymne auf die Amtszeit Draghis bei der EZB, die gerade zu Ende ging. Ganze dreizehn Seiten umfaßte der Aufsatz mit der Überschrift „Der Beitrag von Mario Draghi zu Europa“[1] aus der Feder des Jesuiten und promovierten Wirtschaftswissenschaftlers Guido Ruta. Draghis Handeln, so P. Ruta, sei „entscheidend für die Rettung der Wirtschafts- und Währungsunion“ gewesen. Sie könnte sogar die „außerordentliche Gelegenheit“ sein, die europäische Einigung in der EU „zu vervollständigen“, indem alle „populistischen“, EU-kritischen und euroskeptischen Vorstöße durch die „Vollendung“ der politischen Union ein für alle Mal überwunden werden. Draghi habe dafür, so der Jesuit, die Voraussetzungen geschaffen.
P. Ruta ist es auch, der damals den Vorschlag machte, Draghi in die Politik zu holen, um den „populistischen“ Parolen und den Bestrebungen einer Rückkehr zu Landeswährungen entgegenzutreten. Beobachter merkten an: Würde auf der Titelseite nicht La Civiltà Cattolica draufstehen, könnte man annehmen, die Financial Times oder das Wall Street Journal zu lesen. Seit April 2020, fünf Monate nach der Veröffentlichung des Artikels, wird Draghi wiederholt als möglicher Nachfolger von Giuseppe Conte als nächster italienischer Ministerpräsident genannt. Von diesem Artikel der römischen Jesuitenzeitschrift führt auch ein gerader Weg zur Ernennung Draghis zum ordentlichen Mitglied der Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften.
Nach dem Vorbild von Mario Monti, ebenfalls bei Goldman Sachs unter Vertrag, könnte Draghi kurz vor dem Sprung in den Palazzo Chigi stehen und die Liste der an die Politik verliehenen Goldman-Sachs-Vertreter erweitern. Den Segen der römischen Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica und von Santa Marta hat er bereits.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: Vatican.va/Wikicommons/La Civiltà Cattolica (Screenshots)
[1] Guido Ruta, Il contributo di Mario Draghi all’Europa, in: La Civiltà Cattolica, Heft 4065 (2019), S. 220–233.