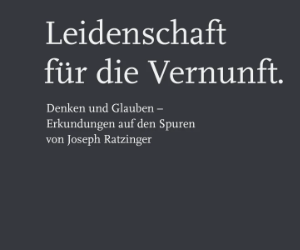Die Internationale Theologenkommission des Papstes legte gestern eine Studie über die „Reziprozität zwischen Glauben und Sakramenten in der Sakramentenökonomie“ vor. Die Studie über die Wechselseitigkeit von Glauben und Sakramenten befaßt sich auch mit der Frage, ob die sakramentale Ehe von Getauften, die nicht gläubig sind, ein Sakrament ist. Vom Heiligen Stuhl wurde die umfangreiche Studie bisher in englischer und spanischer Sprache veröffentlicht.
Die umfangreiche Studie ist das Ergebnis von fünf Jahren Arbeit. Ihr Hauptteil ist der 4. Teil, in dem die Frage behandelt wird, ob eine Ehe, die ohne Glauben geschlossen wurde, ein Sakrament ist. Die Frage wird anhand des Lehramtes der drei jüngsten Päpste behandelt. Die Theologenkommission verweist zunächst darauf, daß es für die Kirche nicht zwei Formen der Ehe gibt, eine natürliche und eine sakramentale, sondern nur die sakramentale Ehe. Sie gelangt daher zum Schluß, dargelegt im Paragraphen 188, daß es eine Ehe ohne Glauben nicht geben könne, weshalb die Kirche mit gutem Grund die Eheschließung verweigert, wenn die Brautleute einen offenkundigen Glaubensmangel erkennen lassen.
Damit verwirft die Kommission theologische Positionen, die sie als „extreme Positionen“ bezeichnet, die entweder einen Automatismus des Sakraments vertreten, unabhängig vom Vorhandensein von Glauben bei den Eheleuten, oder den fehlenden Glauben der Brautleute durch den Glauben der Kirche ersetzt sehen, wodurch die Gültigkeit und Wirksamkeit des Ehesakraments garantiert werde.
Die Internationale Theologenkommission vertritt hingegen die Position einer „dialogischen Natur der Sakramentenökonomie“, bei der die sakramentale Ehe somit nicht ohne einen lebendigen Glauben der Braut- oder Eheleute auskomme.
Die Kommission begründet in den Paragraphen 151–165 unter Nennung der lehramtlichen Quellen, wann und in welcher Form die vergangenen drei Päpste die Frage nach der Wechselwirkung von persönlichem Glauben der Brautleute und dem Zustandekommen eines gültigen Ehesakraments aufgeworfen und die Notwendigkeit ihrer gründlichen Untersuchung angemahnt haben.
Die Kommission folgt in ihrem Ergebnis der in der Theologie und in Rom allgemein vertretenen Position. Behandelt werden auch pastorale Aspekte, was eine Ablehnung eines Wunsches, sich kirchlich trauen zu lassen, bedeuten könne und wie damit umzugehen sei.
Die Studie wirft aber auch Fragen auf, nämlich nicht so sehr wegen der Thematik, die von der Kommission in den Mittelpunkt gestellt wurde und die die Eheschließung selbst betrifft, sondern Fragen zu den Folgewirkungen für bereits geschlossene Ehen durch „getaufte Ungläubige“ oder „nichtgläubige Getaufte“.
Die Kommission nahm ihre Arbeit zu einem Zeitpunkt auf, als Papst Franziskus in zwei Schritten die Unauflöslichkeit der sakramentalen Ehe erschütterte.
Der erste Schritt dazu erfolgte noch im Jahr seiner Wahl mit der Einberufung der beiden Familiensynoden. Angeführt von Kardinal Walter Kasper wurde damit der Weg zur faktischen Zulassung von Ehescheidung und Zweitehe geebnet, umgesetzt von Franziskus durch sein nachsynodales Schreiben Amoris laetitia.
Der zweite Schritt war die Änderung der Ehegerichtsbarkeit durch ein vereinfachtes Ehenichtigkeitsverfahren und die Einführung neuer Nichtigkeitsgründe. Obwohl im Oktober 2015 die zweite Familiensynode noch bevorstand, schuf Papst Franziskus bereits einen Monat vorher vollendete Tatsachen.
Mit dem Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus (Der milde Richter Herr Jesus), das er ohne Vorankündigung erließ, verlieh Franziskus zum 8. Dezember 2015 einer Reihe von Neuerungen Rechtskraft, die er „marianische“ Etappen nannte:
- Abschaffung der zweiten Instanz und des doppelten Urteils
- Abschaffung des Richterkollegiums und Ersetzung durch einen Einzelrichter
- Übertragung der Zuständigkeit an den Bischof, in Fällen „evidenter“ Nichtigkeit direkt zu entscheiden
- Vereinfachung der dispensa super ratum durch Einführung des „sehr wahrscheinlichen“ Zweifels, daß die Ehe nicht vollzogen wurde
- Einführung neuer Nichtigkeitsgründe
Die Nichtigkeitserklärung eines Ehebandes, das heißt, eines Sakraments, ist von so schwerwiegender Bedeutung, daß das zwingende doppelte Urteil (und die Letztentscheidung der Rota Romana bei Nicht-Übereinstimmung der beiden Urteile) bis dahin als Garantie gegen einen möglichen Irrtum der Richter gesehen wurde.
Als neue Nichtigkeitsgründe nennt Franziskus im Motu proprio:
- jenen Mangel an Glauben, der die Simulation des Konsenses oder den willensbestimmenden Irrtum hervorbringen kann;
- eine kurze Dauer des ehelichen Zusammenlebens;
- eine zur Vermeidung der Fortpflanzung vorgenommene Abtreibung;
- das hartnäckige Verharren in einer außerehelichen Beziehung zum Zeitpunkt der Eheschließung oder unmittelbar danach;
- das arglistige Verschweigen von Unfruchtbarkeit oder einer schweren ansteckenden Krankheit oder von Kindern aus einer vorhergehenden Beziehung oder eines Gefängnisaufenthalts;
- ein dem ehelichen Leben völlig fremdes Heiratsmotiv oder die unerwartete Schwangerschaft der Frau;
- Ausübung physischer Gewalt zur Erzwingung des Konsenses;
- den durch ärztliche Dokumente erwiesenen fehlenden Vernunftgebrauch;
- usw.
Manche dieser Gründe, etwa ein „zu kurzes Zusammenleben“, lösten unter Ehebandverteidigern, aber auch im gläubigen Volk erhebliches Kopfschütteln aus.
Der „fehlende Glauben“, der im Mittelpunkt der fünfjährigen Studie der Theologenkommission stand, wurde von Franziskus zuoberst an erster Stelle genannt.
Paolo Deotto, der Chefredakteur von Riscossa Cristiana, sprach damals von einem „weiteren Schritt zur Demolierung der Familie“. In der Verteidigung ihrer Ehe würden die Eheleute in diesem Pontifikat nicht gerade verwöhnt.
Nicht minder deutlich wurde Giuliano Ferrara, der ehemalige Chefredakteur der Tageszeitung Il Foglio, der am 9. September 2015 schrieb:
„Die Kirche der Barmherzigkeit hat sich in Bewegung gesetzt. Sie bewegt sich nicht auf dem Verwaltungsweg, sondern auf dem Gerichtsweg, auf dem vom Recht wenig übrigbleibt“.
In einer Präzisierung von November 2015, verlesen von Msgr. Pio Vito Pinto, dem Dekan der Sacra Rota Romana, anläßlich der Eröffnung des neuen Gerichtsjahres, stellte Franziskus klar, daß jede Diözese ein eigenes Gericht für die neuen, verkürzten Ehenichtigkeitsverfahren errichten sollte, falls dies nicht möglich sei, aber interdiözesane Gerichte geschaffen werden können.
Ein niederschmetterndes Urteil fällte Geraldina Boni, Lehrstuhlinhaberin für Kirchenrecht und Geschichte des Kirchenrechts an der Universität Bologna sowie Consultorin des Päpstlichen Rates für die Gesetzestexte. Sie schrieb zu dem, dem einzelnen Bischof anvertrauten, verkürzten Nichtigkeitsverfahren anstelle ordentlicher Kirchengerichtsverfahren:
„Persönlich werden wir keine theoretischen Vorbehalte gegen eine Aufwertung der diözesanen Gerichtsbarkeit haben. Wir denken aber, daß dies zumindest durch aufeinanderfolgende Etappen entwirrt werden und zudem natürlich besser verpackt werden sollte. Die Möglichkeit des Richters, zur Wahrheitsfeststellung zu gelangen, für die zweitausend Jahre der Geschichte umsichtig den gerichtlichen Weg als den sichersten ausgewiesen haben, darf nicht gefährdet werden. Wenn dieser nicht mehr gangbar ist, wird es schwierig, die feststellende Natur der Urteile beizubehalten, die stattdessen dazu führen, die Nichtigkeit der Ehe zu ‚konstituieren‘ und damit irreparabel die Unauflöslichkeit zu kompromittieren: Das, was nicht einmal der Papst in seiner plenitudo potestatis (Fülle der Gewalt) tun kann.“
Durch die Veröffentlichung der Studie der Internationalen Theologenkommission ergibt sich für die Priester die praktische Empfehlung, keine Eheschließung zu erlauben, wenn bei den Brautleuten ein offenkundiger Mangel an Glauben gegeben ist.
Das sollte allerdings keine Neuheit darstellen.
Entscheidender ist, wie sich die Studie in die aufgezeigte Stoßrichtung von Papst Franziskus einfügt, die Ehenichtigkeitsverfahren zu beschleunigen und zu erleichtern, da Franziskus den fehlenden Glauben an erster Stelle unter den neuen Ehenichtigkeitsgründen nennt. Die Frage stellt sich damit weniger am Beginn der Eheschließung, sondern mehr bei bereits geschlossener und vollzogener Ehe.
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL