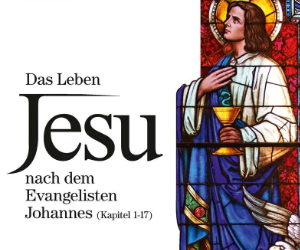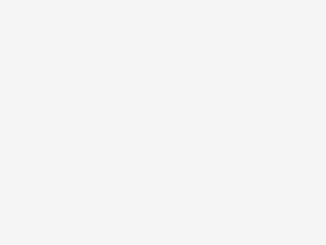(Caracas) Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan besuchte nach der Teilnahme am G20-Gipfel in Argentinien auf dem Rückflug noch Venezuela. Das „bolivarische“, sozialistische Regime von Staats- und Regierungschef Nicolas Maduro befindet sich durch Massenexodus, Aufstände und Wirtschaftskrise mit dem Rücken zur Wand. In Caracas ist daher jeder willkommen, der Aussicht auf Hilfe bringt. Das sind derzeit Rußland und die Türkei. Erdogan will die Gelegenheit nützen und erhält im Gegenzug für die Türkei bevorzugte Bedingungen für die heimischen Unternehmen und eine offene Tür für die Islamisierung.
Nicht der G20-Gipfel, sondern der Besuch in Venezuela war der wichtigere Teil von Erdogans Südamerika-Reise. Maduro, der immer unberechenbarer wird, begrüßte das türkische Staatsoberhaupt mit aufgesetztem Stolz und mindestens ebenso vielen Hoffnungen. Es war nicht nur der erste Staatsbesuch eines türkischen Präsidenten in dem lateinamerikanischen Land, sondern gleich ein Triumph. Die Verzweiflung der venezolanischen Regierung ließ sie auf der dringenden Suche nach Wirtschaftshilfe alle Ehren für den neuen Sultan am Bosporus aufbieten.
Maduro ist es gelungen, die Unruhen, die Mitte 2017 das Land erschütterten, mit harter Hand und dem Einsatz von paramilitärischen Banden niederzuschlagen. Den wirtschaftlichen Niedergang des Landes konnte er aber nicht aufhalten. Bis zum Jahresende wird mit einer Inflationsrate von über einer 1.000.000 Prozent gerechnet, während die Wirtschaftsleitung um bis zu einem Fünftel zurückgehen dürfte. Politisch ist das Land weitgehend isoliert.
Anfang des Jahrhunderts tauschte Hugo Chavez mit Kuba Erdöl gegen Zucker. Nun muß Maduro der Türkei Erdöl gegen Medikamente und Grundnahrungsmittel abgeben. In dieser hoffnungslosen Situation war die Ankunft Erdogans wie der ersehnte Lichtblick.
Der türkische Staatspräsident sagte, die „in den vergangenen zwei Jahren erreichten Beziehungen weiter verbessern“ zu wollen. „Manchmal nennen sie auch mich Sultan. Wir teilen gemeinsame Anliegen“, replizierte Maduro im freundschaftlichen Ton. Er schenkte seinem türkischen Staatsgast eine Nachbildung von Simon Bolivars Schwert, mit dem dieser das Land in die Unabhängigkeit führte. Zugleich verlieh er Erdogan den höchsten venezolanischen Orden „El Libertador“ (Der Befreier).
„Wir werden den Großteil der unmittelbaren Bedürfnisse Venezuelas abdecken. Wir haben die Kraft und die Möglichkeit dazu“, bedankte sich Erdogan. Erst vor zwei Monaten hatte Maduro die Türkei besucht.
Die Türkei, deren Verhältnis sich mit den USA weniger herzlich geworden und mit der EU ziemlich zerrüttet ist, ist zusammen mit Rußland zur wichtigsten Wirtschafts-Stütze für das Maduro-Regimes geworden. Tonnen von venezolanischem Gold sollen zur Verarbeitung in die Türkei gebracht werden. Die USA zeigen sich besorgt, daß das Gold über den Umweg Türkei in Wirklichkeit in den Iran fließen könnte. Maduro reagierte prompt und verbat sich „eine Einmischung in den Handelsaustausch zwischen Venezuela und der Türkei“.
In Caracas unterzeichneten die beiden Länder eine Reihe von Verträgen, mit denen türkischen Unternehmen Schürf- und Bohrrechte übertragen wurden. Als Maduro vor wenigen Wochen in Kleinasien war, wurde von der Türkei die Lieferung von 300 Containern mit Medikamenten und Lebensmitteln zugesichert. Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern übertraf 2018 erstmals eine Milliarde Dollar.
Das Rahmenabkommen sieht vor, daß türkische Unternehmen in Venezuela 45 Prozent des Profits erhalten, der venezolanische Staat 55 Prozent. Venezuela liefert dafür der Turkish Airlines Treibstoff.
Annäherung zwischen Venezuela und der Türkei
Die erste Annäherung zwischen Erdogan und Maduro kam auf einem Treffen der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) zustande, die als Reaktion auf die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump stattfand, die US-Botschaft in Israel von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Maduro bezeichnete Trumps Entscheidung als „Kriegserklärung an das arabische Volk, an die Muslime und an die Menschen guten Willens der ganzen Welt“.

Neben den Handelsbegünstigungen öffnet Maduro sein Land auch dem Islam. Bereits vor zwei Monaten war in Istanbul vereinbart worden, daß die Türkei in Caracas ein großes, islamisches Kulturzentrum mit Moschee errichten darf. Es wird der erste türkische Stützpunkt des Islams in Lateinamerika sein. Nun gab Erdogan in Caracas bekannt, daß „wir auf Einladung der venezolanischen Regierung mit den Arbeiten zum Bau des Zentrums in Caracas begonnen haben“. Es soll nach Yunus Emre benannt werden.
Für Erdogan handelt es sich um einen zu Hause herzeigbaren Erfolg, nachdem das kommunistische Regime auf Kuba zuvor den Bau einer Moschee abgelehnt hatte. Erdogan ist der Überzeugung, daß islamische Seefahrer bereits vor Christoph Kolumbus Amerika entdeckt hätten. Aus diesem Grund dürfte es aus seiner Sicht nur recht und billig sein, auch in Lateinamerika den Islam zu verbreiten.
Maduro kündigte an, an den venezolanischen Universitäten Lehrstühle für Türkei-Studien einzurichten. Das Programm dazu wird Adan Chavez, der Bruder des verstorbenen Vorgängers von Maduro, Hugo Chavez, leiten. Dieser hatte bereits Kontakte zu verschiedenen radikalislamischen Kreisen unterhalten, besonders zum Iran.
Wie ebenfalls in diesen Tagen bekannt wurde, schloß Maduro ähnliche Abkommen auch mit Rußland ab. Bei seinem jüngste Besuch in Moskau seien Verträge im Gesamtwert von sechs Milliarden unterzeichnet worden.
Papst Franziskus als „moralische“ Stütze des Regimes
Wenn Erdogan und Putin die wichtigsten Verbündeten Maduros auf ökonomischer Ebene sind, ist es Papst Franziskus auf moralischer Ebene. Der Papst sicherte, wie es in Kreisen der venezolanischen Opposition heißt, Ende 2016 das Überleben der „Bolivarischen“ Regierung, als der Sturz Maduros schon so gut wie sicher schien. Papst Franziskus äußerte sich zwar öffentlich nie direkt zu innenpolitischen Fragen Venezuelas. Aus seinem Umfeld war jedoch zu hören, daß er die Alternative zu Maduros Regierung für das „größere Übel“ hält. Venezuela verfügt über die größten Erdölreserven der Welt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung 2011 berichtete.

Nicolas Maduro ist seit 2013 Staatspräsident und Regierungschef von Venezuela. Das Amt übernahm er nach dem Tod von Hugo Chavez, der ihn am Ende seines Lebens als Vizepräsidenten eingesetzt und zu seinem Nachfolger bestimmt hatte. Maduro stammt aus einer religiös gemischten, faktisch aber atheistischen Familie. Die Eltern waren sozialistische Aktivisten. Der 1998 bei einem Autounfall ums Leben gekommene Vater, ein Gewerkschaftsführer, stammte aus jüdischem, die Mutter aus katholischem Haus. Die Religion habe in der Familie jedoch kaum eine Rolle gespielt, so Maduro. Das Engagement für den Sozialismus sei im Vordergrund gestanden. Maduro wurde katholisch getauft, studierte zum Teil im kommunistischen Kuba und schloß sich frühzeitig der Bolivarischen Befreiungsbewegung von Hugo Chavez, einer venezolanischen Variante des Sozialismus. Zusammen mit Chavez gründete er 1997 die Bewegung Fünfte Republik, die 2007 in die Vereinigte Sozialistische Partei (PSUV) umbenannt wurde.
Seit Chavez 1998 die Präsidentschaftswahlen gewann, gilt in Venezuela die „Bolivarische Revolution“ als Staatsdoktrin. Maduro wurde 2006 Parlamentspräsident und Außenminister. Vor einigen Jahren bezeichnete sich Maduro noch als Anhänger des Gurus Sai Baba. Seit der Wahl von Papst Franziskus und der zunehmenden innenpolitischen Krise in Venezuela kam es zu einer neuen Übereinstimmung mit dem Heiligen Stuhl, die sich für Maduro bisher bezahlt machte.
Als die venezolanische Kirche das Regime von Nicolas Maduro als „diktatorisch, kommunistisch, marxistisch und unterdrückerisch“ kritisierte, besonders nach den getürkten Parlamentswahlen, schwieg Papst Franziskus und schloß sich der Kritik nicht an. Er unterließ es „die antidemokratische und gewalttätige Haltung der venezolanischen Regierung“ zu kritisieren, die von der Ortskirche beklagt wurde. Die Stimme des Papstes habe im Volk aber großes Gewicht, so die katholische Opposition. Sein Schweigen habe die kirchliche Hierarchie gebremst und Maduro vor wirklich gefährlichen Aufständen bewahrt.
Die venezolanische Opposition wirft Franziskus vor, in seiner Unterstützung für das sozialistische Regime so weit zu gehen, nicht einmal als Vermittler aufzutreten.
Maduro, der bereits dreimal von Franziskus im Vatikan empfangen wurde, erklärte zum fünften Jahrestag der Wahl von Papst Franziskus triumphierend, der Papst habe „den Rechten und den Oligarchen den Mund gestopft“.
Tareck El Aissami am Verhandlungstisch
Eine zentrale Rolle bei den bilateralen Verträgen mit der Türkei und Rußland spielt Tareck El Aissami. El Aissami ist Druse. Sein Vater stammt aus dem syrischen Drusengebiet, seine Mutter ist libanesische Christin. Die Familie unterstützte die Baath-Partei im Irak und in Syrien. Die Abneigung gegen die USA ging soweit, daß El Aissamis Vater publizistisch 2003 Saddam Hussein gegen den Angriff der USA verteidigte und Osama bin Laden als „größten Mudschaheddin der Welt“ bezeichnete. Chavez machte den wegen seiner Entschlossenheit bekannten El Aissami mit erst 33 Jahren zum Innen- und Sicherheitsminister. Maduro ernannte ihn Anfang 2017 zu seinem Vizepräsidenten. Die USA werfen ihm und seiner Schwester, Haifa Aissami Madah, von 2010–2016 Botschafterin in den Niederlanden und seither ständige Vertreterin Venezuelas bei der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPWC) und beim Internationale Strafgerichtshof (ICC), beide mit Sitz in Den Haag, ist, eine Verwicklung in den internationalen Drogenhandel vor. Venezolanische Regierungsmedien sprachen von einer „haltlosen Diskreditierungskampagne“, während die Neue Zürcher Zeitung berichtete, Tareck El Aissami habe Kokaintransporte „im großen Stil“ von Kolumbien über Venezuela und Mexiko in die USA organisiert.
Die US-Regierung verhängte Sanktionen gegen ihn. Im vergangenen Juni nahm ihn Maduro ins zweite Glied zurück und ersetzte ihn als Vizepräsidenten. Zugleich wurde El Aissami zum Industrieminister des Landes ernannt. Als solcher saß er am Verhandlungstisch mit der Türkei und mit Rußland, um die jüngsten, milliardenschweren Abkommen auszuhandeln.
Text: Andreas Becker
Bild: NBQ