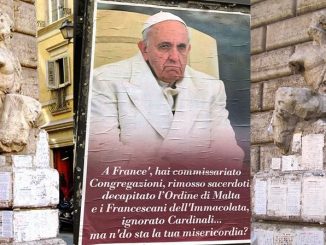(Rom) Bereitet Papst Franziskus, oder die Männer hinter ihm, die seine Wahl zum Papst vorbereiteten, ein Drittes Vatikanisches Konzil vor? Dieser Frage ging der Vatikanist Sandro Magister nach.
Die am 28. Oktober zu Ende gegangene Bischofssynode sollte der Jugend gewidmet sein. In seiner Abschlußrede bezeichnete Papst Franziskus allerdings etwas anderes als „ihre erste Frucht“: nämlich „die Synodalität“.
Die „offensichtliche Manipulation“
Der Begriff ist ein Neologismus, der von Papst Franziskus in die Kirche eingeführt wurde. „Die erstaunlichsten und auch am meisten durch Gegenstimmen beanstandeten Paragraphen des Schlußdokuments sind jene über die ‚synodale Form der Kirche‘.“
Das sei deshalb so erstaunlich, so Magister, weil über die Synodalität in keiner Phase der Synode, weder während der Vorbereitung noch während der Synode selbst oder in den Arbeitsgruppen, gesprochen wurde.
Erst im Schlußbericht tauchte der Begriff auf. Wie der Osservatore Romano enthüllte, hatte Papst Franziskus persönlich an der Schlußredaktion des Dokuments teilgenommen. Sicher ist sicher.
Der Erzbischof von Sydney, Anthony Fisher, sprach von einer „offensichtlichen Manipulation“. Er brachte damit den Protest nicht weniger Synodenväter zum Ausdruck, die sich nicht nur übergangen, sondern verschaukelt fühlen. Ähnliche Vorwürfe hatte es bereits bei den beiden Familiensynoden gegeben. Die Kritik wurde schon damals laut, daß die Synode nur als Vorwand einberufen werden, und die Synodenväter reine Statisten seien, während die Entscheidungen längst von Franziskus im Alleingang getroffen worden seien. Für Aufsehen sorgte 2015 der Brief von dreizehn Kardinälen, allesamt Synodenväter, die gegen „vorgefertige Ergebnisse“ und eine gelenkte Synode protestierten.
Die römische Jesuitenzeitschrift La Civiltà Cattolica, unter Franziskus der direkte Ausfluß des päpstlichen Denkens, beharrte. Bereits in der Überschrift ihres Hauptberichtes zur Jugendsynode wurde klargestellt:
„Die Jugend hat die Synodalität der Kirche geweckt“.
Nichts dergleichen hatte „die Jugend“ geäußert, gefordert oder geweckt. Die Jesuitenzeitschrift machte sich ihre eigene „Jugendsynode“ à la Papst Franziskus.
Der Traum von Kardinal Martini
Magister zieht eine Parallele, die sich „unweigerlich“ aufdränge. 1999 hatte Kardinal Carlo Maria Martini den „Traum“ von einer „kollegialen“ Kirche vorgetragen, die „kollegial“ einige „Knoten der Glaubenslehre und Ordnung“ anpacke. Der 2012 verstorbene Martini war ein Jesuit wie Bergoglio. Von manchen wird er als eigentlicher Spiritus rector des derzeitigen Pontifikats gesehen. Kurz vor seinem Tod forderte er Papst Benedikt XVI. im Juni 2012 energisch und unmißverständlich zum Rücktritt auf. Jüngst wurde bekannt, daß Martini bereits wenige Monate vor dieser Aufforderung zu einer ehemaligen Angehörigen der Fokolarbewegung die Hoffnung äußerte, Papst Benedikt XVI. könne bald zurücktreten. Es erstaunt, weshalb Martini so intensiv einen Rücktritt Benedikts für möglich hielt, obwohl seit 600 Jahren kein Papst mehr zurückgetreten war.
Martini gründete in den 90er Jahren den Geheimzirkel von Sankt Gallen, von dem nach bisheriger Rekonstruktion die Initiative zur Wahl von Papst Franziskus ausging. Martini warf damals den Stein in den Teich, daß eine Synode nicht genügen könnte, um die von ihm gewünschten „Knoten“ zu lösen. Es brauche ein universales Instrument mit noch mehr Autorität. Ohne das Wort „Konzil“ auszusprechen, forderte der damalige Erzbischof von Mailand und Gegenspieler von Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI. nichts anderes als ein Drittes Vatikanisches Konzil.
Als „Knoten“ nannte Martini:
- Die Rolle der Frau in der Kirche;
- die Rolle der Laien und ihr Anteil an einigen Ämtern;
- die Sexualität;
- die Ehe;
- die Bußpraxis;
- die ökumenischen Beziehungen „zu den Schwesterkirchen“;
- das Verhältnis zwischen Staatsgesetz und Moralgesetz.
Der Kardinal nannte das ganze Programm der Fragen, zu denen es Reibeflächen mit der „modernen“ Welt gibt.
Franziskus betonte wiederholt die Notwendigkeit eines permanenten, synodalen Stils des Hörens und der Unterscheidung. Dazu gibt es die Bischofssynoden, die Franziskus zumindest nach außen als Hauptinstrument seiner Neuerungen einsetzt, die er im Alleingang, aber rund um eine Synode – vorher, während oder nachher – einführt.
Synodalität, alter (kollegialer) Wein in neuen Schläuchen
Magister sieht heute kaum mehr jemand in der Kirche, der wirklich ein Drittes Vatikanisches Konzil anstrebt oder wünscht. Franziskus arbeite an anderen Modellen. Er will Kollektivorgane, die dem Kirchenrecht bisher fremd sind, als kollegiale Instrumente zu richtigen Entscheidungsorganen umbauen. Dazu gehört seine Entscheidung zur Neugestaltung er Bischofssynode. Künftig, wenn der Papst es vorab erlaubt, können Synodenbeschlüsse direkter Teil des kirchlichen Lehramtes werden.
Auch die Bischofskonferenzen, bisher nur ein Hilfsinstrument, das die Einzelverantwortung der Diözesanbischöfe für ihren Jurisdiktionsbereich nicht aufhob, sollen mehr Zuständigkeiten erhalten. Im Bereich der Übersetzung der liturgischen Texte wurde diese Übertragung der Zuständigkeit von Franziskus bereits vollzogen. Ähnlich verhält es sich bei der Zulassung von Protestanten zur Kommunion, wie das umstrittene deutsche Beispiel vom Sommer zeigt.
Selbst in Fragen der Glaubenslehre deutete Franziskus in Evangelii gaudium (Paragraph 32) an, sich eine Entscheidungskompetenz der Bischofskonferenzen, nicht der einzelnen Bischöfe, vorstellen zu können.
Wenn die Idee eines Dritten Vaticanums im Moment wenig Anhänger habe, könne sich das auch ändern, so Magister. Zur Frage, was die Konzile in der Kirchengeschichte waren und was sie in Zukunft sein könnten, verweist der Vatikanist auf einen Vortrag von Kardinal Walter Brandmüller. Brandmüller war von 1998 bis 2009 Vorsitzender des Päpstlichen Komitees für Geschichtswissenschaft. Den Vortrag hielt der deutsche Kardinal, der zu den Unterzeichnern der Dubia (Zweifel) zum umstrittenen nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia gehört, am vergangenen 12. Oktober in Rom (eine Zusammenfassung des Vortrages).
Text: Giuseppe Nardi
Bild: MiL