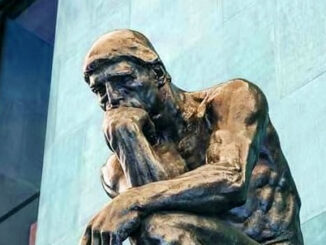Von Roberto de Mattei*
Die beeindruckende Schnelligkeit, mit der sich die Dinge in der Kirche ereignen, läßt daran denken, daß das nicht nur einer Dynamik der Beschleunigung der Geschichte geschuldet ist, sondern auf eine bewußte Entscheidung der Agenten des Chaos zurückgeht, um die Verwirrung und Lähmung der Kräfte zu verstärken, die der vorrückenden Flut zu widerstehen versuchen.
Am 22. September gaben der Heilige Stuhl und die Volksrepublik China in einer gemeinsamen Erklärung die Unterzeichnung eines „provisorischen“ Abkommens über die Ernennung der katholischen, chinesischen Bischöfe bekannt. Der Text wurde allerdings nicht veröffentlicht, weshalb sein Inhalt unbekannt ist.
Der emeritierte Bischof von Hong Kong, Kardinal Joseph Zen, ließ AsiaNews folgende Erklärung zukommen:
„Die so sehr erwartete Erklärung des Heiligen Stuhls ist ein Meisterwerk der Kreativität, mit vielen Worten nichts zu sagen. Sie besagt, daß das Abkommen provisorisch ist, ohne etwas über die Dauer seiner Gültigkeit zu sagen; sie sagt, daß periodische Überprüfungen vorgesehen sind, ohne zu sagen, wann die erste fällig sein wird. Abgesehen davon kann jedes Abkommen als provisorisch bezeichnet werden, weil eine der Seiten immer einen Grund finden kann, eine Änderung oder Annullierung des Abkommens zu fordern. Die wichtige Sache ist dabei aber, daß sich dieses Abkommen, auch wenn nur provisorisch, solange niemand eine Änderung oder Annullierung fordert, in Geltung bleibt. Das Wort ‚provisorisch‘ besagt nichts. ‚Das Abkommen behandelt die Ernennung der Bischöfe.‘ Das hat der Heilige Stuhl schon oft und schon lange gesagt. Was ist also das Ergebnis dieser langen Mühe? Was ist die Antwort auf unser langes Warten? Dazu sagt man nichts! Ist es geheim!? Die ganze Erklärung läßt sich auf diese Worte reduzieren: ‚Es wurde ein Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China über die Ernennung der Bischöfe unterzeichnet‘. Der ganze Rest sind nur sinnleere Worte. Wie lautet also die Botschaft, die der Heilige Stuhl den Gläubigen in China sendet? ‚Habt Vertrauen in uns und akzeptiert, was wir beschlossen haben‘? Und was wird die chinesische Regierung den Katholiken in China sagen? ‚Gehorcht uns, der Heilige Stuhl hat uns schon zugestimmt.‘“
Der Kern des Abkommens dürfte folgender sein: Die Bischofskandidaten werden von der offiziellen chinesischen Kirche ausgewählt, die von der Patriotischen Vereinigung kontrolliert wird, die ein verlängerter Arm der Kommunistischen Partei ist. Die chinesischen Stellen werden dem Heiligen Stuhl Kandidaten vorschlagen, die der Kommunistischen Partei genehm sind.
Was aber geschieht, wenn der Papst damit nicht einverstanden sein sollte? P. Bernardo Cervellera kommentierte diese Eventualität am 24. September bei AsiaNews wie folgt:
„Bisher war die Rede von einem befristeten Vetorecht des Papstes: Der Papst habe innerhalb von drei Monaten seine Ablehnung zu begründen. Sollte die Regierung aber die päpstliche Ablehnung für unbegründet halten, würde sie die Ernennung und die Weihe ihres Kandidaten fortsetzen. Da wir den Text des Abkommens nicht kennen, wissen wir nicht, ob diese Klausel beibehalten wurde, ob also der Papst wirklich das letzte Wort zu den Ernennungen und Weihen hat, oder ob seine Autorität nur formal anerkannt wurde.“
Sollte das Veto befristet sein und das letzte Wort der chinesischen Regierung zukommen, wäre dies ein schwerer, von der Kirche verurteilter Fehler. Pius VII. zum Beispiel verleugnete das mit Napoleon am 25. Januar 1813 unterzeichnete Konkordat von Fontainebleau, gerade weil es vorsah, daß die Bischofsernennung des Kandidaten des französischen Kaiserreiches automatisch als bestätigt galt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten die päpstliche Bestätigung eingehe.
Doch auch wenn das Veto unbefristet wäre, würde die Rolle des Papstes auf die eines bloßen Notars reduziert. Sie würde sich darauf beschränken, die Ernennung zu ratifizieren, wenn er ein Tauziehen mit den politischen Machthabern vermeiden will, mit denen er krampfhaft das Einvernehmen suchte. Das „Veto“ könnte nur eine Ausnahme sein, aber sicher nicht die Regel. In jedem Fall erleben wir eine Neuauflage der Ostpolitik von Paul VI., die den Katholiken in den Ländern Osteuropas so großen Schaden zufügte.
Es besteht leider ein enger Zusammenhang zwischen dem unheilvollen Abkommen mit China und der Apostolischen Konstitution Episcopalis communio über die Struktur der Bischofssynode, die von Papst Franziskus am 15. September unterzeichnet und am 18. September veröffentlicht wurde. Mit diesem Dokument, wie Stefania Falasca im Avvenire vom 18. September erklärte,
„wird nun die Praxis der Synodalität als ständige Form des Weges der Kirche normiert und mit ihr der Grundsatz, der die Etappen dieses Prozesses regelt: Hören, Volk Gottes, Bischofskollegium, Bischof von Rom: der eine hört die anderen und die anderen hören den Heiligen Geist“.
Auf welche Weise endet dieser Prozeß des charismatischen Hörens? Die Artikel 17 und 18 der apostolischen Konstitution erklären es. Die Schlußfolgerungen der Synodenversammlung werden in einem Schlußdokument zusammengefaßt. Nachdem es von einer eigenen Kommission genehmigt wurde, „wird es dem Papst übergeben, der über seine Veröffentlichung entscheidet. Wenn es ausdrücklich vom Papst genehmigt wird, ist das Schlußdokument Teil des ordentlichen Lehramtes des Nachfolgers Petri (Art. 18, § 2). Sollte der Papst der Synodenversammlung gemäß Can. 343 des Codex des Kirchenrechtes beschließende Vollmacht gewährt haben, ist das Schlußdokument Teil des ordentlichen Lehramtes, sobald es vom Nachfolger des Petrus ratifiziert und promulgiert wird. In diesem Fall wird das Schlußdokument mit der Unterschrift des Papstes zusammen mit jener der Mitglieder veröffentlicht (Art. 18, § 3).
In jedem Fall ist das Synodendokument „Teil des ordentlichen Lehramtes des Nachfolger des Petrus“. Die lehramtliche Tragweite der Dokumente wie Amoris laetitia und der Schlußfolgerungen der kommenden Synoden über die Jugend und den Amazonas wird bestätigt. Welche Rolle spielt aber Petrus bei der Ausarbeitung der Synodendokumente? Es ist, wie bei der Ernennung der chinesischen Bischöfe, die Rolle eines bloßen Notars, dessen Unterschrift notwendig ist, um den Beschluß in Kraft zu setzen, ohne daß er aber inhaltlich Autor desselben ist.
Die Kirche ist drauf und dran eine Republik zu werden – nicht eine präsidiale Republik, sondern eine parlamentarische, in der dem Staatsoberhaupt nur die Rolle eines Garanten der politischen Teile und als Repräsentant der nationalen Einheit zukommt – und auf die Mission des Papstes als absoluter Monarch und oberster Gesetzgeber zu verzichten. Um dieses „demokratische“ Projekt zu verwirklichen, setzt der Nachfolger des Petrus allerdings diktatorische Machtmittel ein, die nichts mit der Regierungstradition der Kirche zu tun haben.
Im Zuge der Pressekonferenz, auf der das päpstliche Dokument vorgestellt wurde, erklärte Kardinal Lorenzo Baldisseri, der Generalsekretär der Bischofssynode, daß „die Apostolische Konstitution Episcopalis communio von Papst Franziskus eine regelrechte ‚Neugründung‘ des synodalen Organismus darstellt“, und daß „in einer synodalen Kirche auch der Primat des Petrus mehr Licht bekommen kann. Der Papst steht nicht allein über der Kirche, sondern in ihr als Getaufter unter Getauften und im Bischofskollegium als Bischof unter Bischöfen, zugleich gerufen – als Nachfolger des Apostels Petrus – die Kirche von Rom zu leiten, die in der Liebe allen Kirchen vorsteht“ (Vatican Insider, 18. September 2018).
Die orthodoxen Theologen können die Schwere dieser Aussagen beurteilen, die den Anspruch erheben, das munus Petri „neuzugründen“ und „zu reformieren“.
Noch nie wurde der römische Primat mehr geleugnet und entstellt als in diesem Moment, einem Moment, indem eine Welle des Schmutzes die Braut Christi zu versenken scheint.
Wer das Papsttum wirklich liebt, hätte die Pflicht, es von den Dächern zu schreien. Es scheint aber, daß das Schweigen nicht nur Papst Franziskus betrifft. Auch die Bischöfe und die Kardinäle, die die Kirche leiten, scheinen angesichts der Skandale und Irrtümer, die sie heute beuteln, zu wiederholen: „Ich werde kein Wort dazu sagen.“[1]Antwort von Papst Franziskus am 26. August 2016 auf dem Rückflug von Dublin nach Rom auf die Frage der Journalisten, was er zum Dossier des ehemaligen Apostolischen Nuntius, Msgr. Carlo Maria … Continue reading
*Roberto de Mattei, Historiker, Vater von fünf Kindern, Professor für Neuere Geschichte und Geschichte des Christentums an der Europäischen Universität Rom, Vorsitzender der Stiftung Lepanto, Autor zahlreicher Bücher, zuletzt in deutscher Übersetzung: Verteidigung der Tradition: Die unüberwindbare Wahrheit Christi, mit einem Vorwort von Martin Mosebach, Altötting 2017.
Übersetzung: Giuseppe Nardi
Bild: Wikicommons
-
| ↑1 | Antwort von Papst Franziskus am 26. August 2016 auf dem Rückflug von Dublin nach Rom auf die Frage der Journalisten, was er zum Dossier des ehemaligen Apostolischen Nuntius, Msgr. Carlo Maria Viganò, sagt, das am selben Tag veröffentlicht wurde und Papst Franziskus schwer belastet. Erzbischof Viganò forderte sogar seinen Rücktritt; Anm. Katholisches.info. |
|---|